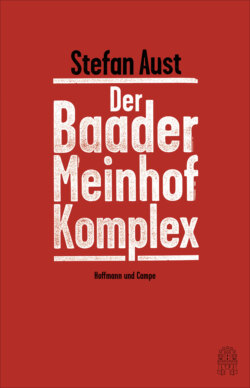Читать книгу Der Baader-Meinhof-Komplex - Stefan Aust - Страница 31
28. Bambule
ОглавлениеAnfang 1970 war Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite von Dahlem näher an das Berliner Zentrum gezogen. Mit den ZwillingenRöhl, Bettina wohnteRöhl, Regina sie jetzt in Schöneberg, Kufsteiner Straße 12. Seit einiger Zeit lebte dort auch Peter HomannHomann, Peter, jener ehemalige Kunststudent aus Hamburg, der nach dem 2. Juni 19672.Juni 1967 zusammen mit Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt und anderen die »Albertz!Albertz-DemonstrationAlbertz, Heinrich – Abtreten«-Aktion gemacht hatte und den sie später bei »konkret«konkret kennenlernte. Einen Freundeskreis wie in Hamburg hatte Ulrike Meinhof in Berlin nicht wieder gefunden.
Sie wollte das wohl auch nicht mehr. In der vielfältigen politischen Szenerie Westberlins, in der sich rasch alle Fronten veränderten, begegnete man etablierten Figuren, die nicht aus der Berliner politischen Subkultur kamen, eher mit Misstrauen als mit Anerkennung.
Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite war weiterhin eine vielbeschäftigte Journalistin. Seit Jahren hatte sie sich mit dem Thema FürsorgeerziehungFürsorgeerziehung auseinandergesetzt, zahlreiche Artikel und Hörfunkfeatures über Jugendliche in Erziehungsheimen geschrieben.
Im Berliner Erziehungsheim Eichenhof hatte sie drei Mädchen kennengelernt, Jynette, Irene und Monika, deren Schicksal zur Grundlage des Drehbuches für den Film »Bambule« wurde. Die Dreharbeiten zu dem einzigen Fernsehspiel Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seites begannen Ende 1969.
In einem Hörfunkbericht hatte sie 1969 geschrieben: »Mit FürsorgeerziehungFürsorgeerziehung wird proletarischen Jugendlichen gedroht, wenn sie sich mit ihrer Unterprivilegiertheit nicht abfinden wollen. Heimerziehung, das ist der Büttel des Systems, der Rohrstock, mit dem dem proletarischen Jugendlichen eingebläut wird, dass es keinen Zweck hat, sich zu wehren, keinen Zweck, etwas anderes zu wollen, als lebenslänglich am Fließband zu stehen. Bambule, das ist Aufstand, Widerstand, GegengewaltGegengewalt – Befreiungsversuche. So was passiert meist im Sommer, wenn es heiß ist, wenn das Essen noch weniger schmeckt, wenn sich die Wut mit der Hitze in den Ecken staut. So was liegt in der Luft – vergleichbar den heißen Sommern in den Negerghettos der Vereinigten Staaten.«
Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite wollte keine Trennung mehr von den Objekten ihrer Berichterstattung und den Personen, die von ihr mehr erwarteten, als nur beschrieben zu werden.
Bald standen sie vor ihrer Tür. FürsorgezöglingeFürsorgezöglinge aus dem Frankfurter Projekt und Berliner Jugendliche, die um Einlass baten. Einige erhielten Quartier, legten sich in die Betten, bedienten sich aus dem Kühlschrank, klauten und brachten Geklautes in die Wohnung, lärmten und bewarfen die Nachbarn vom Balkon aus mit Eiern. Ulrike fiel es schwer, die Jugendlichen vor die Tür zu setzen. Sie selber hatte Probleme genug. Sie stürzte sich in zahlreiche Projekte und Diskussionen, war nachts bis in den frühen Morgen unterwegs. Stunden später standen die ZwillingeRöhl, Bettina in ihremRöhl, Regina Schlafzimmer und riefen: »Aufstehen!« Sie kamen oft zu spät zur Schule. Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite hatte Schuldgefühle, zu wenig für die Kinder zu tun.
Ein paar Tage vor Weihnachten 1968 hatte sie das Drehbuch für den Fernsehfilm an den Südwestfunk geschickt. »Hier endlich das MS«, schrieb sie an den zuständigen Fernsehredakteur Dieter WaldmannWaldmann, Dieter. »Zu treuen Händen.« Ganz professionelle Autorin, gab sie ein paar Hinweise für die Inszenierung: »Bei Irene ist noch wichtig, dass sie mit einem ungeheuren Wuschelkopf – verkorkste Dauerwelle – anfängt … Und Jynette sieht aus wie ein Mann … Von dem Gedanken, mit Laien dokumentarisch zu drehen, bin ich vollkommen abgekommen. Laien denke ich mir als Statisten. Im Übrigen bin ich für Schauspieler. Dies ist einfach kein Dokumentarfilmdrehbuch.«
Wenn der Redakteur einen besseren Titel als »Bambule«Bambule wisse, interessiere sie das: »Ganz glücklich war ich mit keinem meiner Einfälle.« Am Ende wünschte sie fröhliche Weihnachten und hatte noch eine Bitte: »Wenn Geld – dann bitte erst im nächsten Jahr, wegen der Steuern.«
Die Arbeit an dem Film zog sich über mehr als ein Jahr hin. Währenddessen versank Ulrike immer mehr in eine Depression, die sie versuchte, politisch zu interpretieren.
Ihre journalistische und schriftstellerische Arbeit genügte ihr immer weniger. Nicht im Beschreiben der Wirklichkeit sah sie ihre Aufgabe, sondern in der Veränderung. Theoretisch jedenfalls. Selbst aktiv geworden war sie so gut wie nie – von der gescheiterten Aktion gegen ihre eigene Zeitschrift »konkret« einmal abgesehen.
Die praktische Arbeit am Film stürzte Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite 73 in immer tiefere Zweifel über den Sinn ihres Tuns. Irgendwann skizzierte sie ihre Einsichten während der Dreharbeiten: »Dem Drehbuch nach sind die Mädchen die Hauptpersonen des Films. Das war der Zweck des Ganzen, diese Mädchen, denen man sonst nichts zutraut, die im Heim und außerhalb wie Dreck behandelt werden, zu zeigen, wie sie sind: leidend und handelnd, getretene Mädchen, die permanent Widerstand leisten, eine verfolgte Jugend, die sich wehrt.«
Es sei ihre Absicht gewesen, die IsolationIsolation der Mädchen aufzubrechen, Solidarität mit ihnen von außen herzustellen. Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite 73 bitter: »Die Absicht mag richtig sein, das Mittel – ein Film – erwies sich schon beim Drehen als falsch.«
Die echten Heimmädchen seien wie im richtigen Leben nur Statistinnen, eine Randgruppe, gewesen. Die Hauptpersonen seien von Schauspielerinnen mit den glatten Gesichtern von Mädchen bürgerlicher Herkunft gespielt worden: »Ihre Stimmen sind die Stimmen von Mädchen, die gewohnt sind, Konversation zu machen, nicht Stimmen, die Auseinandersetzungen und Kämpfe gewohnt sind. Ihr Trotz ist kokett.« Für die Schauspielerinnen seien die Dreharbeiten im Heim nichts als ein exotisches Erlebnis gewesen. Die realen Heimmädchen hätten ihre Statistengage von 250 Mark sofort für Klamotten ausgegeben. Das wiederum habe den Fürsorger im Heim veranlasst, das Gerücht zu verbreiten, die Mädchen hätten das Geld versoffen. Als die Filmemacher wieder aus dem Heim verschwunden seien, habe er seinen Terror unvermindert fortsetzen können. Den Kampf dagegen führten die Mädchen, als wären die Filmer nie dagewesen. »Der Film hat nicht einmal die unmittelbar an den Dreharbeiten Beteiligten für die Mädchen einnehmen können, wie viel weniger wird er die Zuschauer agitieren …« Es sei ihre Absicht gewesen, mit dem Film etwas zu verändern. Spätestens seit den Erfahrungen bei den Dreharbeiten im Heim sei ihr klar geworden: Der Film ist für ihre politischen Intentionen ein ungeeignetes Mittel.
Der Text zeigt, wie weit Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite sich inzwischen von ihrer publizistischen Arbeit verabschiedet hatte. »Ändern wird sich nur etwas«, so schrieb sie, »wenn die Unterdrückten selbst handeln. Wer sie dabei unterstützen will, muss es praktisch tun, muss den Unterdrückten selbst helfen, sich zu organisieren, zu handeln, ihre Forderungen durchzusetzen. Es kommt nicht darauf an, ihnen zu zeigen, wie man es machen muss, es kommt darauf an, selbst mitzumachen.«
Mit dem Film »Bambule«Bambule werde dem Fernsehpublikum das Elend der Mädchen zum Konsum – einen netten Abend lang – angeboten. »Ein Fernsehspiel«, so das Resümee der Autorin, »das die Mädchen einmal mehr verschaukelt, man darf sagen: ein Scheißspiel.«
Um die Jahreswende 1969/70 herum wurde Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite 73 in ihrer Dahlemer Wohnung von der Filmemacherin Helma SandersSanders, Helma interviewt. Nervös rollte sie Papierkügelchen zwischen ihren Fingern und rauchte eine Zigarette nach der anderen. Verzweiflung stand in ihrem Gesicht. »Privatangelegenheiten sind immer politische«, sagte sie, »Kindererziehung ist unheimlich politisch, die Beziehungen, die Menschen untereinander haben, sind unheimlich politisch, weil sie etwas darüber aussagen, ob Menschen unterdrückt sind oder frei sind. Ob sie Gedanken fassen können oder ob sie keine Gedanken fassen können. Ob sie was tun können oder nichts tun können. Von den Bedürfnissen der Kinder her gesehen ist die Familie, ja ist die Familie der stabile Ort mit stabilen menschlichen Beziehungen notwendig und unerlässlich.«Fotos: Ulrike im Interview mit Helma Sanders
Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite machte eine Pause. Mit leiser Stimme fuhr sie fort: »Schwer – schwer – unheimlich schwer – na, es ist schwer – ist unheimlich schwer. Das ist natürlich viel einfacher, wenn man ein Mann ist und wenn man also eine Frau hat, die sich um die Kinder kümmert, und das geht in Ordnung. Und die Kinder brauchen ja wirklich stabile Verhältnisse und einen, der wirklich viel Zeit für sie hat. Und wenn man Frau ist und also keine Frau hat, die das für einen übernimmt, muss man das alles selber machen – es ist unheimlich schwer.« Fotos: Ulrike im Interview mit Helma SandersFotos: Ulrike im Interview mit Helma Sanders
Sie unterbrach ihren Redefluss, so als hätte sie sich selbst dabei ertappt, allzu viel Privates herauszulassen. Plötzlich wurde sie wieder ganz sachlich und politisch:
»Also ist das Problem aller politisch arbeitenden Frauen – mein eigenes inklusive – dieses, dass sie auf der einen Seite gesellschaftlich notwendige Arbeit machen, dass die den Kopf voll richtiger Sachen haben, dass sie eventuell auch wirklich reden und schreiben und agitieren können. Aber auf der anderen Seite mit ihren Kindern genauso hilflos dasitzen wie alle anderen Frauen auch. Und sehr viele von diesen Frauen haben dieselben Schwierigkeiten innerhalb ihrer Familien, die alle anderen Frauen auch haben.
Wenn man so will, ist das die zentrale Unterdrückung der Frau, dass man ihr Privatleben als Privatleben in Gegensatz stellt zu irgendeinem politischen Leben. Wobei man umgekehrt sagen kann, da, wo politische Arbeit nicht was zu tun hat mit dem Privatleben, da stimmt sie nicht, da ist sie perspektivisch nicht durchzuhalten.
Man kann nicht antiautoritäre Politik machen und zu Hause seine Kinder verhauen. Man kann aber auf die Dauer auch nicht zu Hause seine Kinder nicht verhauen, ohne Politik zu machen, das heißt, man kann nicht innerhalb einer Familie die Konkurrenzverhältnisse aufgeben, ohne nicht darum kämpfen zu müssen, die Konkurrenzverhältnisse auch außerhalb der Familie aufzuheben, in die jeder reinkommt, der also …«
Sie zögerte und setzte dann ganz leise hinzu: »… seine Familie anfängt zu verlassen.«
Wenige Monate später sollte Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite 73 ihre Kinder verlassen.
Ulrike fiel in immer tiefere Selbstzweifel. Zwei kleine Texte hatte sie noch über den »Bambule«-Bambule-Film verfassen sollen. Sie schrieb sie lieblos herunter und schickte sie an den Fernsehredakteur WaldmannWaldmann, Dieter.
»Das Problem ist, dass mich die Dreharbeiten ziemlich fertiggemacht haben, dass ich nun erst voll begriffen habe, wie sie mich eineinhalb Jahre lang korrumpiert hat [sic!], insofern sie für mich ein unausgesprochenes Verbot darstellte, das Selbstverständliche zu tun, nämlich aus meinen Kenntnissen der Heime die richtigen, das heißt praktischen Konsequenzen zu ziehen.«
Natürlich könne sie ihm das nicht vermitteln, denn er sei ja auch nur ein Schreiber. Sein Job sei das Fernsehspiel. Also könne er sie nur für verrückt erklären.
»Nur ist mir jetzt wirklich klar geworden, dass ein Aufstand im Heim, die Organisierung der Jugendlichen selbst, tausendmal mehr wert sind als zich Filme.«
Sie selbst habe keine Lust mehr, ein Autor zu sein, der die Probleme der Basis in den Überbau hieve, womit sie nur zur Schau gestellt würden, damit andere sich daran ergötzten, zu ihrem eigenen Ruhm. »Verstehst Du? Das habe ich kapiert, dass ich mit diesem Film nichts als ein ästhetisches Verhältnis zu den Problemen dieser proletarischen Jugend herstelle, wie jeder andere Schriftsteller auch – dass das Gewäsch ist, Revolutionsgewäsch.«
Konsequenz daraus sei gewesen, dass sie ein fest vereinbartes Interview über den Film abgesagt habe. »Ich kann mir unter diesen Umständen auch keinen neuen Film von mir vorstellen. Was ich vorhabe, ist, politisch zu arbeiten.«
Am Ende wurde sie noch einmal versöhnlich: »Versuche mal, jetzt nicht bitterböse auf mich zu sein, sondern die Geschichte ein bisschen zu verstehen. Sie ist nicht einfach verrückt. Im Grunde ist sie nur konsequent und zum Glück noch nicht so korrupt, dass ich es nicht noch ticken kann. Tschüss für heute. Ulrike.«
Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite hatte ein Grundproblem angesprochen, das unter Autoren, Journalisten und Filmemachern der späten sechziger Jahre ständig diskutiert wurde. Doch nur wenige – vor allem wenige bekannte – hatten aus der Theorie praktische Konsequenzen gezogen. So wie die meisten Aufforderungen der radikalen LinkeLinken theoretisch aufgestellt, aber niemals praktisch befolgt worden waren. So hatten alle Anwesenden auf dem Vietnam-Tribunal im Audimax der Technischen Universität das überdimensionale Plakat beklatscht: »Es ist die Pflicht jedes Revolutionärs, die Revolution zu machen.« Aber nur wenige hatten es auch nur versucht.Fotos: Ulrike bei Demo im Märkischen ViertelFotos: Ulrike bei Demo im Märkischen Viertel
So bekundete auch Fernsehredakteur WaldmannWaldmann, Dieter in der Antwort seine Sympathie für Ulrikes Selbstzweifel: »Das geistige Dilemma, in das Du geraten bist, kann ich gut verstehen; ich lebe ständig in dieser Situation des Zweifelns über die Effektivität dessen, was ich tu.« Aber die Reaktionen auf seine Arbeit rissen ihn immer wieder aus dem Schlamassel heraus. Er fände es einigermaßen naiv, wenn Ulrike erst jetzt, nach Abschluss der Dreharbeiten, auf diese Gedanken käme.
Besonders die Art und Weise, in der Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite 73 über die Mitglieder des Filmteams geurteilt hatte, empörte den Fernsehmann: »Du beschuldigst unser Team der Teilnahmslosigkeit. Liebe Ulrike, mein Team hat von morgens bis in die Nacht Schwerstarbeit geleistet … So ist das in dem Beruf, dessen Spielregeln das Team nicht bestimmt, leider. Dass unsere Mitarbeiter von der Misere, die sie gesehen haben, nicht betroffen gewesen wären, ist eine Unterstellung, die kränkend ist. Ist es nur Dir vorbehalten, mitzuleiden? Weißt Du eigentlich, dass die von Dir verleumdeten Schauspielerinnen sich mit einigen Mädchen verabredet haben nach dem Dreh? Zum Kaffee, zum Theaterbesuch? Dass unsere Maskenbildnerin einem der Mädchen in ihren Beruf helfen will? Dass wir gestern gerade bei uns beredet haben, dass wir eben diesen Kontakt nicht abbrechen lassen?« Habe sie wirklich erwartet, dass das Team mit den Mädchen eine echte RevolutionRevolution inszenieren und dabei Job, Familie, alles auf Spiel setzen würde?
»Du kommst mir vor«, schrieb Dieter WaldmannWaldmann, Dieter, »wie diese hochmütigen Intelligenzler, die den Springer-Arbeitern zurufen, sich mit ihnen zu solidarisieren, ohne zu fragen, wer denn dann den Lohn zahlt.« Offenbar würde sie wütend um sich herum alle beschuldigen, weil sie wieder einmal ihre eigene politische Misere vor Augen habe. Für sie, die Autorin, möge »Bambule«Bambule ein »Scheißspiel« sein. Für ihn sei es ein Versuch, anstelle von volksverdummenden »Scheißspielen« ein kleines Stückchen Aufklärungsarbeit zu leisten. »Im Übrigen hoffe ich auf den Tag, da bei Dir wieder einmal die Kohlen nicht stimmen und Du gnädigst Dein zweites Spiel für uns schreibst.«
Aber Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite schrieb bereits an ihrem Spiel. Es sollte eine Tragödie werden.
Die Dreharbeiten zum Fernsehfilm »Bambule«Bambule waren Anfang Februar 1970 abgeschlossen. Kurz darauf erhielt Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite Besuch aus Italien. Vor ihrer Tür in der Kufsteiner Straße standen Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt, wie immer elegant, diesmal in einem der maßgeschneiderten Seidenhemden, die er dem gutsortierten Kleiderschrank des Komponisten Hans WernerWerner, Hans-Ulrich Henze in Rom entnommen hatte, und Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt, die energische Pfarrerstochter. Sie suchten sich ein Zimmer aus. In Berlin, so glaubten die beiden, könnten sie sich unerkannt bewegen und gleichzeitig politisch aktiv sein. Natürlich konnte die Wohnung der prominenten linken Journalistin ihnen nur vorübergehend als Herberge dienen.
Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite war einverstanden. Sie wollte den beiden helfen. Das Leben der KaufhausbrandstifterKaufhausbrandstifter schien ihr viel konsequenter als ihr eigenes. Sie hoffte, von ihnen zu lernen. Baader und Ensslin hatten sich auf ihrer Flucht durch Italien in einsamen Stunden manchmal einen »Schuss«Drogen verpasst und versuchten, auch Ulrike Meinhof dafür zu gewinnen. Die Gastgeberin hatte jedoch seit ihrer Gehirnoperation panische Angst davor, mit chemischen Substanzen zu experimentieren. Eines Nachts ließ sie sich überreden, und alle nahmen eine jener gelben Pillen, die unter dem Namen »Sunshine« in der Berliner Drogenszene leicht erhältlich waren: LSDDrogen.
In dieser Nacht wechselte die Stimmung abrupt. Sie war heiter, ironisch, aggressiv, brutal und dann wieder voller geträumter Gemeinsamkeiten. Ulrike konnte sich nur mit äußerster Anstrengung konzentrieren und erlebte Momente großer Angst, in denen sie fürchtete, die Wirkung würde nie wieder aufhören. Es war die Angst, verrückt zu werden, die sie nach ihrer Operation kennengelernt hatte.
Mit Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt wäre sie wohl nicht allein auf den Trip gegangen. Aber da war Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt, in deren Leben sie Gemeinsamkeiten mit sich selbst entdeckt hatte und von der sie fasziniert war. Sie hatte kompromisslos gehandelt, wie Ulrike meinte. Mit ihr sprach sie in dieser Nacht auch darüber, dass Gudrun ihr Kind verlassen hatte, um mit der Vergangenheit vollständig zu brechen. Gudrun Ensslin vertrat missionarisch eine neue Moral, die Moral der Revolutionäre, die einen Strich durch die eigene Herkunft machen und hinter sich alle Brücken verbrennen müssten. Deshalb sei Besitzlosigkeit und Illegalität für sie die einzig noch mögliche Lebensform.
Im Verlauf der nächtlichen Euphorie entwickelte Ensslin ein neues »Glaubensbekenntnis«Glaubensbekenntnis, alternatives, ein Gegenbekenntnis zu ihrer eigenen Herkunft. Alle zehn Gebote müssten gebrochen werden. Aus dem biblischen Gebot »Du sollst nicht töten« müsse in dieser Welt der Gewalt werden: »Du musst töten.« Als die Wirkung des LSDDrogen am Morgen ausklang, frühstückten sie gemeinsam im Café Kranzler.
Viele ihrer früheren Freunde gaben damals ihr studentisches Leben vorübergehend auf. Sie arbeiteten in Fabriken, um ihre »Schuld«, in die falsche Klasse hineingeboren zu sein, durch körperliche Arbeit inmitten des Proletariats abzutragen. Auch angehende Schriftsteller waren dabei, »Betriebsarbeit« zu leisten. Das hatte immerhin den Vorteil, neben der Möglichkeit zur Agitation auch seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. »Dem Volk dienen!«, hieß die MaoMao Tse Tung-Losung dieser Zeit. Andere, die dem frühen Aufstehen nicht so viel abgewinnen konnten, riefen ihnen hinterher: »Seid schlau, bleibt beim Überbau!«
Etwa zwei Wochen blieben Ensslin und Baader in der Kufsteiner Straße. Den Zwillingen BettinaRöhl, Bettina und RegineRöhl, Regine, damals sieben Jahre alt, wurde gesagt, dass es sich bei den beiden Besuchern um Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt und Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt handele, dass diese ein KaufhausKaufhausbrandstifter angezündet hatten und deswegen von der Polizei gesucht wurden. Aus diesem Grunde sollten sie die beiden im »KinderladenKinderladen« und in der Schule nicht erwähnen und sie zu Hause nur »HansDecknamen« und »GreteDecknamen« nennen. Diese beiden Namen behielten Baader und Ensslin auch später als Decknamen.
Ulrike meinte, ihre beiden Gäste seien »Genossen«, besonders gute sogar. Die Zwillinge aber fanden an Baader überhaupt keinen Gefallen. Er war offenbar nicht besonders kinderlieb. Als BettinaRöhl, Bettina eines Tages hinfiel und sich die Knie blutig schlug, hob er sie nicht auf, sondern lachte nur schadenfroh. Später, als die Kinder Karl-May-Bücher lasen, fand Bettina in »Winnetou I« eine Figur, die sie an Baader erinnerte. Es war Rattler, der zu einer Truppe raubeiniger Landvermesser gehörte, skrupellos war und gleichzeitig feige, sodass die Indianer später seine Hinrichtung am Marterpfahl abbrachen und ihn voller Verachtung im Fluss ertränkten.
Baader und Ensslin hatten zu dieser Zeit nicht etwa konkrete Pläne, eine Stadtguerillatruppe aufzubauen. Im Kopf bewegten sie sehr vage Vorstellungen von Randgruppenstrategien, zwar aus der IllegalitätIllegalität heraus, auch militant, aber keineswegs militärisch. Vordringliches Ziel indessen war schlichtweg, Wohnungen zu besorgen, Geld zu beschaffen, Kontakte zu knüpfen.