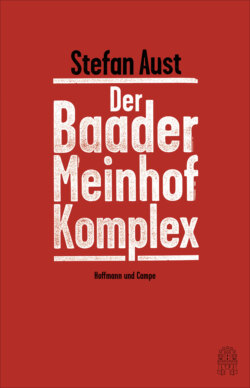Читать книгу Der Baader-Meinhof-Komplex - Stefan Aust - Страница 28
25. Baader, Ensslin und die Sozialarbeit
ОглавлениеDie vier Brandstifter wurden am 13. Juni 1969 aus dem Gefängnis entlassefreigelassenen. Sie hatten vierzehn Monate ihrer Strafe abgesessen; etwas mehr als ein Drittel. Im November sollte über die Revision ihrer Urteile entschieden werden, bis dahin durften sie auf freiem Fuß bleiben.
Sie trafen sich in einer Wohnung in der Frankfurter Feuerbachstraße. Baader war aggressiv und rasend eifersüchtig. Immer wieder schrie er Gudrun an: »Du hast mit der Tochter der Anstaltsleiterin gefickt. Gib es zu.« Schweigend ertrug Gudrun seinen Zorn. Tatsächlich hatte sie sich in der Haft mit NeleEinsele, Nele, der Tochter der AnstaltsleiterinEinsele, Helga, angefreundet, die im Gefängnis Sprachkurse gab. Die Wohnungsbesitzerin später: »So ein Kotzbrocken, der Baader. Gudrun hat sich das bieten lassen. Die sagte einfach nichts.«
Die freigelassenen Brandstifter kamen im Atelier eines Comiczeichners aus der linkeLinken Szene unter. Der Kommunarde Dieter KunzelmannKunzelmann, Dieter und dessen damalige Freundin, die spätere Terroristin Ina SiepmannSiepmann, Ingrid, reisten aus Berlin zur Entlassungsparty an, und zur Feier des Tages setzten sie sich eine Spritze mit Opiumtinktur. Die Nadel war offenbar verunreinigt, denn kurz danach erkrankte das Pärchen an Hepatitis, Gelbsucht.
In Frankfurt hatten sich gerade Studenten aus dem Umfeld des SDSSozialistischer Deutscher Studentenbund SDS mit den Zuständen in Erziehungsheimen beschäftigt. Mit Flugblättern und in Gesprächen versuchten sie, die Jugendlichen in den Heimen zu politisieren.
In den Randgruppen der Gesellschaft sahen sie Potenzial für gesellschaftliche Veränderungen. Jene, die kein behütetes Elternhaus hatten, die von den Institutionen des Staates verwaltet wurden, die in den Erziehungsheimen der tatsächlichen oder vermeintlichen Willkür autoritärer Erzieher ausgesetzt waren, sollten lernen, sich zu wehren.
Im Zuge der außerparlamentarischen Bewegung waren eine ganze Reihe von Jugendlichen aus hessischen Heimen ausgerückt und lebten mehr oder weniger illegal. Studenten hatten sich um sie gekümmert, ihnen Wohnungen verschafft, versuchten, sie außerhalb der staatlichen Fürsorgeeinrichtungen zu betreuen.
Gerade aus dem Gefängnis entlassen, tauchten Baader und Ensslin bei den »LehrlingskollektivLehrlingskollektiven« auf. Sie konnten andere Erfahrungen vorweisen als die Theoretiker von der Universität. Baader war einer von ihnen, wenn auch älter, und verlangte keine Anpassung an bürgerliche Normen. Er wollte die Jugendlichen nicht unbedingt in eine geregelte Arbeit pressen und nicht ständig mit ihnen über Politik diskutieren.
»Die Baader-Gruppe«, meinte später einer, der dabei war, »besticht die Lehrlinge mit Abenteuerspielchen, mit wildem, aufregendem Autofahren oder Aktiönchen gegen alles und jedes, was einem gerade über den Weg läuft. In einem Café gegen einen Kellner, gegen diesen und jenen ›liberalen Arsch‹. Bei den Baaders ist immer was los. Deshalb zieht es alle Jugendlichen dorthin.«
Baader und Ensslin übernahmen auch gegenüber den Behörden die Führung des Lehrlingsprojektes. Dem Leiter des Frankfurter Stadtjugendamtes, Herbert FallerFaller, Herbert, fiel vor allem Gudrun als eine »außergewöhnliche Frau mit pädagogischem Impetus« auf, die »echte Zuneigung zu den Jugendlichen entwickelte«.
Eine rasch wachsende Zahl entlaufener FürsorgezöglingeFürsorgezöglinge hatte sich um die entlassenen Kaufhausbrandstifter gruppiert. Gudrun versuchte immer wieder, von den Behörden finanzielle Unterstützung für sie zu bekommen. Man dürfe sie nicht in der Illegalität lassen, meinte sie und beschwor die Gefahr eines Abgleitens in die DrogenDrogenszene und in die Kriminalität. Als die Verhandlungen nicht schnell zu einem Ergebnis führten, besetzten Baader und Ensslin eines Tages mit ihren Schützlingen das Büro des Jugendamtsleiters.
Daraufhin besorgte FallerFaller, Herbert einige Wohnungen, in denen jeweils neun Jugendliche gemeinsam untergebracht wurden. Insgesamt 33 der entlaufenen Fürsorgezöglinge konnten in solchen Wohnkollektiven leben. Manche davon gingen auf Abendschulen und schafften später auch ihren Realschulabschluss. Nebenbei sammelten Baader und Ensslin Geld für die Jugendlichen, um jedem fünf Mark am Tag für Essen zu geben. Ihr Engagement beeindruckte den Leiter des Jugendamtes, und er empfand das als einen Versuch, »an neuer Stelle die politische Arbeit sinnvoll fortzusetzen«.
Auch der Leiter des Diakonischen Werkes in Frankfurt unterstützte das Projekt und besorgte für Baader und Ensslin eine Wohnung. Vor allem von Gudrun war er sehr angetan: »Sie suchte das Gespräch. Wenn eine Begnadigung erfolgt wäre, hätte ich sie durchaus bei der Evangelischen Kirche angestellt, beim Diakonischen Werk als SozialarbeitSozialarbeit, revolutionäreerin. Ich war an einer langfristigen konkreten Zusammenarbeit interessiert.«
Die Arbeit der LehrlingskollektivLehrlingskollektive selbst fand er dagegen nicht so überzeugend: »Sie hatten keine Zukunft, weil sie abhängig gewesen sind von den Studenten und nicht zu einem eigenen Selbstverständnis gekommen sind. Mein Eindruck über die KollektivKollektive: Tags schliefen sie, nachts tobten sie, die meisten haben nicht gearbeitet.«
Die FürsorgezöglingeFürsorgezöglinge wurden zur Zielgruppe revolutionärer Ambitionen. Es war der Beginn einer Allianz von Intellektuellen mit den Gefallenen am Rande der Gesellschaft: Rekruten für den Krieg der Bürgerkinder. In geschlossenen Erziehungsheimen wie dem Beiserhaus in Frankfurt saß nach ihrer Ansicht das Potenzial für eine revolutionäre Veränderung. Da passte es gut, dass das Gericht den Angeklagten eine Tätigkeit im sozialen Bereich zur Auflage gemacht hatte.
Peter-Jürgen BoockBoock, Peter-Jürgen war damals dabei. Baader und Ensslin hatten ihn nach der Flucht aus dem BeiserhausIsolation:Fürsorgeheim in der Gruppe aufgenommen. BoockBoock, Peter-Jürgen später: »Das Ziel des Kampfes war ganz klar die Veränderung dieser Gesellschaft mit allen Mitteln, also eben auch mit Mitteln des bewaffnetenKampf, bewaffneter Kampfes.«
Staatlich geförderte SozialarbeitSozialarbeit, revolutionäre als Rekrutierungsstätte für junge Revoluzzer.
Auch der deutsch-französische Studentenführer Daniel Cohn-BenditCohn-Bendit, Daniel, der beim Brandstifterprozess noch Randale gemacht hatte, erkannte die Pläne hinter der Sozialarbeit: »Baader hatte sich schon als General der Roten Armee gesehen. Und da waren seine Soldaten. Ich meine, Achtzehnjährige: Das ist das Alter, mit dem die Bolschewiki die Russische Revolution gemacht haben. Das waren die Phantasien, mit denen gespielt wurde. Ensslin hat alles gemanagt, und Baader hat einfach den Flair der RevolutionRevolution versucht zu vermitteln. Nicht nur versucht, er hatte es ja auch geschafft bei diesen jungen Machos.«