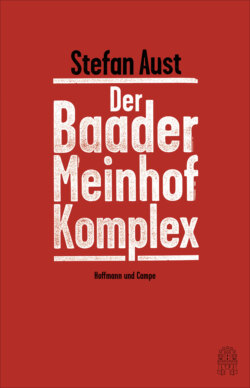Читать книгу Der Baader-Meinhof-Komplex - Stefan Aust - Страница 27
24. Abschied von »konkret«konkret
ОглавлениеAnfang 1968 hatte Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite sich von Klaus Rainer RöhlRöhl, Klaus Rainer scheiden lassen und ging mit ihren Kindern nach Berlin. Sie schrieb weiter ihre Kolumnen. Für jeden Kommentar erhielt sie 1500 Mark, das waren 3000 Mark im Monat, denn das Blatt erschien inzwischen alle vierzehn Tage.
Im Dezember 1968 besuchte RöhlRöhl, Klaus Rainer sie und die ZwillingeRöhl, Regina in BerlinRöhl, Bettina. Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite legte ihm einen Artikel vor: »Lies mal, Klaus. Ich bin gespannt, ob du den drucken wirst.« Röhl war entsetzt, denn Ulrike hatte sich die Zeitschrift selbst vorgenommen und sich mit ihrer eigenen Rolle als Kolumnistin kritisch auseinandergesetzt: »Was erwartet der Geldgeber von seinem Kolumnisten? Dass er sich ein eigenes Publikum erschreibt, möglichst eins, das ohne ihn die Zeitung nicht kaufen würde. Das ist der Profitfaktor. Ein Kolumnist, der das nicht leistet, wird über kurz oder lang gefeuert. Die Kehrseite der Kolumnisten-Freiheit ist die Unfreiheit der Redaktion.«
In ihrem Brief hatte sieRöhl, Klaus Rainer auch eine hämische Bemerkung gemacht, die sich offenbar auf mich bezog. Es war darin von Mitarbeitern die Rede, die »das Profitinteresse des Verlegers verinnerlicht« hätten. Das stimmte auch in gewissem Sinne, denn mir war es tatsächlich immer um eine möglichst hohe Auflage von »konkret«konkret gegangen. Mein politisches Sendungsbewusstsein hatte sich dagegen in Grenzen gehalten. Als RöhlRöhl, Klaus Rainer mich abends zu Haus anrief und fragte, wie er denn meiner Ansicht nach mit UlrikesMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite Brief umgehen sollte, sagte ich ihm: »Ganz einfach – drucken!« Das taten wir dann auch, unter meiner Zeile auf der Titelseite: »Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite: Ist Konkretkonkret noch zu retten?«
Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite schrieb auch danach weiter ihre Kommentare. Doch langsam zeichnete sich ein Ende der Zusammenarbeit ab.
Kurze Zeit später, Ende 1968, nach fast drei Jahren bei »konkret«konkret, entschied ich mich, dort aufzuhören, um doch noch ein Studium zu beginnen. Ich nahm einen eher geringfügigen Konflikt mit RöhlRöhl, Klaus Rainer zum Anlass, ihm das mitzuteilen.
RöhlRöhl, Klaus Rainer war nämlich häufig abwesend, ich musste in der inzwischen etwas größer gewordenen Redaktion die meisten Entscheidungen treffen, Titel und Titelüberschriften gestalten, das Layout selbst machen oder beaufsichtigen, entscheiden, welche Geschichten ins Blatt kamen und welche nicht. Ich arbeitete viel und hart, oftmals, vor allem in der Woche vor dem Erscheinen des Magazins, bis tief in die Nacht. Seit das Blatt nicht mehr monatlich, sondern alle vierzehn Tage erschien, war die Arbeitsbelastung noch beträchtlich gestiegen. Oft griff RöhlRöhl, Klaus Rainer dann im letzten Moment ein und stellte alles auf den Kopf. Das war sein gutes Recht als Verleger und Herausgeber, aber als er dann die besonders dummerhaftige Geschichte eines linken Schüler-Aktionisten von der Gymnasialfraktion des SDSSDS auf den Titel heben wollte, hatte ich einfach genug.
Ich kündigte ihm an, die nächste Ausgabe noch fertig zu machen und dann zu gehen. Da ich nicht fest angestellt war und nur auf der Basis eines – sehr guten – monatlichen Honorars gearbeitet hatte, konnte ich jederzeit aufhören. Bevor ich mit dem Studium anfing, wollte ich noch eine längere Reise in die USA machen. Ich beantragte beim amerikanischen Konsulat in Hamburg ein Visum, wurde dort ausgiebig vernommen und durfte dann für drei Monate in die Vereinigten Staaten.
Ich flog nach Miami und machte von dort aus einen Abstecher in die Karibik. Dann kehrte ich zurück nach Miami und kaufte mir einen gebrauchten dunkelgrünen Volkswagen und an einem Kiosk die neueste Ausgabe des »Spiegel«.Der Spiegel.
Darin stand ein Artikel von Otto KöhlerKöhler, Otto über den eskalierenden Streit bei »konkret«konkret: »MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite will nicht länger Feigenblatt für Redaktionsunfreiheit sein. Sie verlangt, dass der Chefredakteur aufhören muss, Anweisungen zu geben – Befehlsempfänger können keine gesellschaftlichen Verhältnisse aufdecken.« Erster Erfolg,Erfolg so schrieb KöhlerKöhler, Otto: »Stefan AustAust, Stefan, der als geschäftsführender Redakteur mit straffer Hand die Redaktion des antiautoritären Blattes regierte, ist ›in aller Freundschaft‹ gegangen. Und Herausgeber RöhlRöhl, Klaus Rainer, der einsame Entschlüsse liebt, sieht sich immer stärker dem Widerstand der von MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite aufgemunterten Redakteure konfrontiert.«
Ich machte mich auf die Reise durch die USA. Über Florida nach New Orleans, von da nach Mexiko und zurück nach Austin in Texas, wo gerade ein Kongress des amerikanischen SDS stattfand. Die »Students for a Democratic Society« wurden angeführt von Tom HaydenHayden, Tom, der – jedenfalls bei uns – als der »amerikanische Rudi DutschkeDutschke, Rudi« galt.
Ich lernte einige der studentischen Aktivisten kennen, die sich vor allem für die Bürgerrechte schwarzer Amerikaner und gegen den VietnamkriegVietnamkrieg engagierten. Es war die Zeit, in der die Flower-Power-Bewegung der Hippies sich in eine politische und eine eher dem DrogenkonsumDrogenkonsum zugeneigte Fraktion teilte. Es war damals sehr leicht, sich in der studentischen Politszene zu bewegen, man machte Kontakte und schloss Freundschaften, wurde ohne Probleme in Privathäusern oder Wohngemeinschaften untergebracht. Und gelegentlich zog man einen Joint durch, was bei mir kaum Wirkung hinterließ, denn ich hatte zuvor niemals geraucht. Erst durch häufigeres Ziehen an einem Joint, der die Runde machte, verlor sich das anfängliche Husten. Das brachte mich später dazu, Zigaretten zu rauchen – woran man sehen kann, dass Marihuana wirklich zu stärkeren DrogenDrogen führt.
Von Texas aus fuhr ich nach Los Angeles, lernte dort die Kinder einiger Hollywood-Stars kennen, badete im Pool ihrer Familienvillen und fuhr dann über den Highway Number 1 nach San Francisco, zum eigentlichen Ziel meiner Reise.
Über »konkret«konkret hatte ich Kontakt zum Managing Editor des linken Monatsmagazins »Ramparts« gehabt. Nach meiner Ankunft in San Francisco rief ich ihn an, und er lud mich sofort in sein Haus in North Beach ein, dem hügeligen Teil der Stadt mit Blick auf die Bay und die Golden Gate Bridge.
Ich klingelte zu später Stunde an der Tür, und es öffnete eine gutaussehende Schwarze mit üppiger Afro-Haartracht, die ich sofort als Kathleen CleaverCleaver, Kathleen erkannte. Sie war die Frau des Gründers der Black Panther PartyBlack Panther Party, einer militanten schwarzen Bewegung, deren Mitglieder in schwarzen Lederjacken, Handschuhen und Hosen und vor allem mit einem schwarzen Barett herumliefen – und sich demonstrativ bewaffneten.
Immerhin galt die amerikanische Waffenfreiheit auch für Schwarze, was in der weißen Öffentlichkeit – und vor allem bei der Polizei – nicht gut ankam. Ursprünglich hatten sie sich »Black Panther PartyBlack Panther Party for Self-Defense« genannt, waren antikapitalistisch, antiimperialistisch und antirassistisch – und neigten dem Maoismus und Leninismus zu. Die militante Gruppe war zwei Jahre zuvor von Huey P. NewtonNewton, Huey P. und Bobby SealeSeale, Bobby, unterstützt von David HilliardHilliard, David, gegründet worden.
Im Oktober 1967 wurde Huey NewtonNewton, Huey P. von der Polizei angeschossen und anschließend wegen Mordes an einem Polizisten verhaftet und angeklagt. 1968 und 1969 wurden weitere Mitglieder der Black Panther PartyBlack Panther Party von Polizisten oder Agenten des FBI erschossen. Der Chef der Behörde J. Edgar HooverHoover, J.Edgar nannte sie »die größte Bedrohung der nationalen Sicherheit«.
Sprecher der Black PanthersBlack Panthers war Eldridge CleaverCleaver, Eldridge, der wegen Überfalls und versuchten Totschlags in den berüchtigten Strafanstalten San Quentin und Folsom Prison eingesessen hatte. Dort schrieb er das Buch »Soul on Ice«, das zum philosophischen Fundament der Black Panther PartyBlack Panther Party werden sollte. 1966 war er aus dem Gefängnis entlassen worden und trat 1968 als Kandidat der »Peace and Freedom Party« zu den Präsidentschaftswahlen an. Er belegte mit 36563 Stimmen Platz sieben, geriet kurz danach in eine Schießerei in Oakland, wurde dabei verwundet und sollte anschließend wegen versuchten Totschlags verhaftet werden.
CleaverCleaver, Eldridge tauchte unter und floh aus den USA. Das FBI schrieb ihn zur FahndungFahndung aus, als die Nummer eins aller Gesuchten.
An jenem Abend in San Francisco war ich in ein Treffen der Black PanthersBlack Panthers geraten. Ich hörte mir die Diskussionen an und verabredete mich mit einigen der Anwesenden, um mir in den nächsten Tagen die Frühstücksaktion der Black PanthersBlack Panthers zeigen zu lassen. Sie luden regelmäßig die armen Kinder aus der schwarzen Community in Oakland ein, damit diese vor der Schule irgendetwas zu essen bekamen.
Ich schrieb darüber eine Geschichte für »konkret«konkret, mit dessen Herausgeber ich auch nach meinem Ausscheiden auf gutem Fuße stand. Inzwischen war mein alter Kumpel, der Kunstmaler Peter HomannHomann, Peter aus Berlin, zum regelmäßigen Mitarbeiter des Magazins geworden und ging eine Beziehung mit Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite 73 ein.
Im April 1969 hatte Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite ihre Mitarbeit bei »konkret« beendet. Sie schrieb an die »Frankfurter Rundschau«FrankfurterRundschau: »Ich stelle meine Mitarbeit jetzt ein, weil das Blatt im Begriff ist, ein Instrument der Konterrevolution zu werden, was ich durch meine Mitarbeit nicht verschleiern will, was zu verhindern im Augenblick nicht möglich ist. Ich gebe den Kampf um die Zeitung auf, um folgender Gefahr vorzubeugen, dass wir durch unsere Mitarbeit das Links-Image der Zeitung aufpolieren, ihr einen neuen Vertrauenskredit verschaffen. Eine Zeitung, die, wenn wir sie brauchen werden, sich gegen uns wenden wird. Mit einer Auflage, der wir dann nichts entgegenzusetzen haben werden als unsere Verzweiflung und unser Entsetzen über den Gebrauch des Instrumentes, das wir aufgebaut haben.«
Die Zeitschrift »konkret«konkret war von den Auseinandersetzungen in der linken ProtestbewegungProtestbewegungbewegung nicht verschont geblieben. Die Solidarität nach dem Attentat auf Rudi DutschkeDutschke-AttentatDutschke, Rudi und die großen DemonstrationNotstandsdemonstrationen gegen die NotstandsgesetzeDemonstrationen:Notstandsgesetze in Bonn waren vorbei. Es bildeten sich allerlei linkeLinke Zirkel, neue Parteien und Diskussionsrunden, die sich bald ausschließlich mit sich selbst beschäftigten und im Genossen von gestern den größeren Gegner ausmachten als im noch vorher gemeinsam bekämpften SpringerSpringer, Axel Cäsar oder StraußStrauß, Franz Josef.
»konkret«,konkret das schien ein klassisches Beispiel dafür, wie ein Verleger, Klaus Rainer RöhlRöhl, Klaus Rainer, linke Politik vermarktet, für die andere ihre Köpfe vor die Polizeiknüppel gehalten hatten.
Am 5. Mai 1969 lud Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite zu einer Diskussion über »konkret« in den »Republikanischen Club«Republikanischer Club in Berlin ein. Bei einer Diskussion sollte es diesmal nicht bleiben. Es wurde vorgeschlagen, den Verlag zu besetzenkonkret:Verlagsbesetzung und den Besitzer der Zeitschrift mit den Forderungen kompromissloser linker Journalisten zu konfrontieren. Ulrike Meinhof hatte mit vielen telefoniert und gesprochen, um sich Unterstützung für die Aktion zu sichern.
Am Abend darauf versammelten sich an verschiedenen Plätzen Berlins kleine Gruppen, die in einem Autokonvoi nach Hamburg aufbrechen wollten, um zu verhindern, dass die nächste Ausgabe von »konkret« erscheinen konnte.
RöhlRöhl, Klaus Rainer hatte zwei Tage zuvor von der geplanten Aktion erfahren und reagierte. Er ließ den Verlag räumen und entwarf ein Flugblatt: »›konkret‹ geht in den Untergrund.«
Gegen 10.00 Uhr trafen die Berliner Aktionisten bei der »konkret«-Redaktion am Hamburger Gänsemarkt ein. Presse und Polizei waren schon da. Die Staatsmacht, nicht von »konkret« gerufen, blockierte das Treppenhaus. Die Berliner verteilten ein Flugblatt an die »konkret«-Redakteure:
Ȇberm Schreibtisch Che GuevaraGuevara, Ernesto Che,
unterm Schreibtisch McNamaraMcNamara, Robert.
Ihr fahrt mit der Straßenbahn,
der Chef reist mit ’nem Porsche an.
Macht Schluss mit dem konkreten Mief
und schafft ein APOAPO Außerparlamentarische Opposition-Kollektiv.«
Frustriert standen die gescheiterten Redaktionsbesetzer auf der Straße herum. Dann gab jemand die Devise aus: »Auf nach Blankenese!« Dort hatten Röhl und Ulrike Meinhof eine schmucke Backsteinvilla erworben, eingerichtet mit plüschigem, altdeutschem Mobiliar. Die Berliner Truppe zog vor das Grundstück, sprang in den Garten und drang in das Haus ein. Möbel wurden aus dem Fenster geworfen, und einer der linksradikalen Vandalen pinkelte ins Ehebett. Einige der Beteiligten behaupteten allerdings später, der gelbe Fleck auf dem Laken sei das Ergebnis einer aufgelösten Vitamin-C-Tablette gewesen, die ins Bett geschüttet worden war. Während die Aktion noch lief, tauchte Ulrike Meinhof vor ihrem ehemaligen Wohnhaus auf, an dem sie immer noch einen Anteil hielt. Ratlos stand sie im Garten, neben einem Berliner Schriftsteller, der ein Transparent in die Kamera hielt: »konkret-Lohnschreiber fordern Mitbestimmung«.
Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite war nach dieser misslungenen Besetzung sehr einsam geworden. Ihr alter Freund, der Schriftsteller Peter RühmkorfRühmkorf, Peter, den sie einmal »den gerechtesten Menschen der Welt« genannt hatte, forderte alle bekannten linkeLinken Publizisten, die für »konkret« gearbeitet hatten, dazu auf, »den Terroraktionären zu bedeuten, was sie sind: Agents provocateurs«.
Ich blieb ein paar Wochen in San Francisco, arbeitete ein wenig bei einer linken Zeitung mit, erlebte die Anfänge einer Straßenschlacht um den »People’s Park« in Berkeley, wo auf einem Parkplatz zunächst ein Sportplatz und später ein Gebäudekomplex für die Universität errichtet werden sollte, die Studenten stattdessen jedoch einen grünen Park forderten. Der Streit eskalierte, und der kalifornische Gouverneur und spätere Präsident Ronald ReaganReagan, Ronald schickte massive Polizeikräfte, die sich am Ende mit bis zu 6000 Studenten eine blutige Schlacht lieferten. Schließlich schickte der ehemalige Western-Star ReaganReagan, Ronald die Nationalgarde.
Zu diesem Zeitpunkt war ich mit meinem kleinen grünen VW schon wieder auf dem Highway. Es ging über Las Vegas nach Chicago, dann weiter nach New York. Dort suchte ich Kontakt zu einer der vielen Underground-Publikationen und klopfte bei einer kleinen linken Nachrichtenagentur am Rand von Harlem an, die in einem ehemaligen Laden im Souterrain in der Claremont Avenue residierte.
Die Redaktion des »Liberation News Service« hatte enge Kontakte zu den Initiatoren der Studentenrevolte vom April 1968 an der New Yorker Columbia University, darunter auch der damalige Sprecher des SDS an der Universität, Mark RuddRudd, Mark. Ich lernte ihn beim LNS kennen, und wir unterhielten uns über die Entstehung des Studentenprotestes in den USA und in Deutschland. Nicht lange danach schloss RuddRudd, Mark sich einer Untergrundgruppe an. Knapp vierzig Jahre später trafen wir uns erneut, als ich für das ZDF an einem Film über das Jahr 1968 arbeitete.
»Das Ganze hatte etwas mit einer Generation zu tun, die nach dem Zweiten Weltkrieg erwachsen wurde, die mit der Bürgerrechtsbewegung und dem VietnamkriegVietnamkrieg konfrontiert wurde und durch die Ungerechtigkeit aufgeweckt wurde.«
Mark RuddRudd, Mark war in einer jüdischen Familie in einem weißen Vorort in New Jersey aufgewachsen, der langsam schwarz wurde. »Rassismus und der Kampf gegen den Rassismus waren genau dort zu Hause«, erzählte er mir, »für mich waren der Rassismus und das unbestreitbare Böse in Nazi-Deutschland dasselbe.« Nur dass in den sechziger Jahren sein Land das Böse ausgeübt habe: »Ich hatte mich immer darüber gewundert, warum die Deutschen das alles mitgemacht haben. Wir nannten es damals das Phänomen des ›Guten Deutschen‹. Aber mit meinen 18 Jahren wollte ich nicht so ein guter Deutscher, so ein guter Amerikaner sein.«
Nach dem Mord an Martin Luther KingKing, Martin Luther war die Columbia University in Aufruhr. Plötzlich gab es ein neues Bewusstsein für den an der Universität herrschenden, manchmal auch unterschwelligen Rassismus. Zum Beispiel untersagte die Universität dem schwarzen Personal der Cafeteria, sich mit den Puerto-Ricanern zu einer gemeinsamen Gewerkschaft zusammenzuschließen.
Die Studenten protestierten gegen die Arbeit des »Institute of Defence Analysis« (IDA) an der Universität, das sich für den Krieg in VietnamVietnamkrieg engagierte. Man besetzte die Sporthalle, die Polizei kam, die Schlacht begann.
Schließlich konnten die Studenten fünf Gebäude der Universität für eine Woche halten, und Columbia wurde das Symbol für die Studentenrevolte:
»Wir waren generell gegen Gewalt, obwohl die meisten von uns die gewaltsamen Revolten in der Welt befürworteten. Wir sahen den Krieg in VietnamVietnamkrieg, Krieg in Vietnam als einen Kampf gegen die amerikanische Übermacht, als einen gerechten Krieg. Wir waren solidarisch mit den Vietnamesen, die versuchten, die Amerikaner loszuwerden.«
Die Revolte an der Columbia University war für Mark RuddRudd, Mark wie für viele andere der Wendepunkt: »1968, das war wirklich der perfekte Sturm der Ereignisse.«
Der Aufstand passte in die Strategie Che GuevarasGuevara, Che, nach der eine kleine bewaffnete Gruppe einen revolutionären Kampf gegen eine Diktatur beginnt. »Das ist die klassische marxistische Avantgarde-Theorie. Wir sahen die Ereignisse an der Columbia University als Keimzelle, der sich viele, viele Menschen anschließen würden. Und dann würde sich das Beispiel von Columbia auf die gesamten Vereinigten Staaten übertragen.« Vier Jahrzehnte später fügte er hinzu: »Wenn man das heute so sagt, wirkt es ziemlich lächerlich.«
In diesem heißen Sommer 1969 in New York hatte ich Unterschlupf in einer Wohngemeinschaft direkt gegenüber dem Büro des LNS gefunden. Eines Abends kamen Mark RuddRudd, Mark und ein paar Genossen vom amerikanischen SDS vorbei, darunter Bernardine DohrnDohrn, Bernardine und Bill AyersAyers, Bill. Sie wollten mit den Redakteuren des LNS ein Papier diskutieren, das mit einem Zitat aus Bob DylansDylan, Bob Song »Subterranean Homesick Blues« überschrieben war: »You don’t need a weatherman to know which way the wind blows«.
»Es gab damals im SDS eine schwierige interne Auseinandersetzung«, erklärte Mark RuddRudd, Mark vierzig Jahre später. »Da gab es die dogmatischen Marxisten, die darauf warteten, dass die Arbeiterklasse die Revolution anführen würde. Aber welche Arbeiter? Wir auf der anderen Seite waren der Auffassung, die Revolution werde global und national stattfinden, also zu Hause, hier in diesem Land, angeführt von der Dritten Welt. Dazu brauchte man kein Dogma aus dem 19. Jahrhundert. Da musste man nur seine Augen öffnen und sehen, wie um uns herum in der Dritten Welt die Revolutionen ausbrachen. Das war mit dem Satz gemeint: Du brauchst keinen Wettermann, um zu wissen, woher der Wind weht.«
Im Vorwort des Strategiepapiers hieß es, die WeathermenWeathermen kämen als linke Bewegung, die eine amerikanische Revolution anzetteln würde, gleich hinter den Black PanthersBlack Panthers. Sie seien für den bewaffneten KampfKampf, bewaffneter und dafür, die etablierten Mächte zu stürzen.
Das nächtliche Treffen in der Wohngemeinschaft in der Claremont Avenue fand kurz vor dem großen SDS-Kongress in Chicago statt, wo die WeathermenWeathermen ihr Papier vorstellen wollten. Die Reaktion der Mitarbeiter des LNS war unterschiedlich, manche waren eher dafür, manche eher dagegen, aber niemand schien ernsthaft darüber nachzudenken, was eine Bewaffnung und ein Abtauchen in den Untergrund mit den entsprechenden Sabotageakten wirklich bedeuten würde.
Ich kratzte meinen ganzen Mut zusammen und meldete mich zu Wort, so oder so ähnlich: »Ich war gerade in San Francisco und habe die Black Panther PartyBlack Panther Party ein bisschen kennengelernt. Die haben sich bewaffnet. Jetzt sind ein halbes Dutzend Mitglieder der Black PanthersBlack Panthers tot oder im Gefängnis – oder auf der Flucht vor dem FBI wie Eldridge CleaverCleaver, Eldridge. Glaubt ihr wirklich, dass das eine gute Idee ist, euch zu bewaffnen und in den Untergrund zu gehen? Meint ihr nicht, dass es euch dann genauso geht wie den Black PanthersBlack Panthers? Ihr werdet von den Bullen erschossen. Oder ihr erschießt jemanden. Und am Ende sitzt ihr, wenn ihr Glück habt, lebenslang im Knast. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, sich zu bewaffnen und in den Untergrund zu gehen.«
Das war irgendwie nicht auf dem Niveau der Diskussion über die anstehende Revolution in den Vereinigten Staaten und dem Rest der Welt und wurde mehr oder weniger schweigend übergangen. Wenige Tage später trafen sich 2000 Mitglieder des SDS im Chicago Coliseum, diskutierten ausgiebig, und dann tauchte die WeathermenWeathermen-Fraktion ab in den Untergrund, mit dabei Mark RuddRudd, Mark.
»Wir gründeten eine Organisation in militärischer Form, mit einer hierarchischen Führung und etwa drei- bis vierhundert Mitgliedern. Wir betrachteten uns als die Keimzelle einer Revolutionsarmee, die sich dem schwarzen Widerstand im Land anschließen würde. Wir sprachen davon, im Bauch des Ungeheuers zu kämpfen.«
Sie hätten wirklich an diese archaische Terminologie geglaubt: »Wir waren Gefangene unserer eigenen Mythologie.« Bei einer Demonstration im Oktober 1969 waren sie von der Polizei zusammengeprügelt und inhaftiert worden. »Wir dachten, das hat keine Zukunft. Wir müssen in diesem Land mit einem Guerillakrieg beginnen.«
Eine der ersten Taten sollte ein Anschlag auf eine Militärbasis in New Jersey sein. Aber die Bombe explodierte vorzeitig, als sie in einem Stadthaus in Manhattan zusammengebaut wurde. Drei ihrer eigenen Leute kamen dabei ums Leben. Danach, so sagte Mark RuddRudd, Mark, habe man sich von Gewalt gegen Personen abgewandt und mehr symbolische Ziele, wie bestimmte Gebäude, angegriffen: »Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Weather-Untergrund und der Rote Armee Fraktion. Wir haben ein Stück um die Ecke geblickt und dann einen Rückzieher gemacht. Die RAFRAF zog sich nicht zurück. Sie machte weiter.«
Auch sie seien Kinder der weißen Mittelklasse gewesen, zornig, aber nicht verrückt: »In diesem Land hat Gewalt als Taktik keine Zukunft. Auch die militante Bewegung der Schwarzen, die mit der Gewalt gespielt hat, machte eine Rückzieher. Sie hatte gesagt: Revolution has come, it’s time to pick up the gun. Die Revolution ist gekommen, jetzt ist es Zeit, zu den Waffen zu greifen. Dann hat die Regierung sie plattgemacht.«
Bei dem ganzen Waffenkult in den USA gehe es am Ende nur um Selbstverteidigung. »Aber die Deutschen sind durch etwas anderes motiviert. Sie arbeiten sich an den Sünden ihrer Väter ab. Sie sahen die Invasion der Amerikaner in VietnamVietnamkrieg, Vietnam – und sie erkannten darin den deutschen Militarismus. Sie sahen den amerikanischen Rassismus und hielten ihn für dasselbe wie den Rassismus der Nazis. Und so sah ich das anfangs auch. Aber musste ich mich für die Sünden meines Vaters opfern? Sie haben das getan, was ihre Väter versäumt hatten.«
Wann er das zum ersten Mal realisiert habe, frage ich Mark RuddRudd, Mark. »In dem Moment, als ich in den Untergrund ging, schon vor der Explosion in dem Stadthaus. Ich hatte eine Krise. Ich konnte die Gruppe nicht mehr führen, aber ich konnte mich auch nicht gegen die Ideen wenden.«
1970 stieg er aus. Unter falschem Namen leistete er über Jahre harte körperliche Arbeit in Brooklyn, nur wenige Meilen entfernt vom Campus der Columbia University. 1977 stellte er sich den Ermittlungsbehörden, die ihm nicht viel nachweisen konnten. Nach weniger als einem Jahr wurde er aus dem Gefängnis entlassen und arbeitete später als Mathematiklehrer in Albuquerque, New Mexico. Er hatte, wie er mir knapp vierzig Jahre später sagte, »in ein tiefes Loch, in einen Abgrund geblickt« – und war gerade noch rechtzeitig zurückgewichen.