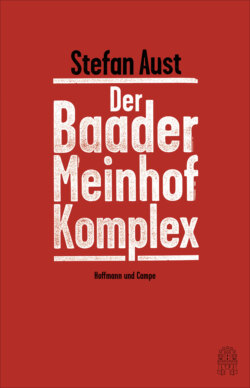Читать книгу Der Baader-Meinhof-Komplex - Stefan Aust - Страница 8
5. Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite
ОглавлениеUlrike Marie Meinhof wurde am 7. Oktober 1934 in Oldenburg geboren. Ihr Vater entstammte einer alten württembergischen Familie, die geprägt war von einer Generationsfolge evangelischer Theologen.
WernerWerner, Hans-Ulrich MeinhofMeinhof, Dr.Werner brach die Schule ab und wurde Kunst- und Bauschlosser. Auf Druck der Familie holte er das Fachabitur nach und studierte in Halle Kunstgeschichte. Er wurde Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP), bekam eine Stelle als Zeichenlehrer in Halle und promovierte in Kunstgeschichte. Im März 1928 wurde er nach vielen vergeblichen Bewerbungen wissenschaftlicher Assistent am Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte in Oldenburg.
Mit 24 hatte WernerWerner, Hans-Ulrich MeinhofMeinhof, Dr.Werner 1925 die sechzehnjährige Ingeborg Guthardt kennengelernt, die ihn am liebsten sofort geheiratet hätte. Die Eltern bestanden darauf, dass ihre Tochter zunächst Abitur machen sollte. 1926 verlobten sich die beiden und heirateten am 28. Dezember 1928 in Halle. Ein Jahr später waren sie gemeinsam in Oldenburg, einer Stadt, in der die Nationalsozialisten schon früh den Ton angaben. Im Juli 1931 bekam Ingeborg MeinhofMeinhof, Ingeborg ihr erstes Kind, ein Mädchen, das auf den Namen Wienke getauft wurde.
WernerWerner, Hans-Ulrich MeinhofMeinhof, Dr.Werner trat am 1. Mai 1933, drei Monate nach HitlerHitler, Adolfs Ernennung zum Reichskanzler, unter der Mitgliedsnummer 285 63 34 der NSDAPNSDAP bei. Am 7. Oktober 1934 wurde eine zweite Tochter geboren, Ulrike Marie Meinhof. Einen Monat zuvor war die Familie einer kleinen christlichen Gemeinschaft, der »Renitenten Kirche ungeänderter Augsburgischer Konfession in Hessen«, beigetreten. Nach späteren Erzählungen in der Familie Meinhof gehörten der Oldenburger Gruppe der »Renitenz« gerade acht Mitglieder an, darunter die Familie Meinhof. Auch mit der nazikritischen Glaubenskraft der Gemeinde scheint es nicht weit her gewesen zu sein. Werner Meinhof, so berichtete später Ulrikes Schwester WienkeMeinhof, Wienke der Autorin Jutta DitfurthDitfurth, Jutta, hätten lediglich »einige Einmischungen des Staates in kirchliche Angelegenheiten« missfallen: »Er wollte, dass sein bewunderter, ja ›genialer Führer‹ Adolf HitlerHitler, Adolf die Deutsche Evangelische Kirche ernst nahm und sie in seinen politischen Kalkulationen ernst nahm.« Im Übrigen sei Werner Meinhof mit den politischen Verhältnissen zufrieden gewesen.
Ende Januar 1936 wurde Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seites Vater Museumsdirektor in Jena. Mitte Mai folgten ihm seine Frau und die beiden Töchter Wienke und Ulrike. Acht Monate lang leitete er dort die NSDAPNSDAP-Kreiskulturstelle. Die Familie lebte in der oberen Etage eines ehemaligen Altersheims mit einem großen Garten am Rande der Innenstadt. Im Frühjahr 1938 wurde das Haus von der Stadt Jena an die Heeresverwaltung verkauft, die Meinhofs zogen um in eine vierstöckige Villa mit Fachwerk, Türmchen und Erkern.
Als Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite knapp fünfeinhalb Jahre alt war, starb ihr Vater an Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Die Mutter erhielt keine staatliche Pension. WernerWerner, Hans-Ulrich MeinhofMeinhof, Dr.Werner war nicht Beamter, sondern nur Angestellter der Stadt gewesen, die jedoch der jungen Witwe anbot, ihr nach der Heirat abgebrochenes Studium weiter zu finanzieren. Das städtische Stipendium war knapp, die Miete wurde zu teuer, die Studentin der Kunstgeschichte Ingeborg MeinhofMeinhof, Ingeborg suchte einen Untermieter.
An der Universität hatte sie eine junge Kommilitonin kennengelernt, eine gutaussehende, intelligente und energische Frau, die Geschichte, Germanistik und Kunstgeschichte studierte: Renate RiemeckRiemeck, Renate.
Die Frauen zogen zusammen und begannen eine Liebesbeziehung.
Ulrike und ihre SchwesterMeinhof, Wienke hatten von nun an zwei Mütter.
Zu Beginn ihrer Freundschaft mit Renate hatte Ingeborg gefragt: »Glauben Sie, dass wir den Krieg gewinnen werden?«
»Nein, ich glaube es nicht.«
»Aber ich glaube es.«
Renate RiemeckRiemeck, Renate schaltete im Radio die BBC-Nachrichten ein: »Ich glaube Ihnen nicht, wenn Sie sagen, Sie hoffen, Deutschland werde den Krieg gewinnen. Aber wenn Sie wollen, können Sie nun zur Gestapo gehen und denen sagen, ich hätte BBC-Nachrichten gehört.«
Ingeborg MeinhofMeinhof, Ingeborg ging nicht zur Gestapo.
So jedenfalls erzählte Renate RiemeckRiemeck, Renate später, und sie betonte, dass sie und ihre Freundin Ingeborg sich, ohne viele Worte zu machen, gegen die Nazis verbündet hätten. Auch Kontakte zu einer Widerstandsgruppe der Optischen Werke Zeiss/Jena habe es gegeben, nicht so, dass es ihnen hätte gefährlich werden können, aber die gemeinsame Ablehnung des Krieges und des Hitler-Regimes habe ihre Freundschaft gefestigt.
In dieses antifaschAntifaschismusistische Bild, das die linkeLinke Professorin Renate RiemeckRiemeck, Renate später zeichnete, passte allerdings nicht, dass sie am 1. Oktober 1941, wenige Tage vor ihrem 21. Geburtstag, unter der Mitgliedsnummer 891 51 51 in die NSDAPNSDAP aufgenommen wurde.
Beide Frauen promovierten und legten das Staatsexamen ab. Als der Krieg zu Ende war, wurde Jena zunächst von den Amerikanern besetzt. Doch entsprechend dem Abkommen von Jalta zogen sich die Amerikaner zurück, und Jena lag nun in der sowjetischen Besatzungszone. Die beiden Frauen und die Kinder luden ein paar Habseligkeiten auf einen Lastwagen und fuhren in Richtung Westen, nach Oldenburg, wo Freunde und Bekannte lebten. In einem Haus mit verwildertem Garten fanden sie eine Wohnung.
Die Stadt war voller Flüchtlinge aus dem Osten, die Schulen überfüllt. Für Ulrike fand sich nur noch ein Platz in der von katholischen Schwestern geführten Liebfrauenschule.
Renate RiemeckRiemeck, Renate und Ingeborg MeinhofMeinhof, Ingeborg legten am neuen Wohnort ihr zweites Staatsexamen ab und wurden Lehrerinnen. Beide waren 1945 der SPDSPD beigetreten.
Im März 1949 starb Ulrikes Mutter nach einer Krebsoperation an einer Infektion. Von nun an war Renate RiemeckRiemeck, Renate die Mutter der beiden Töchter ihrer Freundin.
Später soll Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite einmal gesagt haben: »Als meine Mutter starb, ist für mich die ganze Welt gestorben.«
Renate RiemeckRiemeck, Renate war eine erfolgreiche Pädagogin, die sich auch mit wissenschaftlichen Büchern einen Namen machte. 1951 wurde sie Dozentin an der Pädagogischen Hochschule in Oldenburg, im selben Jahr Professorin in Braunschweig. Ulrike blieb in Oldenburg. »Die Kehrseite der Einsamkeit war relative Freiheit«, schrieb Jutta DitfurthDitfurth, Jutta 2007 in ihrer Meinhof-Biographie, für die sie die Informationen über Ulrikes Jugend im Wesentlichen von Ulrikes Schwester Wienke bekam. Ulrike habe sich damals zwar für Jungen interessiert, »aber da gab es ein Mädchen, Maria, hübsch, klug und warmherzig«. Ulrike habe sich in Maria verliebt. Später habe Ulrike einmal gesagt, sie habe sich mit ein paar Jungs eingelassen, bevor sie Maria begegnet sei.
1952 wurde Renate RiemeckRiemeck, Renate Professorin am Pädagogischen Institut in Weilburg. Ulrike zog mit ihr nach Weilburg und bewunderte ihre Pflegemutter so sehr, dass sie sie zuweilen imitierte. Renate trug Hosen, Ulrike auch. Renate ließ sich die Haare kurz schneiden, Ulrike ebenfalls. Ulrike versuchte sogar, die Handschrift ihrer Pflegemutter nachzuahmen. Später sagte sie einmal über Renate Riemeck, sie sei »der Prototyp der sadistischen Heimleiterin« gewesen.
Sie lernte viel von der nur vierzehn Jahre älteren Professorin, die sie mit der Geschichte und Literatur des 19. Jahrhunderts bekannt machte. In der Schule, dem Philippinum in Weilburg, war Ulrike außerordentlich beliebt und galt als ein ungewöhnliches Mädchen, das durch Charme und Intelligenz beeindruckte. Sie las Klassiker und moderne Schriftsteller, legte ihr knappes Taschengeld in Büchern an und fühlte sich, nach den Jahren auf der Oldenburger Schwesternschule, zum Katholizismus hingezogen.Meinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite 73
Doch das ernste Mädchen hatte auch Vorlieben, die damals recht ungewöhnlich waren. Sie rauchte Pfeife und selbstgedrehte Zigaretten, und manchmal tanzte sie bis zur Erschöpfung Boogie-Woogie. Und sie widersprach in der Schule, wenn sie etwas als ungerecht empfand. Einem Lehrer, der Wissen und Autorität durch Brüllen ersetzte und sie einmal anschrie, antwortete sie: »Herr Studienrat, es ist nicht üblich, mit einer Schülerin der Oberstufe so laut zu sprechen!« Der Studienrat lief rot an und schrie weiter. Da packte sie ihre Sachen, stand auf, sagte »dann gehe ich jetzt« und verließ den Unterricht. Konferenzen wurden abgehalten. Ulrike sollte von der Schule fliegen. Renate RiemeckRiemeck, Renate schaltete sich ein. Ulrike durfte bleiben.
Sie arbeitete in der Schülermitverwaltung, wurde Mitglied der Europabewegung, war Mitherausgeberin einer Schülerzeitung. Als engagierte junge Christin schrieb sie 1955 in ihrer Abiturarbeit: »Die Begegnung mit dem Katholizismus war eine große Bereicherung für mich. Wir evangelischen Schülerinnen stießen dort auf echte Toleranz in dem gemeinsamen Bewusstsein der eigentlichen Wahrheit des Christentums …« Während der ersten Semester ihres Studiums setzte sie sich in einer aus der evangelischen Jugendarbeit hervorgegangenen Erneuerungsbewegung für die Aufnahme katholischer Elemente in die protestantische Liturgie ein.
Unmittelbar nach dem Abitur verließ sie Weilburg und Renate RiemeckRiemeck, Renate, bezog in Marburg ein winziges möbliertes Zimmer und begann ein Studium der Pädagogik und Psychologie. Als Waise und Begabte hatte sie gute Aussichten auf ein Stipendium der »Studienstiftung des deutschen Volkes«.Studienstiftung des Deutschen Volkes In der Mensa der Universität betete sie vor dem Essen. Sie war zwanzig Jahre alt.
Ulrike Meinhofs Marburger Vertrauensdozent hatte am Ende des Sommersemesters »aufs dringlichste« empfohlen, sie endgültig in die StudienstiftungStudienstiftung aufzunehmen. Lobend hob er hervor, dass sie »in einer betont religiösen christlichen Einstellung« geprägt sei, die ihr zu einer »großen inneren Freiheit« verhelfe. Genau darin allerdings sah die Pädagogik-Professorin Elisabeth BlochmannBlochmann, Elisabeth eine gewisse Gefahr, neige Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite doch dazu, »Probleme theologisch zu radikalisieren«.
In diesem Jahr 1955, als die SPDSPD für die allgemeine Wehrpflicht stimmte und den jahrelangen KampfAntiatombewegung 1958 / 59 gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik aufgab, verließ Renate RiemeckRiemeck, Renate ihre Partei. Aufrüstung war für sie ein verhängnisvoller Schritt in der Eskalation des Kalten Krieges. Als Verfechterin einer Aussöhnung mit Polen durch die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie, als Gegnerin von AdenauerAdenauer, Konrads Plänen zur atomaren Bewaffnung der Bundeswehr wurde sie heftig befehdet – und bekannt. Ende der fünfziger Jahre geriet sie deswegen in Konflikt mit ihrem Arbeitgeber, dem Land Nordrhein-Westfalen. 1960, als sie in das Direktorium der DFU (Deutsche Friedensunion) gewählt wurde, gab Renate Riemeck ihre Professur auf.
Zum Wintersemester 1957 zog Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite von Marburg nach Münster. Wie in anderen Universitätsstädten hatte sich auch dort um den Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS)Sozialistischer Deutscher Studentenbund SDS, die Studentenorganisation der SPD, ein »Anti-Atomtod-Ausschuss« gebildet. Ulrike Meinhof wurde zu dessen Sprecherin gewählt.
1957 war ein Jahr dramatischer politischer Entwicklungen in der Bundesrepublik. Am 12. April wurde die »Göttinger Erklärung«Göttinger Erklärung veröffentlicht. Achtzehn westdeutsche Atomwissenschaftler und Nobelpreisträger wandten sich gegen jede atomare Bewaffnung der Bundeswehr: »Für ein kleines Land wie die Bundesrepublik glauben wir, dass es sich heute noch am besten schützt und den Weltfrieden noch am ehesten fördert, wenn es ausdrücklich und freiwillig auf den Besitz von Atomwaffen verzichtet. Ebenfalls wäre keiner der Unterzeichner bereit, sich an der Herstellung, der Erprobung oder dem Einsatz von Atomwaffen in irgendeiner Weise zu beteiligen …«
Zu Ostern verlas Albert SchweitzerSchweitzer, Albert über Radio Oslo einen »Appell zur Einstellung der Kernwaffenversuche«.
Die Aufrufe fanden die Zustimmung zahlreicher Gewerkschafter.
Im Juli folgte ein Aufruf von Professoren, Künstlern, Lehrern und Schriftstellern. Ehemalige Mitglieder der »Bekennenden Kirche« schlossen sich den ProtestProtestbewegungen an.
Im Mai 1958 trat Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite dem SDSSozialistischer Deutscher Studentenbund SDS bei.
Sie veröffentlichte Artikel zur Atomfrage in zahlreichen studentischen Zeitungen, organisierte Veranstaltungen, Unterschriftensammlungen und einen Vorlesungsboykott mit, bereitete Kundgebungen gegen die AtombewaffnungAtomwaffen vor. In elf Universitätsstädten wurden Ende Mai 1958 Protestaktionen gegen die atomare Bewaffnung organisiert. Im tiefschwarzen Münster zogen 5000 Studenten in einem Schweigemarsch durch die Stadt. Zum Abschluss dieser Demonstration ordentlich gekleideter Studenten in Schlips und Kragen und Studentinnen in Röcken erlebten die Demonstranten eine für damalige Zeiten kleine Sensation. Nach einem Pfarrer, einem Gewerkschafter und einem Professor betrat eine knapp über zwanzig Jahre alte Studentin das Podium und hielt eine Rede. Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite hatte die politische Arena betreten.
Die Nachricht von der selbstbewussten jungen Friedensaktivistin mit der Sophie-Scholl-Frisur erreichte auch die Redaktion der linken Studentenzeitschrift »konkret«konkret in Hamburg, die sich ebenfalls in der Anti-Atom-BewegungAntiatombewegung 1958 / 59 engagierte.