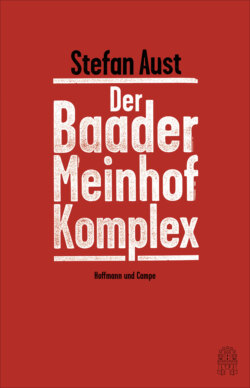Читать книгу Der Baader-Meinhof-Komplex - Stefan Aust - Страница 20
17. Der Agent
ОглавлениеIrgendwann Anfang der sechziger Jahre hatte sich ein junger Mann, von Beruf Klempner und Rohrleger, bei der DDR-eigenen Deutschen Reichsbahn beworben, die in Westberlin die S-Bahn betrieb. Sein Name war Peter UrbachUrbach, Peter.
Die meisten Reichsbahner im Westen waren Mitglied des Westberliner Ablegers der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins (SEW). Wer neu zur S-Bahn kam, musste sich auch um das rote Parteibuch bemühen.
Der Handwerker Peter UrbachUrbach, Peter wurde bei der S-Bahn und in die Partei der Arbeiterklasse aufgenommen. Wie alle anderen Kollegen und Genossen abonnierte er das Zentralorgan der Partei, »Die Wahrheit«. Das Blatt warb auf den S-Bahnsteigen und in den Zugabteilen mit der Losung »Schaff dir Klarheit, lies die Wahrheit!«. Doch Peter Urbach wollte noch anderen Klarheit verschaffen und ging ein weiteres Arbeitsverhältnis ein. Er berichtete regelmäßig dem Berliner Landesamt für VerfassungsschutzVerfassungsschutz, was er über die Westberliner Kommunisten in Erfahrung bringen konnte.
Peter UrbachUrbach, Peter war Agent. Foto: Urbach mit Baader bei Löbe-Demo
Er lebte unauffällig mit Frau und zwei Kindern in einer kleinbürgerlichen Mietwohnung. Mitte der sechziger Jahre kommandierte ihn sein Amt in die StudentenbewegungStudentenbewegung ab. Handwerkliche Fähigkeiten wurden überall gebraucht, im neugegründeten »Republikanischen Club«, in den renovierungsbedürftigen Wohnungen der Studenten und vor allem bei der »Kommune I«Kommune I am Stuttgarter Platz. Peter UrbachUrbach, Peter war hilfsbereit und immer zur Stelle. Er reparierte sanitäre Anlagen und defekte Elektrogeräte, besorgte geklautes Baumaterial »zum Selbstkostenpreis«, bastelte und baute in vielen Wohnungen.
Nach seinen Erzählungen hatten Diebstahl und andere »schräge Dinger« zur Kündigung bei der S-Bahn und zum Ausschluss aus der SEW geführt.
Das kam an bei den antiautoritären Studenten, denn von der SEW wollte man damals noch weniger wissen als von den etablierten Rathausparteien. In einem Arbeitsgerichtsprozess gegen die S-Bahn wurde UrbachUrbach, Peter vom Anwalt Horst MahlerMahler, Horst vertreten. Von 1967 an arbeitete er ganztägig für das Landesamt für VerfassungsschutzVerfassungsschutz: ständig auf Achse beim Ausspähen studentischer Selbstfindung und Selbstverwirklichung in der politischen Aktion.
Das Rüstzeug dafür hatte er stets bei sich: Haschisch und harte DrogenDrogen, Knallkörper und Rohrbomben, Schreckschusspistolen und großkalibrige Waffen. Er belieferte die Drogenszene, besorgte Materialien für die Aktionen der »Kommune I«Kommune I und später für die entstehende Stadtguerilla.
Besonders enge und freundschaftliche Beziehungen verbanden UrbachUrbach, Peter mit der »Kommune I«, mit Rainer LanghansLanghans, Rainer, Fritz TeufelTeufel, Fritz und Dieter KunzelmannKunzelmann, Dieter. Er war auch dabei, als die Kommunarden das »Puddingattentat« vorbereiteten. Prompt flog der Plan auf.
Im Sommer 1967 bastelte UrbachUrbach, Peter einen Pappsarg, der anlässlich der Beerdigung des ehemaligen Reichstagspräsidenten Paul LöbeLöbe, Paul von buntgewandeten Studenten provokativ unter die Trauergäste getragen wurde. Schulter an Schulter mit dem Verfassungsschutzagenten schleppte damals Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt den Sarg, in dem kostümiert Dieter KunzelmannKunzelmann, Dieter lag.
In dieser Zeit lernte auch der spätere Bombenleger Michael »Bommi« BaumannBaumann, Michael Bommi im Umfeld der »Kommune I«Kommune I und der APOAPO Außerparlamentarische Opposition-Kneipe »Zum Schotten« Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt und Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt kennen. Baader, so erinnerte sich Bommi, hatte immer einen »unheimlichen Vortrag drauf«. Er monologisierte stundenlang über seine vergangenen und seine zukünftigen Abenteuer, die alle irgendetwas mit »Terror machen« zu tun hatten. Spätabends kam es auch schon mal vor, dass Baader einem Betrunkenen auf die Toilette nachging und dessen Brieftasche »teichte«. Seine weitere Spezialität war AutodiebstahlAutodiebstahl. Die Studenten aus der APOAPO Außerparlamentarische Opposition-Szene fanden das zumeist gar nicht so übel, endlich einmal erwies sich einer als Tatmensch.Baumann, Michael Bommi
Schon als Baader in der Berliner Szene auftauchte, hieß es überall: »Das ist ein ganz Verrückter, der redet nur von Terrorismus.« Andere, die später im »Blues« durch Brandanschläge von sich reden machten, waren noch auf dem DrogenDrogentrip. »Baader dagegen war so ein Marlon-Brando-Typ«, beschrieb ihn Bommi BaumannBaumann, Michael Bommi. In den Kneipen provozierte er gern irgendwelche Leute, ließ es auch auf Schlägereien ankommen, aber die meisten Studenten kniffen, bevor es richtig ernst wurde. Das verlieh Baader eine gewisse Autorität.
Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt stilisierte sich gern nach Vorbildern aus dem Kino und der Literatur. Eines seiner Lieblingsbücher damals war Thomas WolfeWolfe, Thomass »Es führt kein Weg zurück«. Darin heißt es über einen Helden des Romans: »Vielleicht hatte Rumford Bland im Finstern nach dem Leben gesucht, nicht weil etwas Böses in ihm war (obwohl er bestimmt Böses in sich hatte), sondern des Guten wegen, das in ihm noch nicht erstorben war. Irgendetwas in diesem Menschen hatte sich immer gegen die Langeweile des Provinzlebens aufgelehnt, gegen Vorurteil und Misstrauen, gegen Selbstgefälligkeit, Sterilität und Freudlosigkeit. Er hatte in der Nacht etwas Besseres zu finden gehofft: Wärme und Kameradschaft, ein dunkles Geheimnis, die prickelnde Erregung des Abenteuers, die Sensation, gejagt, verfolgt und vielleicht auch gefangen zu werden, die Erfüllung seiner Begierde.«
Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt war in Berlin und in seiner Phantasie in vielen Welten zu Hause. Er hatte jedoch, im Gegensatz zu den politisch vielleicht gebildeteren, aber, was Menschenkenntnis angeht, recht unbedarften Studenten, ein ausgeprägtes Gefühl für die Schwächen und Sentimentalitäten anderer. Mit seinem brutalen Charme verstand er es, Menschen gleichzeitig anzuziehen und einzuschüchtern und so Abhängigkeiten herzustellen.
Im Februar 1968 kam es zum endgültigen Bruch Gudruns mit BernwardVesper, Bernward. MutterEnsslin, Ilse Ensslin schrieb einen bekümmerten Brief, in dem sie Gudrun beschwor, nicht auch noch zum Problemfall in der Familie zu werden. Zwei ihrer Geschwister hatten eine psychiatrische Krankengeschichte hinter sich.Kaufhausbrandstiftung Im März wandte sich Ilse EnsslinEnsslin, Ilse an Vesper, er solle mithelfen, dass etwas »Aufbauendes geschieht«, Gudrun habe »schwere innere Verletzungen, seelisch und körperlich, erlitten, die eines langsamen Heilungsprozesses bedürfen«. VesperVesper, Bernward antwortete, er hänge noch sehr an Gudrun, sie habe aber zu Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt eine »ähnliche Abhängigkeit« entwickelt, die »Gudrun wieder nicht gestattet, zu sich selbst zu kommen«. Er sehe in der »augenblicklich herrschenden Nervosität bei ihr die latente Gefahr psychischer Störungen« und kommt zu dem Schluss: »Es ist das Ungeregelte und Zwangslose an Andreas’ Leben, das sie anzieht, aber ich weiß nicht, wie weit sie … auf die Dauer dem gewachsen ist.«