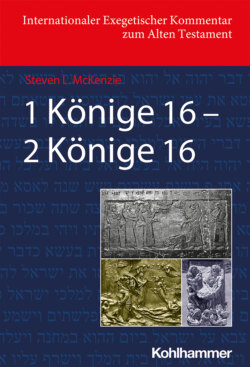Читать книгу 1 Könige 16 - 2 Könige 16 - Steve McKenzie - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Diachrone Analyse
ОглавлениеDer Bericht von Baschas Herrschaft geht überwiegend auf DtrH zurück. Mögliche Quellen Die der kombinierten Königsliste entnommenen Informationen laufen auf 15,33 zu: auf den Namen und das Patronym Baschas, auf den Synchronismus mit Asa von Juda, darauf, dass er Tirza zur Hauptstadt wählte sowie auf die Dauer seiner Herrschaft. Die Angaben über Baschas Tod und Bestattung in Tirza und der Name seines Sohnes und Nachfolgers Ela in 16,6 könnten auch aus anderen Quellen stammen, auch wenn diese Daten aus der Königsliste ersichtlich sind, weil sich der Ausdruck „sich zu seinen Vorfahren legen“ auf eine dynastische Nachfolge bezieht.17 Vielleicht liegt 16,4 und dessen Parallelen in Gestalt der anderen Prophetensprüche gegen die Herrscherhäuser des Nordens ein Vertragsfluch über die Nicht-Bestattung zugrunde, doch die Quelle lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Der Name Jehu ben Hanani könnte aus einer älteren Tradition bekannt sein, aber es wäre auch möglich, dass DtrH den Namen des Propheten einfach aufgrund seiner Bedeutung „Jhwh ist er“ (= Jhwh ist Gott) gewählt hat. Es gibt für 16,1–4 keine Hinweise auf eine ältere Geschichte oder einen älteren Prophetenspruch aus der Zeit vor DtrH; da es in der Bibel keine unabhängigen Hinweise auf diesen Jehu gibt, empfiehlt sich eine gewisse Skepsis gegenüber einer Ableitung des Namens aus dem Quellenmaterial.18 Folglich hat es – anders als in 1 Könige 14, wo DtrH eine ältere Geschichte über die Befragung des Propheten Ahija über Jerobeams kranken Sohn als Rahmen für den anti-dynastischen Prophetenspruch verwendet hat – offensichtlich keine Geschichte dieser Art über Bascha gegeben, so dass DtrH selbst eine Version des anti-dynastischen Prophetenspruches geschaffen hat.
Die Grundlage der Anklage an dieser Stelle und bei den anderen anti-dynastischen Prophetensprüchen besteht in dem, was Jhwh für den Beschuldigten getan hat, indem er ihn aus der Unbekanntheit herausführte und zum König Israels machte. Die Anklagen unterscheiden sich etwas, weil die Umstände bei jedem König etwas anders liegen. Entsprechend muss in der Anklage gegen Bascha nicht erwähnt werden, dass David das Königtum entrissen wurde, wie das bei Jerobeam der Fall war (14,8). Ebensowenig ist der Vergleich mit David bei Bascha so wichtig, wie er bei Jerobeam ist. Es reicht der Hinweis, dass Bascha in die Fußstapfen Jerobeams trat. Jhwh wird folglich als Lenker von Aufstieg und Fall der israelitischen Herrscher angesehen (ich habe dich zum ausersehenen König gemacht, ואתנך נגיד). Das ist ein Grundprinzip der Königebücher und des DtrH.
Kultzentralisation Jhwhs Handeln zugunsten dieser Könige bringt es mit sich, dass die Könige sich entsprechend der in der deuteronomischen Tora niedergelegten Maßstäbe zu verhalten haben. Die Auferlegung dieser Maßstäbe ist anachronistisch, weil zur Zeit Jerobeams oder Baschas weder das Deuteronomium noch das Prinzip der Kultzentralisation existiert haben, denn sie sind nicht vor dem späten siebten Jahrhundert entstanden. Es überrascht daher kaum, dass beide übertreten werden. Dies geschieht in ätiologischer Absicht, also um Israels Untergang und Judas Fortbestand zu erklären. Historisch gesehen waren die Heiligtümer in Dan und Bet-El Einrichtungen des israelitischen Königskultes und der Verehrung des Nationalgottes Jhwh gewidmet. Die Behauptung, dass sie illegitim waren, weil Jhwh nur in Jerusalem verehrt werden konnte, verrät die im Südreich liegenden Wurzeln des DtrH. Sie waren auch nicht götzendienerisch. DtrH nennt sie „Nichtigkeiten, nutzlose Dinge“ (הבלים). Doch dies ist eine verzerrte Darstellung. Die Kälber waren keine Darstellungen Jhwhs, sondern Teile eines Sockels, auf dem Jhwh stehend oder sitzend vorgestellt wurde, auch wenn zwischen beidem nicht immer klar unterschieden worden ist.19 Insofern ist es paradox, dass DtrH gegen die israelitischen Könige aufgrund des weiteren Betriebs dieser Heiligtümer die Anschuldigung erhebt, Jhwh zu verehren. DtrH sieht die Treue gegenüber diesen Heiligtümern aufseiten der israelitischen Könige als Provokation an (√כעס), was ein für DtrH charakteristischer Ausdruck ist (14,9; 15,30; 16,13; 21,22). DtrH verknüpft diese Kultpraxis mit der durch Morde und Umstürze bedingten Aufeinanderfolge von Königshäusern in Israel, die der einen davidischen Dynastie in Juda gegenübergestellt werden; dies wird als theologische Erklärung für den späteren Untergang des Königtums verwendet. Israels Schicksal war insgesamt von Anfang an besiegelt. Je stärker seine Könige versuchten, Jhwh durch Kulthandlungen an den königlichen Heiligtümern zu beschwichtigen, umso stärker erregten sie Jhwhs Zorn, der in Form von Vertreibung und Exil zum Ausdruck kam.20
Zur üblichen Ankündigung, dass Jhwh jedes „männliche Mitglied des Königshauses“(משתין בקיר) ausrottet (z. B. 14,10a), besitzt der Prophetenspruch gegen Bascha keine Entsprechung.21 Doch im Vergleich zu den anderen Prophetensprüchen ist klar, dass vor allem die Jungen und Männer aus Baschas Familie bedroht sind, und zwar insbesondere die in direkter Linie. Es war bei einem Staatsstreich üblich, die männlichen Nachkommen zu töten, die sonst hätten Vergeltung üben oder die gestürzte Dynastie wieder zum Leben erwecken können.
Der Fluch der Nicht-Bestattung Es ist nicht nur so, dass Baschas Nachkommen ermordet werden, sondern ihre Leichen werden auch noch als Nahrung für Tiere liegengelassen, die sich von Abfall ernähren. Hunde waren im alten Israel keine Haustiere, sondern wild lebende Tiere, die in der Nähe der Menschen überlebten, indem sie deren Abfälle nach Fressbarem durchwühlten.22 Das hat auch Auswirkungen auf das Leben nach dem Tode, wie es in Israel vorgestellt wurde. Ohne Nachkommen, die sich an jemanden erinnern oder ihn durch Grabbeigaben unterstützen, würde ein nicht bestatteter Mensch in der Unterwelt zugrunde gehen – und mit ihm seine Vorfahren.
16,5–6 Der Bericht über Baschas Regierungszeit endet mit den üblichen Teilen des DtrH-Rahmenformulars (Vv. 5–6). Dazu gehört auch der Verweis auf eine Quelle, die einige der Informationen des Berichts geliefert hat und die sich vielleicht für weitere Einzelheiten hinzuziehen ließe. Die Wendung ספר דברי הימים bedeutet „die Rolle des Tagesgeschäfts“. Darunter ist wahrscheinlich die von DtrH benutzte kombinierte Königsliste zu verstehen, die auch manche Informationen aus Inschriften und dergleichen enthalten haben könnte.23 Es spricht nichts gegen die Annahme, dass DtrH auf korrekte historische Informationen zurückgreifen konnte, wenn auch meist in sekundärer Form. Zugleich haben die Quellenzitate eine rhetorische Funktion – sie legitimieren die Aussagen des Berichts –, und aus diesem Grund werden sie DtrH zugeschrieben.
Das Problem mit 16,7 In diachroner Sicht liegt Hauptproblem des Textabschnitts in V. 16,7.24 Meist wird der textkritische Befund ignoriert, der ziemlich deutlich dafür spricht, dass der Text sekundär ist: Er ist in der OG und im MT an verschiedenen Stellen zu finden, und in beiden Fällen wirkt er störend – in der OG unterbricht er die Thronbesteigungsformel für Ela, und im MT steht er zwischen der Abschlussformel für Bascha und der Einleitungsformel für Ela und befindet sich insofern „in der Lücke“ zwischen dem Rahmenformular, das die separaten Berichte über zwei verschiedene Könige markiert. Der Vers stellt faktisch eine Dublette zu Vv. 1–4 dar, insofern hier eine Anklage gegen Bascha wiederholt wird. Dass Jehu hierbei als Prophet identifiziert wird, resultiert aus der Wortereignisformel in V. 1 und dem Tenor der Botschaft Jehus in Vv. 1–4. Die Verwendung des Verbs כעס (Hifil) muss nicht unbedingt auf DtrH als Verfasser hinweisen, sondern könnte auch nachahmend sein. Deshalb ist es nicht wahrscheinlich, dass der Vers eine ältere oder unabhängige Version des Prophetenspruchs darstellt.25 Seine Sprache und Wortwahl weisen auf eine andere, weniger geschickte Hand hin als die, auf die Vv. 1–4 zurückgehen. Den Anfang bildet dabei וגם, das typisch für Hinzufügungen ist. Die Ausdrucksweise des MT ist ungeschickt, wenn es heißt, dass Jehu zu (אל) Bascha und seinem Haus gesprochen hat, was unmöglich ist. In der OG tritt der ungeschickte Ton zutage, wenn על dreimal kurz hintereinander in zwei unterschiedlichen Bedeutungen verwendet wird („gegen Bascha und gegen sein Haus wegen all des Bösen“).26 Die ungeschickte Sprache geht auf den von V. 3 beeinflussten Verfasser von V. 7 zurück; auf sein Konto geht auch, dass das Prophetenwort Jehus sich auch an Baschas Haus richtet.
Vers 7 wurde in mehreren Phasen hinzugefügt. Der Grund für die erste Hinzufügung von V. 7a könnte darin gelegen haben, dass die Verse 1–4 erläutert werden sollten. Die Wendung Werk seiner Hände wird in V. 7 zusammen mit dem Verb כעס für Götzenverehrung verwendet, statt wie in V. 2 neben „Vergeblichkeit“ (Dtn 31,29; 2 Kön 22,17; Jer 25,6–7; 32,30; vgl. 2 Kön 19,18; 2 Chr 32,19; Ps 115,4; 135,15; Jes 2,8; 37,19; Jer 10,9; Hos 14,4; Mi 5,12). Wie in der synchronen Analyse vorgeschlagen wurde, könnte es sich in V. 7 um die Erweiterung der Anklage gegen Bascha handeln, damit auch all das Böse, das er getan hatte dazugehörte sowie der Hinweis, dass Baschas Haus wie Jerobeams werden würde. Um wie Jerobeams Haus zu werden ist mehrdeutig. Bezieht es sich auf die Sünde, dass Bascha also Jhwh erzürnte und insofern Jerobeam ähnelte? Oder geht es um die Zerstörung seines Hauses wegen dieses Erzürnens? Die anderen Prophetensprüche gegen die Nordreichs-Dynastien, in denen angekündigt wird, dass Jhwh ein bestimmtes Herrscherhaus wie das Haus Jerobeams machen wird, lassen an Letzteres denken.
In der letzten Wendung des Verses (und weil er es zerstört hat) könnte sich das Objektpronomen אתו auf Jerobeam („ihn“) oder sein Haus („es“) beziehen. Wenn Jerobeam gemeint wäre, würde er als Personifikation seines Hauses betrachtet, so dass die Bedeutung im Grunde genommen gleich wäre. In jedem Fall steht dieser Satz in Spannung zu Vv. 1–4: Warum sollte Bascha dafür verdammt werden, dass er Jerobeams Haus schlägt, wenn er nur die Drohung Jhwhs in die Tat umsetzt (14,7–11)? Aufgrund dieser Spannung wurde vorgeschlagen, ועל als adversativ oder konzessiv zu verstehen und nicht als kausativ: „obwohl/trotz der Tatsache, dass er es zerschlagen hat“.27 Seebass spricht sich zu Recht gegen diese Interpretation aus, weil dann zwei identische Konstruktionen unterschiedlich gedeutet würden: „wegen all des Bösen, das er getan hat … obwohl er es zerschlagen hat“.28 Doch wenn die vorangegangene Wendung – darüber, wie Jerobeams Haus zu werden – sich nicht auf Baschas Sünde bezieht, sondern auf den Untergang seines Hauses, kann ועל nicht konzessiv gemeint sein, sondern wäre vielmehr eine Glosse oder ein Nachtrag zum Nachtrag, wie Noth es ausgedrückt hat.29