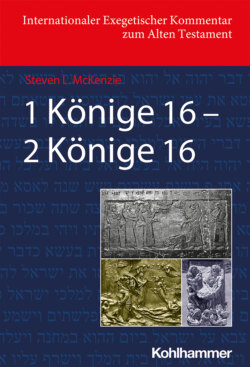Читать книгу 1 Könige 16 - 2 Könige 16 - Steve McKenzie - Страница 42
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Anmerkungen zu Text und Übersetzung
Оглавление29 Ahab, der Sohn Omris, wurde König im achtunddreißigsten Jahr Asas, des Königs von Juda: So MT. GBL: Im zweiten Jahr Joschafats [L: des Königs von Juda] wurde Ahab, der Sohn Omris [B: Simris] König. Die ursprüngliche Vokalisierung des Namens Ahab war Ahiab, wie es sich in den Schreibweisen Αχιαβ (Jer 36[29],21) und Αχιαβος (Josephus Ant XV, 250) erhalten hat.1 Dies ist ein theophorer Name mit der Bedeutung „der Vater (Gott) ist mein Bruder“.
regierte: wörtlich: und er regierte. So GL. In GB fehlt und vor dem Verb. MT + Ahab, der Sohn Omris.
30 Ahab: So GBL. MT + der Sohn Omris.
er tat mehr Böses: So GBL wie in 16,25. In MT fehlt das Verb וירע (er tat Böses).
31 Es reichte ihm nicht: Gelesen wird ויהי הנקל לו, basierend auf GBL (καὶ οὐκ ἦν αὐτῷ ἱκανὸν). הנקל ist als hannāqēl konstruiert, mit dem bestimmten Artikel plus Partizip Nifal, und bedeutet „das Kleinste, unbedeutend, ungenügend“. Das ist eine häufiger vorkommende Umpunktierung.2 Die Lesart des MT – Fragepartikel plus Nifal Perfekt (hănāqēl) als rhetorische Frage – „War sein Wandel auf dem Weg Jerobeams etwas Unbedeutendes?“ – ist möglich und wird von vielen Kommentatoren vor allem deshalb übernommen, weil sie auch in Ez 8,17 vorkommt.3 Man könnte sie sogar als lectio difficilior betrachten. Doch die Bedeutung der OG und der Kontext, der im Unterschied zu Ez 8,17 keine direkte Anrede enthält, sprechen für die Emendation. Im MT ist לו durch Haplographie weggefallen.
den Sünden Jerobeams: In der Weltsicht des DtrH ist es die Sünde Jerobeams, die Israel quält und die der Grund für seinen späteren Untergang ist.4 An dieser Stelle allerdings sind sich die Textzeugen einig, dass der Plural zu lesen ist, und Vv. 31–33 ahmen die Interpolation nach (siehe die diachrone Analyse).
Isebel: Die ursprüngliche Form des Namens lautete’î-zĕbûl, was mit Bezug auf Baal „wo ist (der) Fürst?“5 bedeutet; dies ist im ugaritischen Baal-Zyklus (KTU 1.6.4.16) belegt. Dem entspricht der Name Ikabod („wo ist [die] Herrlichkeit?“) in 1 Sam 4,21. Die Vokalisierung wurde zur Verunglimpfung des Gottes Baal und des Charakters Isebels in die des hebräischen Wortes zebel „Mist“ geändert; das entspricht auch Isebels Ende in 2 Könige 9.6
Etbaal: Josephus verweist mit Bezug auf Menander von Ephesus auf Itobal (Ίθόβαλος), einen Astarte-Priester, der im neunten Jahrhundert den Thron von Tyrus an sich riss (Contra Apionem I, 123). Später buchstabiert er den gleichen Namen Ίθωβαλος (I, 156). Das deutet darauf hin, dass die ursprüngliche Form des Namens ’Ittoba‛l war, wie der Ahiram-Sarkophag aus dem zehnten Jahrhundert belegt.7 Dieser Name bedeutet „Baal ist mit ihm“ und entspricht dem hebräischen Namen ‛Immānû’ēl, „Gott ist mit uns/ihm“ (Jes 7,14). Die jüngere Tabnit-Inschrift (fünftes Jahrhundert) bezieht sich ganz ähnlich auf Tabnit und Eschmunezer als Könige von Sidon und Astarte-Priester.8 Etbaals Ansehen als Priester könnte erklären, warum Isebel der heimatlichen Gottheit weiter verbunden war, auch wenn sich der ihr im biblischen Bericht zugeschriebene Missionseifer durchaus in Zweifel ziehen ließe.
fuhr dann fort, Baal zu dienen: Das Verb hālak wird hier im Sinne von „fortfahren“ verwendet und bedeutet nicht, dass Ahab nach Tyrus gereist wäre, um Baal zu verehren.9 Als die Gottheit, auf die hier verwiesen wird, gilt meist Melqart, der Hauptgott von Tyrus, obwohl Baal-Schamem in Anknüpfung an 1 Könige 18,10 vielleicht die bessere Möglichkeit sein könnte.
ihn zu verehren: Wörtlich: „sich vor ihm niederwerfen“, was eine kausativ-reflexive Form (-št-Infix) von חוה ist. Siehe Joüon §79t.
32 im Tempel seiner Vergehen: So GBL: ἐν οἴκῳ τῶν προσοχθισμάτων αὐτοῦ = בית שקוציו. MT: בית הבעל. Timm ist der Ansicht, dass der ursprüngliche Text, der der Lesart GBL zugrunde lag, בית אלהים lautete,11 und Niehr hält in seiner Rekonstruktion der Religionsgeschichte Israels und Judas fest, dass Ahab einen Altar für Baal im Tempel für Jhwh in Samaria errichtet hat.12 Das Argument für die Emendation besteht aus zwei Teilen: (1) Der MT, demzufolge Ahab einen Altar für Baal im Tempel für Baal errichtet hat, den er in Samaria erbaut hat, ist tautologisch und ergibt keinen Sinn, da ein Tempel per definitionem einen Altar für den Gott beherbergt, dem er gewidmet ist; einleuchtend wäre nur, wenn die Errichtung eines Altars oder Kultobjekts erwähnt würde, wenn dies einer anderen Gottheit gewidmet wäre als der, in dessen Tempel sie steht; (2) das griechische Wort προσόχθισμα („Vergehen, Provokation“) wird an anderer Stelle, und zwar vor allem in 1 Kön 11,33, zur Übersetzung von אלהים verwendet, was im hier betrachteten Vers später – beeinflusst durch dessen zwei frühere Erwähnungen – durch הבעל ersetzt wurde. Emerton verteidigt demgegenüber den MT.13 Er weist darauf hin, dass die Wendung בית יהוה, die Entsprechung der vorgeschlagenen Lesart בית אלהים, in den Königebüchern nur in Bezug auf den Tempel in Jerusalem verwendet wird, jedoch an keiner Stelle für einen Tempel im Nordreich. Da zudem das Griechische ein Suffix überliefert, könnte אלהיו eher „seine Götter“ als „seinen Gott“ (also Jhwh) bedeuten, vor allem, wenn es um Ahab geht. Emerton bemerkt weiter, dass προσοχθισμάτων zwar in 16,32 eine Übersetzung von אלהים sein könnte, es aber keine durchgängige Übereinstimmung zwischen den beiden Worten gibt; ebenso gut könnte es die Übersetzung von הבעל sein, obwohl Letzteres meist mit ὁ Βααλ wiedergegeben wird. Während sowohl Timm als auch Emerton festhalten, dass προσόχθισμα manchmal für שקוץ (1 Kön 11,5–7; 2 Kön 23,13.24) verwendet wird, zieht weder der eine noch der andere die Möglichkeit in Betracht, dass שקוציו in 16,32 die ältere Lesart darstellen könnte, obwohl Emerton an zwei Stellen erklärt, dass es in der Diskussion um den vorliegenden Text gehen muss. Die Lesart שקוציו beseitigt die Tautologie des MT, die Emerton herunterspielt,14 und würde die Verwendung von προσοχθισμάτων durch G erklären. Möglicherweise – so deutet es Emerton an – könnte שקוציו aufgrund seines pejorativen Charakters eher הבעל ersetzt haben als umgekehrt. Bleibt man dagegen eng am Text, könnte die zweimalige Verwendung des Baalsnamens in Vv. 31–32 wie auch die Erwähnung des Baals-Tempels in 2 Kön 10,21–27 dazu geführt haben, dass der Name auch an dieser Stelle hineingesetzt wurde. Es lässt sich kein Umstand ersehen, der dazu geführt haben könnte, dass hier der Name durch שקוציו ersetzt wurde.
33 die Aschera: Eine Aschera war ein Kultobjekt in Form eines aufrecht stehenden Baumes oder Pfahles, das die Göttin Aschera darstellte, die als Jhwhs Gemahlin galt.15 Die Inschriften von Kuntillet ‛Ajrud und Chirbet el-Qom haben deutlich gemacht, dass Ascherot vor der DtrH-Polemik gegen sie sowohl in Israel als auch in Juda als legitime Weise der Verehrung Jhwhs galten. Deshalb stand die Aschera, von der hier die Rede ist, im Tempel Jhwhs und nicht im Baals-Tempel, was erklärt, warum sie im vorangegangenen Vers separat vom Tempel Baals genannt wird. Sie wird hier wie an anderen Stellen in den Königebüchern mit Artikel gesetzt, wodurch sie sich konkret auf die Kultobjekte in Samaria wie auch Jerusalem bezieht (1 Kön 18,19; 2 Kön 13,6; 18,4; 21,7; 23,6).
und Ahab erzürnte Jhwh weiter, ihn zu vernichten, indem er mehr Böses tat: Gelesen wird ויוסף אחאב להכעיס את־יהוה את־נפשו להשחית ויעש הרע. Hier geht es um drei Punkte. Der erste betrifft להכעיס את־יהוה um Jhwh zu erzürnen. Die VL stellt zwei Alternativen einander gegenüber:16 (1) ut faceret exacerbationem = τοῦ ποιῆσαι παροργίσματα GBL (= לעשות כעסים), was teilweise im לעשות des MT bewahrt ist, sowie (2) ut exacerbaret deum = להכעיס את־יהוה/אלהים, was sich ebenfalls teilweise in GB im Infinitiv τοῦ παροργίσαι findet, jedoch im להכעיס את־יהוה אלהי ישראל des MT erhalten ist und erweitert wird. Die beiden Lesarten sind Varianten. Das zweite Problem ist der nun folgende Textüberschuss in GBL: (καὶ) τὴν ψυχὴν αὐτοῦ (τοῦ) ἐξολεθρευθῆναι (um sein Leben zu vernichten); dies findet sich bei der VL in et animam suam disperderet. Es fehlt im MT, hat sich aber womöglich in להכרית את־נפשו niedergeschlagen, einem Satzteil, der offensichtlich im MT aufgrund der anderen Störungen im Text weggefallen ist. Dieser Ausdruck stellt in der HB ein Hapaxlegomenon dar, ist jedoch von der Formulierung הנפש [ההיא] יכרת abgeleitet, [diese] Person soll ausgemerzt werden, was in P- (und H-) Texten eine Aussage über Tod oder Exil ist (Gen 17,14; Ex 12,15.19; 30,33; 31,14; Lev 7,20.21.27; 17,4; 19,8; 22,3; Num 9,13; 15,30; 19,13.20; ähnlich Ex 30,33.38; Lev 7,25; 17,9.14; 18,29; 20,18; 23,29). Die dritte Frage berührt die griechische Lesart (L: ἀνθ᾽ ὧν) ἐκακοποίησεν, „er tat Böses“, was auch in VL (et) malignum fecit Widerhall findet. Auch wenn es im MT fehlt, scheint der entsprechende Satzteil ויעש הרע den Komparativ מכל מלכי ישראל, mehr als alle Könige Israels, zu fordern.
34 Dieser Vers fehlt in GL und wird allgemein als späte Hinzufügung angesehen. Siehe die diachrone Analyse.
Hiel aus Bet-El: wörtlich: Hiel der Bet-Eler. Im MT geht in seinen Tagen (בימיו) voran, was eine Glosse darstellt, um diesen Vers in die vorherige Erzählung einzupassen. Hiel ist eine Kurzform von Ahiel, das sich bei GB in Αχειηλ findet. Der Name bedeutet „El (Gott) ist mein Bruder“ und erinnert deshalb sehr an Ahab (16,29).
auf Kosten Abirams: MT: באבירם Zum bet pretii siehe GesK §119p; Joüon §132c; IBHSy, 197. Abiram bedeutet „mein Vater ist erhaben“, was Abram/Abraham entspricht. Es wird in der HB bei einer anderen Person verwendet, nämlich dem rubenitischen Sohn Eliabs, der von der Erde verschluckt wurde, weil er sich gegen Mose erhoben hatte (Num 16; Dtn 11,6; Ps 106,17).
Segub: So das Qere des MT (vgl. 1 Chr 2,21) sowie GB (Ζεγουβ). Das Ketib hat segib (שגיב), vielleicht beeinflusst durch das nächste Wort צעירו. Es ist eine Kurzform des längeren Namens mit der Bedeutung „El/Jhwh ist erhöht“.
Tore: GB hat den Singular. Gelesen wird MT aufgrund des Sinnes.