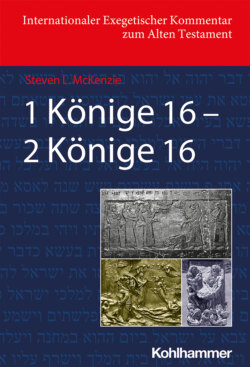Читать книгу 1 Könige 16 - 2 Könige 16 - Steve McKenzie - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Anmerkungen zu Text und Übersetzung
Оглавление8 Im sechsundzwanzigsten Jahr Asas, des Königs von Juda: So MT. Am Ende von V. 6 haben GBL, VL sowie Syr im zwanzigsten Jahr von König Asa, was verrät, dass es sich um den Anfang von Elas Thronbesteigungsformel handelt. Die Formel wurde durch den sekundären Einschub von V. 7 unterbrochen. Sie wird in V. 8 GBL fortgesetzt, doch die Verwendung des Aorists ἐβασίλευσεν deutet darauf hin, dass es sich dabei nicht um die OG handelt. Dass V. 7 stört, zeigt sich in MT darin, dass Jehus Urteil über Bascha erst auf die Notiz über die Thronbesteigung seines Sohnes Ela folgt. Es überwiegt die hebräische Wendung mit der Wiederholung von „Jahr“ (שנה ל X בשנת), die hier im MT steht; sie wird im MT bei allen israelitischen Königen mit Ausnahme Baschas und Hoscheas verwendet, deren Synchronismus mit בשנת beginnt. Zur Konstruktion siehe GesK §134o; Joüon §142o. Die Wiedergabe bei GB wiederholt „Jahr“ nur in 2 Kön 13,1.10 (Joahas und Jehoasch). Dass im griechischen Text ein anderes Jahr der Thronbesteigung angegeben wird, könnte auf eine Textverderbnis zurückgehen, die dem Einschub von V. 7 geschuldet ist. Die nachfolgende Chronologie ist davon nicht berührt.
in Tirza zwei Jahre lang: So MT, entsprechend der Abfolge mit dem Ort an erster Stelle, wie sie bei den israelitischen Königen praktiziert wird, bei denen beide Angaben genannt werden (Bascha, Ela, Ahab, Joahas, Jehoasch, Jerobeam II., Secharja, Pekachja und Pekach). GBL haben zwei Jahre in Tirza. Zu Tirza als Hauptstadt siehe zu 15,33.
9 Simri: So GBL. MT: sein Diener Simri. Der Name ist dem Simri-Lims von Mari vergleichbar und wahrscheinlich eine Kurz- oder Koseform von der Wurzel *ḏmr, „Schutz“.1 Er bedeutet „Jhwh hat geschützt“. Ein hebräisches Siegel belegt die vollständige Form zmrjhw,2 und das Samaria-Ostrakon 12 hat das ähnliche b‛lzmr, „Baal beschützt“.3 GBL haben Ζαμβρει und Josephus Ζαμβριας, worin sich die häufige Verwechslung der Labiale m und b und die Vokalisierung mit einem a in der ersten Silbe spiegelt. Letzteres ist wahrscheinlich ursprünglich; in der Vokalisierung des MT spiegelt sich eine Angleichung.
Arza: Noth sieht dies als Beispiel eines semitischen Tiernamens mit der Bedeutung „Holzwurm“ an.4 Doch eine verkürzende oder Koseform der Wurzel רצה („zufrieden, wohlgesinnt sein gegenüber“) ist wahrscheinlicher.5
10 im siebenundzwanzigsten Jahr Asas, des Königs von Juda: So MT. Die Wendung wird in GBL ausgelassen, was dazu passt, dass dort in V. 15 eine andere Angabe zur Thronbesteigung Simris gemacht wird.
11 sobald er auf dem Thron saß: Zur Bedeutung von sobald siehe Joüon §166l.
er tötete: Mit GB gelesen: καὶ ἐπάταξεν = ויך, was besseres Hebräisch ist als das Perfekt הכה des MT.
nicht übrig lassen: Bei GBL fehlt der Rest des Verses aufgrund der Haplographie, die sich bis V. 12 erstreckt und durch die Wiederholung der Wendung das ganze Haus Baschas verursacht wurde.
männliches Mitglied des Königshauses: Zu dieser Wiedergabe von משתין בקיר siehe die Einleitung.
und auch keine Verwandten und Freunde: Das abschließende Wort (ורעהו) scheint im MT im Singular zu stehen, auch wenn dies ein Fall des Plurals sein könnte, bei dem das Jod ausgelassen wird (GesK 91k; vgl. 1 Sam 30,26; Ijob 42,10); ich jedenfalls verstehe es mit VL, Syr und Targum sowie ad sensum als Plural. Das Wort scheint in 2 Sam 15,37; 16,16 der Titel eines königlichen Beamten zu sein, vielleicht „Brautführer“,6 und das könnte es hier auch bedeuten. Das erste Waw in der Wendung ist epexegetisch, es „verbindet eine umfangreiche Kategorie mit einer vorangegangenen, generelleren Ausage“.7
12 So rottete Simri das ganze Haus Baschas aus: Fehlt in G aufgrund der Haplographie im vorangegangenen Vers.
gegen … durch: Siehe die Anmerkung zu 16,1.
Bascha: So MT. GBL: Haus Baschas, vermutlich eine Erweiterung, obwohl es auch möglich ist, dass es durch die Wiederholung von ב zu einer Haplographie gekommen ist.
der Prophet Jehu: GL + Jehus Patronym.
13 wegen: Gelesen wird על mit GBL (περὶ) aufgrund des Sinns; ist אל im MT vorzuziehen.
und Elas: So G. MT: und die Sünden Elas.
die sie begingen und die sie Israel begehen ließen: So MT: אשר חטאו ואשר החטיאו את־ישראל. In GBL fehlt חטאו ואשר aufgrund von Haplographie. Hierin spiegelt sich auch der Singular החטיא.
Jhwh erzürnten: Diese Lesart wird durch die VL nahegelegt, in der sich nur der Name Jhwh spiegelt, aber der Infinitiv erzürnen fehlt. GL hat ihn zu erzürnen, doch das Suffix und die letzte Erwähnung des Jhwh-Namens stehen in einigem Abstand voneinander. MT und GB haben Jhwh, den Gott Israel, erzürnen, was eine Ausweitung zu sein scheint. Zur Nuance beim Infinitiv an dieser Stelle, also in erzürnender Weise, vgl. Joüon §124l.
mit ihren Götzen: Siehe die Anmerkung zu 16,2.
14 Alles Übrige von Ela, auch was er alles erreicht hat: So GB (καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ηλα ἃ ἐποίησεν = ויתר דברי אלה וכל־אשר עשה) als Kurzform der Formel wie in 2 Kön 1,18; 14,15; 16,19; 21,25 (alles MT). VL hat unverständlicherweise Bascha statt Ela.
ist selbstverständlich aufgeschrieben: Siehe die Anmerkung zu 16,5.
15 Im siebenundzwanzigsten Jahr Asas, des Königs von Juda: So MT. In GB fehlt die Phrase. GL (= OG) hat zweiundzwanzigsten. Ein Grund für diese Differenz lässt sich nicht ausmachen, doch sie hat keinen Einfluss auf die Chronologie im Anschluss.
sieben Tage lang: GB: sieben Jahre lang, ein Fehler.
Während das Heer belagerte: So MT und VL (exercitus castra posuit): והעם חנים; GBL: καὶ ἡ παρεμβολὴ Ισραηλ = ומחנה ישראל = und das Lager Israels. Burney schlägt vor, dass die G-Vorlage durch das Auslassen von ע entstanden ist, was zu המחנה geführt hat; dazu wurde Israel als Erklärung hinzugesetzt.8 Zu עם im Sinne von Heer vgl. 20,15; 2 Kön 8,21; 13,7.
Gibbeton: GB: Gibeon. Siehe die diachrone Analyse.
16 die Truppen im Lager: So GBL (ὁ λαὸς ἐν τῇ παρεμβολῇ = העם במחנה); die Wiederholung von העם החנים im MT ist auffällig.
hörten, dass gesagt wurde: Burney erläutert diese Konstruktion folgendermaßen: „Die Verwendung von לאמר mit einem Subjekt, das von dem des vorangegangenen Satzes abweicht, ist nach dem Verb שמע idiomatisch. … Das neue Subjekt ist faktisch das implizite Objekt des vorangegangenen וישמע, z. B., את־השמע ‚die Meldung‘“.9 Er führt Gen 31,1; 1 Sam 24,10; 2 Kön 5,6 an.
der König: GL + Ela.
die Truppen (2): Wörtlich: „das Volk“. So GL (ὁ λαὸς = העם). MT: ganz Israel; GB: in Israel, was beides weniger Sinn ergibt und wohl durch Israel im weiteren Fortgang des Verses motiviert ist.
machten zum König: MT und GB haben den Plural, während GL und VL den Singular wiedergeben; angesichts des kollektiven Charakters von ‛am/Israel ist beides möglich.
Omri: GAB hat hier und im Rest des Kapitels unverständlicherweise den Namen Simri statt Omri. Der Name Omri kommt sonst in der Bibel nicht vor, und seine Etymologie ist unklar. Im Wesentlichen finden sich hierfür drei Erklärungen:10 (1) von √‛mr, das sonst im Hebräischen nicht belegt ist, sich aber im arabischen ‛amara „leben“ findet sowie im Namen Omar; Noth versteht ihn als ausländischen, d. h. arabischen Namen, doch Gray postuliert ein Hypokoristikon von ‛omrijāhû, was „das Leben, das Jahwe (gegeben hat)“ bedeutet;11 (2) vom amoritischen hamr-, das in den Namen Hamrurapi, Hamru, Humranu belegt ist, sich auf den Pilgerstatus bezieht und also „Pilger (zum Tempel) Jahwes“ bedeutet;12 (3) verwandt mit dem hebräischen ‛omer „Garbe“, was in spöttischem Sinn „Mann der Garbe“ bedeuten würde, als Gegenstück zu Tibni, „Mann des Strohs“.13 Zu ergänzen ist hier noch die Möglichkeit, dass der Name phönizisch ist, und zwar aufgrund des Vorkommens der Wurzel ‛mr in phönizischen/punischen Namen.14 Die Erwähnung des Namens in neuassyrischen Quellen in der Wendung „Haus Omris“ (bit Humri) lässt die dritte Möglichkeit unplausibel erscheinen. Der mögliche ausländische Ursprung des Namens hat zu erheblichen Spekulationen über Omris ethnische Herkunft geführt (siehe die diachrone Analyse).
Befehlshaber des Heeres: Im Hebräischen ohne Artikel (שר צבא), was vielleicht auf einen offiziellen Titel schließen lässt.15
17 ganz Israel: MT und G: + mit ihm (עמו); wird in VL ausgelassen.
zogen hinauf: VL spiegelt einen Plural, während MT und G den Singular haben; beides ist möglich.
von: So MT und GL. GB: εν = ב, was keinen Sinn ergibt angesichts der folgenden Belagerung von Tirza.
18 ging er: So MT, GL und VL. GB: gingen sie.
Zitadelle: Hier und in 2 Kön 15,25 bezieht sich der Begriff ארמון auf einen befestigten Teil des Palastes, vielleicht die Wohnräume des Königs; denn an anderen Stellen – insbesondere in den Prophetenbüchern – bezeichnet er die befestigten und luxuriösen Wohnungen von Königen und anderen Angehörigen der Oberschicht (vgl. Jes 23,13; 32,14; Jer 6,5; 9,20; 17,27; 30,18; 49,27; Hos 8,14).16
über sich: So GB. MT und GL + mit Feuer.
19 wegen seiner Sünde: So MT (Ketib). GB: wegen seiner Sünden. GL: wegen der Sünden. Die Sünde wird als Sünde Jerobeams näher bestimmt, deshalb der Singular. Die Lesart von GL könnte aus der Dittographie des ersten ח entstanden sein, was dann als Artikel verstanden wurde (ה) und zum Weglassen des Suffixes führte.
in seiner Sünde: So MT. GBL und VL haben den Plural, und VL sowie einige griechische Minuskeln setzen alle davor.
die er Israel begehen ließ: Gelesen wird das Hifil Perfekt (החטיא), das sich in GBL spiegelt. MT: עשה להחטיא, womit VL übereinstimmt, auch wenn dort am Ende das Volk statt Israel steht.
20 das Komplott: Wörtlich sein Komplott. So MT und GB. GL: Plural.
ist selbstverständlich aufgeschrieben: Siehe die Anmerkung zu 16,5.
21 Damals: Die Partikel אז mit Imperfekt bezeichnet eine ungefähre Zeit oder ungefähre Umstände in der Vergangenheit; אז mit Perfekt steht demgegenüber eher für eine Abfolge. Häufig dient es auch als Mittel zur Einschaltung einer unabhängigen Episode in eine bestehende Erzählung.17
das Heer: MT liest העם ישראל. Die Konstruktion ist grammatisch falsch und verknüpft vermutlich zwei Varianten.
spaltete sich: לחצי, das in den anderen Textzeugen nicht belegt und vermutlich eine Dittographie ist, wird ausgelassen.
Tibni: Vordergründig „Mann des Strohs“, was das Substantiv תבן mit einer Nisbe-Endung ist. Steht vielleicht in Zusammenhang mit dem phönizischen Namen tbnt.18 Allerdings ist seine Verwendung unsicher. Zu den Vorschlägen gehört der Name, der einem schwächlichen Kind gegeben wird, ein Spitzname oder die Kurzform eines nicht überlieferten längeren Namens.19
Ginat: Offensichtlich ursprünglich ein Ortsname mit der Bedeutung „Umzäunung“ von der Wurzel גנן, der sekundär zum Personennamen wurde.20 Wenn Cogans Ineinssetzung mit Bet-Gan zutrifft,21 könnte Tibni aus Manasse stammen (2 Kön 9,27).
und eine Hälfte folgte Omri: So MT. GBL wiederholt τοῦ λαοῦ γίνεται (des Volkes war), das zuvor schon im Vers vorkam, doch durch die Syrohexapla ist es als hexaplarisch gekennzeichnet. GL + um ihn zum König zu machen.
22 die Truppen … die Truppen: So MT und GL. GB bezeugt eine Haplographie, die durch die Wiederholung von die Truppen, die … folgten entstanden sein könnte (העם אשר אחרי).
besiegten: So MT (ויחזק) und GL (ὑπερεκράτησε); weggefallen in GB nach der gerade genannten Haplographie, als es keinen Sinn mehr ergab. Nur an dieser Stelle in der HB wird חזק mit der Akkusativ-Partikel את gesetzt, was zu dem Vorschlag geführt hat, dass Letztere zu מן oder על zu emendieren wäre.22 Allerdings wird das Verb in Jer 20,7 und 2 Chr 28,20 verwendet, so dass hier keine Emendation notwendig ist.
dann und Joram sein Bruder: Gelesen wird ויורם אחיו בעת ההיא basierend auf GBL. „Für die Echtheit dieses Textes spricht, dass die zusätzlichen Worte ein Detail liefern, das für die Erzählung nicht von Bedeutung ist und sich deshalb nicht als spätere Erfindung erklären lässt.“23
König wurde: So MT. GBL + nach Tibni. Der Überschuss zeigt, dass die OG Omris Thronbesteigung nach diesem Zeitpunkt datiert, also nach dem Tod Tibnis im einunddreißigsten Jahr Asas (V. 23). MT datiert Omris Thronbesteigung anhand von Simris Tod in Asas siebenundzwanzigstes Jahr (Vv. 15–16). Die Diskrepanz zeigt sich in V. 29, wo MT den Beginn der Regierungszeit Ahabs auf Asas achtunddreißigstes Jahr datiert (von 41), während die OG Ahabs Regierungsantritt auf das zweite Jahr von Asas Nachfolger Joschafat datiert. Die gleiche Diskrepanz wird durch die Textzeugen so ausgeglichen, dass MT und OG unterschiedliche Chronologien für die Zeit von Omri bis Jehu bieten; dann fallen die Todeszeitpunkte der Königs Israels und Judas ungefähr zusammen, und die Chronologien stimmen wieder überein.
23 König Asas: So GB (τοῦ βασιλέως Ασα = המלך אסא). MT und GL: Asas, des Königs Judas. Die längere Lesart scheint sich auch in einem Text der Hexapla und der VL zu finden, was darauf hindeutet, dass dies eine hexaplarische Lesart ist, die auf MT zurückgeht.24
von denen er sechs in Tirza regierte: VL hat und vor diesem abschließenden Satz, was bedeuten würde, dass Omri weitere sechs Jahre regiert hätte, wie Josephus annimmt (Ant VIII, 312).
24 den Hügel von Samaria: wörtlich: der Hügel Samaria (את־ההר שמרון), könnte appositionell sein25 oder auf eine Dittographie hindeuten (vgl. Am 4,1; 6,1). Der heutige Ort ist Sebastiyeh, ca. elf Kilometer nordwestlich von Sichem. Hier sind wiederholt archäologische Grabungen unternommen worden, die Belege für beeindruckende Befestigungsanlagen und die Fundamente monumentaler Gebäude mit Mauerwerk aus behauenen Steinen zutage gefördert haben sowie Intarsien aus Elfenbein samt dem Mobiliar, an dem sie angebracht waren. All diese Entdeckungen passen gut zu den verschiedenen biblischen Beschreibungen, denen zufolge Samaria in der Omridenzeit ein wohlhabender Ort war, zumindest für die Oberschicht (1 Kön 22,39; Am 3,15; 4,1; 6,4). Die hebräische Vokalisierung šōmrôn bestätigt die Endung -on, die für gewöhnlich bei Ortsnamen verwendet wird, und zwar vor allem bei Bergen (Hermon, Libanon, Zion). Die Wiedergabe in anderen Sprachen – im Aramäischen (schamrin), Assyrischen (samerina) und Griechischen (samareia) – belegt verschiedene Endungen für Ortsnamen (-ain/-ên/-în). Interessanter noch ist die Vokalisierung der ersten Silbe. Das kurze A, das sich in anderen Sprachen findet, weist auf ein ursprüngliches I in der ersten Silbe hin, und es existieren zahlreiche Belege für Clan-Namen mit dieser Vokalisierung (schimrî, schimrôn, schimrāt, schemer).26 Šōmrôn ist nicht von einem solchen Namen herzuleiten, sondern nur von einem Namen mit ā in der ersten Silbe. Deshalb ist der Hügel wohl ursprünglich nach dem Clan benannt, der ihn besessen hat (wahrscheinlich issacharitisch, siehe unten). Der Name Šōmrôn war entweder eine antike Alternative (Ri 10,1 hat šāmîr vermutlich mit Bezug auf eben diesen Ort) oder entwickelte sich später mit Einführung der Bezeichnung „Hügel des Beobachtens“, also Beobachtungspunkt.27 Der Hügel von Samaria steht zwar allein, doch er „zeichnet sich nicht durch seine Höhe aus“28 und ist nicht so hoch wie manche benachbarte Hügel. Ebenso wenig gibt es Belege dafür, dass er vor der Zeit Omris so stark befestigt gewesen wäre, wie man es bei einem Ort erwarten würde, der als „Wächter“ (šōmēr) bezeichnet wird. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass das erste Ō eine Angleichung an das zweite sein könnte.
nach Schemer: So MT (מאת שמר). GBL, Syrohexapla (sub ÷) + dem Eigentümer des Hügels. Der Name Schemer ist vermutlich eine ätiologische Erklärung des Namens Samaria, vielleicht beeinflusst durch den Namen Schimrîn/Schimron eines issacharitischen Clans in der Umgebung (Gen 46,13; Num 26,24; 1 Chr 7,1). Siehe die diachrone Analyse.
für zwei Talente: Dies ist ein Beispiel für das bet pretii, das dazu verwendet wird, einen Austausch oder Kauf zum Ausdruck zu bringen.29 Die Vokalisierung von בככרים bezeichnet Joüon (§91b) als lectio mixta – sie ist wie ein Dual geschrieben, aber wie eine Konstruktus-Form vokalisiert (kikkerajim < kikkerê) statt kikkārajim;30 im zweiten Fall würde Silber als Apposition oder Akkusativ stehen. Ein Talent entsprach 3.000 Schekel, ca. 34 kg oder ungefähr fünfundsiebzig Pfund.
nannte … gebaut: GB hat Pluralformen.
die Stadt: So MT (העיר). G: der Hügel = ההר, vielleicht beeinflusst durch die drei anderen Erwähnungen des Wortes in diesem Vers.
26 in seiner Sünde: So MT (Qere). G und MT (Ketib): in seinen Sünden. VL: + mit denen er sich gegen den Herrn versündigt hatte. Siehe die Anmerkungen zu 15,34; 16,19.
die er Israel begehen ließ: Siehe die Anmerkung zu 15,34.
Jhwh: So VL. MT und GL + des Gottes Israels. In GB fehlt der Verweis auf Jhwh, wodurch der Infinitiv erzürnen ohne Objekt steht.
ihren Götzen: In GL ist ein Suffix im Singular belegt: seine Götzen. Zum Begriff הבלים als Bezeichnung von Götzen siehe die Anmerkungen zu 16,2.
27 auch was er erreicht hat und seine Macht: Gelesen wird ואשר עשה וגבורתו. Das Waw vor אשר passt zu 16,5. Im MT fehlt alles, was in GBL eine Erweiterung darstellt. GL und VL haben Pluralformen für Macht, wodurch sie sich anscheinend auf Machttaten beziehen. MT wiederholt אשר עשה nach וגבורתו; diese Dittographie wird in GBL weggelassen.
ist selbstverständlich aufgeschrieben: Siehe die Anmerkungen zu 16,5.14.
28 Ahab: Siehe die Anmerkung zu 16,29.
Am Ende von 16,28 haben GBL einen längeren Überschuss, der MT 22,41–51 entspricht (wird dann zu behandeln sein).