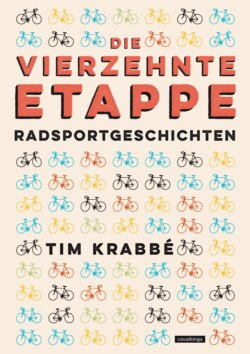Читать книгу Die vierzehnte Etappe - Tim Krabbé - Страница 21
ОглавлениеDIE ETHIK DES LETZTEN RADES (1981)
Die flämischen Zeitungen debattieren immer noch über die Art und Weise, mit der ein gewisser Francis Balhan vor einigen Wochen den wichtigsten belgischen Klassiker für Amateure gewann. Balhan war Teil einer frühen, spielerisch gemeinten Attacke, die zur Überraschung aller aber die entscheidende war.
Hundertfünfzig Kilometer lang, vier Stunden, fuhr Balhan in der Gruppe am letzten Rad. Er fuhr keinen einzigen Meter an der Spitze und er gewann den Sprint. Es war sein erster Sieg überhaupt. Zwischen den Zeilen der flämischen Zeitungen flammt noch die Weißglut, und bestimmt hundert Mal wird erwähnt, dass Balhan ein Wallone ist. Die letzte Generalisierung finde ich ungerecht; viel realistischer ist die Beobachtung, dass man sich in Belgien verglichen mit den Niederlanden um Rennethik herzlich wenig schert. In Belgien wird überaus launisch Rennen gefahren, mit vielen unverständlichen Attacken und sinnlos entstehenden Lücken. In Sinaai-Waas, am 4. August 1975, war ich nach der Hälfte des Rennens mit zwei Belgiern übrig geblieben, weit hinter einer unerreichbaren, neun Mann starken Spitzengruppe und weit vor den Verfolgern. Wir hatten mindestens noch anderthalb Stunden vor uns. Was wäre dann selbstverständlicher, als die armselige Schaluppe zusammen nach Hause zu rudern? Aber nein, eine normale Ablösung an der Spitze schien nicht möglich, wie Pistolenkugeln rissen die Herren aus, von mir weg, und wenn sie aus Ohnmacht wieder eingeholt wurden, weigerten sie sich, an der Spitze mal so richtig in die Pedale zu treten.
Der Hinterradlutscher, der Mann, der immer nur von anderen profitieren will, ist eine dermaßene Klischeefigur, dass man denken könnte, er existiere außerhalb der Vorstellung der Außenstehenden gar nicht. Aber es gibt ihn doch. Man unterschätze allerdings nicht eine gewisse Starrköpfigkeit von so einem Balhan, über die ich mich einmal sehr gewundert habe, als ich einem Artgenossen von ihm begegnete.
Das war am 16. August 1975 in einem Rennen in Wallonien, in Moustier-sur-Sambre, und der Bösewicht hieß Honoré van Poucke, so habe ich das später in den Ergebnissen gelesen. Schon nach zwanzig der hundertzehn Kilometer befand ich mich in einer Spitzengruppe von sieben Mann, die vorne bleiben sollte. Ich kannte niemanden, so weit weg von zu Hause. Zuerst fiel mir ein Fahrer auf der einen »Steinchenschnipper« an seinem Rad hatte, eine kleine Kette, die zwischen den Sitzstreben befestigt war und über dem Reifen tanzte. So würden kleine Steine, bevor sie die Chance hätten, bis zum Schlauch vorzudringen, aus dem Gummi entfernt werden. Es war das einzige Mal, dass ich in einem Rennen jemanden mit diesem Accessoire gesehen habe. Er verabschiedete sich nach einiger Zeit wegen eines platten Reifens aus unserer Spitzengruppe.
Es gab auch einen exotischen, damals schon bekannten Fahrer in unseren Reihen: den neunzehnjährigen Amerikaner Jonathan Boyer, der für ein französisches Team fuhr und viele Rennen gewann – später würde er der erste amerikanische Radprofi werden, Teamkollege von Hinault und Fünfter der Weltmeisterschaft 1980. Eine wirkliche Erinnerung an ihn habe ich nicht; erst als ich in der Zeitung sah, wer gewonnen hatte, entdeckte ich, dass einer meiner Mitstreiter dieser Boyer gewesen war.
Und dann gab es Honoré, dessen äußere Erscheinung in meinem Gedächtnis nur zwei rote Wangen hinterlassen hat. Über neunzig Kilometer lang fuhr Honoré an letzter Position. Wir versuchten alles. Am Schwanz der Gruppe schnauzten wir ihn abwechselnd an, wir drohten ihm in zwei Sprachen mit Schlägen, wenn er die ekelhafte Frechheit haben sollte, nachher mitzusprinten. Auch versuchten wir, ihn abzuhängen; im Prinzip hätte der letzte der Arbeiter, der Honoré an seinem Hinterrad hatte, eine Lücke lassen und diese dann selbst wieder mit einem Sprint schließen müssen. Das hätte Honoré fünf Mal mehr Schmerzen bereitet als uns, aber die Realisierung dieses klassischen Plans scheiterte an Eigeninteressen und Sprachbarrieren.
Nichts half Honoré blieb an seinem letzten Rad, mit einer für mich unergründlichen Schamlosigkeit und Beherrschung. Ich konnte nicht verstehen, was ihn antrieb, wie er die Erniedrigung des Anbrüllens ertragen konnte, wie er es schaffte, zwei Stunden lang von so nah gehasst zu werden, und eigentlich bewunderte ich ihn dafür. Die Gruppe zerbrach kurz vor dem Ziel in zwei Hälften. Boyer gewann, und im Sprint um den vierten Platz ließ Honoré mich mühelos hinter sich.
Vielleicht war Honoré wirklich ein guter Sprinter, und er war mürbe geworden von der Behandlung, die ein Fahrer, der dafür bekannt ist, ertragen muss. Der Sprinter hat ein niedriges Ansehen im Peloton. Er verfügt über ein als zufällig angesehenes, eingeschränktes Talent. Die Fähigkeit zu explodieren ist nicht einmal ein spezifisches Talent für den Radsport. In der Zeit von Moeskops gab es auch Arthur Spencer, der ein Meter siebzig groß war und hundertzwölf Kilo wog. So jemanden kann man doch keinen wirklichen Radrennfahrer nennen, und er war auch zu nicht mehr in der Lage als zu zwei Sprints an einem Abend, aber damit war er einer von Moeskops’ größten Rivalen.
Kein Wunder, dass Fahrer, die diese Gabe besitzen, mit rechtmäßiger Missgunst von vielen anderen Fahrern beäugt werden, die auf alle möglichen Weisen besser sind als sie, aber trotzdem fast immer hinter ihnen ins Ziel kommen. Ist der Sprinter in einer Spitzengruppe, dann wird ihm zusätzlich auf die Finger geschaut, ob er wohl seinen Anteil an der Führungsarbeit übernimmt. Hat er die Spitzengruppe verpasst, wartet das Peloton auf seine Aktionen, und wenn er damit anfängt, lässt man ihn die schwerste Arbeit selbst verrichten; man bringt nicht jemanden an die Spitze, gegen den man verlieren wird.
Es sollte also nicht überraschen, dass viele Sprinter die Ehre und die Ethik einfach über Bord geworfen haben. Ein klassisches Beispiel dafür, das ich selbst miterlebt habe, war auch Klaas, ein molliger Junge um die fünfundzwanzig, der, insbesondere in Massensprints, jahrelang unschlagbar war. Er machte nichts anderes, als auf den Massensprint zu warten. Entstand eine Spitzengruppe von achtzehn Mann, dann sprintete er unbekümmert um den neunzehnten Platz. Wenn zwanzig Mann vorne waren, dann machte er gar nichts, denn es gab nur zwanzig Preisgelder. Seine Geduld war unglaublich, und er mischte sich vor den letzten zwei oder drei Runden nie in den Kampf ein. Er war nicht beliebt bei den anderen Fahrern. Man missgönnte ihm seine Siege öffentlich, aber ich mochte die Bravour, mit der er seinen Mangel an Ehrgefühl umsetzte. Sobald er in die Umkleiden kam, begann er ungefragt aufzuzählen, wie viele Rennen er in dem Jahr schon gewonnen hatte und wie wenig er sich dafür hatte anstrengen müssen.
Wahrscheinlich mied er Spitzengruppen auch mit Absicht, weil die Wut damit persönlicher werden konnte, und mindestens ein Mal hat er danach, unter Androhung von Schlägen, sein Preisgeld den geschlagenen Arbeitern überlassen.
Einmal habe ich Klaas selbst in einer Spitzengruppe erlebt. Das war bei einem Rennen in Zeeuws-Vlaanderen, das über lange, schnurgerade Straßen führte, auf denen man seinen Platz vorne in der Windstaffel eher seinem Geschick als seiner Kraft zu verdanken hatte. Es war eine Zwölfergruppe, und Klaas fuhr ständig am letzten Rad. Angeschnauzt wurde er nicht; man kannte ihn und man fand sich mit ihm ab. »Krank, Klaas?«, wird wohl jeder zu ihm gesagt haben, wenn er hinten am Schwanz der Gruppe an ihm vorbeifuhr. Klaas gewann den Sprint.
Aber der Wind über den Poldern hatte stark geblasen an diesem Nachmittag, so dass Klaas ständig eine wacklige und kräftezehrende Existenz auf der Kippe erleiden musste. Nach dem Rennen fragte ich ihn, warum er nicht einfach mitgearbeitet hatte; er wusste doch, dass ihn das unter diesen Umständen viel weniger Kraft gekostet hätte?
Er nickte, aber er sagte: »Aus Prinzip.«