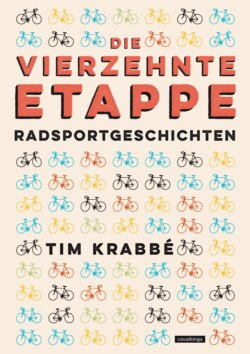Читать книгу Die vierzehnte Etappe - Tim Krabbé - Страница 7
ОглавлениеEIN BELIEBIGES RENNWOCHENENDE (1980)
Samstag, 19. April 1980, Rennen 504. Ronde van Diemen für Senioren* und Sportklasse. Anzahl der Teilnehmer: neunzig. Renndistanz: fünfundvierzig Kilometer.
Den Rundkurs kenne ich aus den vergangenen Jahren. Eine kurvige Pflastersteinstrecke mit vielen Schlaglöchern, etwas mehr als einen Kilometer lang, zwischen hohen Mietskasernen. Es ist sehr kalt und es weht ein zerrender, starker Wind, der durch die Wohngebäude in eigenartige Wirbel gepresst wird.
Der Start ist um eine halbe Stunde verschoben, es ist nicht gelungen, alle Autos pünktlich von der Fahrbahn zu kriegen. Während das Jugendrennen noch im vollen Gange ist, fahre ich über die Bürgersteige an der Strecke entlang. Auf dem langen geraden Stück auf der hinteren Seite ist der Wind erst eine undurchdringliche Mauer, und ein paar hundert Meter weiter hat man ihn auf einmal im Rücken. Hartes Rennwetter. Das Jugendrennen ist auch völlig auseinandergeflogen, es fahren nur noch einzelne Gruppen. Keine davon macht den Eindruck, die Spitzengruppe zu sein.
Als sie noch drei Runden zu fahren haben, gehe ich zur Ziellinie. Der Sprecher nennt den Namen des Jungen, der an der Spitze liegt: Nijdam. Er hat eine Runde Vorsprung vor den meisten anderen. Da kommt er, mit vier Nachzüglern am Hinterrad. Eine Frage drängt sich mir auf, und als er ins Ziel fährt, wird sie beantwortet: Er ist der Sohn des früheren Weltmeisters Henk Nijdam.
Sobald der letzte Jugendfahrer über die Ziellinie ist, springen wir auf die Fahrbahn. Die Krafteinsparung, wenn man vorne startet, lohnt sich bei Rundkursen wie diesem. »Hundert Meter vor der Startlinie aufstellen«, sagt der Sprecher. Ungefähr zwanzig Fahrer halten sich daran, die haben wir schon mal hinter uns. Ich stehe ganz vorne in der Gruppe. Dann dürfen wir zur Startlinie, es gelingt mir, noch ein paar Plätze gutzumachen. Ich zittere, ich will mich bewegen.
Ich gehöre nicht zu den fünf Favoriten, aber wohl zu den fünfzehn, die gute Chancen haben. Von der Kraft her kann ich mit den besten Sprintern mithalten, und alle Fahrer, die mehr Substanz haben, schaffe ich schon im Sprint. Coppi, der immer über meine Schulter mitliest, läuft jetzt weg und schüttelt seinen Kopf
Beim Start komme ich gut weg. Ich kriege sofort meinen freien Fuß in den Pedalhaken; wenn das schiefgeht, kann einen das dreißig Plätze kosten. Schon in der ersten Runde, in der Windmauer, schaffe ich es an die Spitze. Das behalte ich in diesem Jahr bei: Bisher war ich mit meinem Vorderrad in allen Rennen mindestens eine Sekunde lang Erster.
Auf einmal hagelt es, die Eiskörner knattern auf meinen Plastikhelm. Die Pflastersteine sind grobkörnig und können wahrscheinlich nicht sehr glatt werden, aber wir fahren vorsichtig. Zwei Runden später ist der Hagelschauer vorbei, die Straße trocknet sogar. Trotzdem habe ich Schwierigkeiten in den Kurven, es erscheint mir so, als würde mein Hinterrad ständig ein wenig wegrutschen. Jedes Mal muss ich eine Lücke von fünf Metern schließen, es ist schlimm, dass ich nach acht Jahren die Kurventechnik nicht viel besser beherrsche.
Ich bin bei ein paar frühen Attacken mit dabei. Immer wieder die Illusion, dass es in diesem einzigartigen Moment gelingen könnte. Es ist nichts. Jeder jagt jeden, kein einziger Versuch führt auch nur zu fünf Sekunden Vorsprung. Nach ungefähr acht Runden reicht es mir, ich lasse mich auf den zwanzigsten Platz zurückfallen.
Es sieht so aus, als ziehe die Anzeigetafel drei Runden auf einmal ab. Unser Rennen wird also verkürzt. Schade. Vielleicht bleiben von den versprochenen fünfundvierzig Kilometern fünfunddreißig übrig. So wird die Erschöpfung keine Rolle spielen für den Ausgang des Rennens, und die gehört doch dazu.
Verschiedene Male höre ich, wie der Sprecher die Fahrer mit der Startnummer so-und-so-viel aufruft, das Rennen zu beenden, weil sie zu weit zurückgefallen sind. »Schade, meine Herren, aber da kann man nichts machen, und beim nächsten Mal besser. Vielleicht noch ein paar Kilometer zusätzliches Training einlegen.« Ich gucke kurz nach hinten – das Peloton ist schon ausgedünnt auf höchstens vierzig Fahrer.
Es folgen Prämiensprints, ich mache nicht mit. Ich habe beschlossen, dass ich in dieser Saison keine Kraft mehr gegen die lächerlichen Beträge eintausche. Es ist aber schon schade um das Prestige. Und schade um die Werbung: Fast alle Sprecher in den Niederlanden finden ein paar lobende Worte für Das Rennen, sobald ich an der Spitze auftauche. Vor mir fährt Buis, dreiundvierzig Jahre alt, in die letzte Kurve für eine erste Prämie. Er ist wieder unglaublich aktiv heute. Auch Van der Horst sehe ich ständig vorne. Die zwei sind die besten Tempofahrer bei den Senioren. Neben ihren früheren Erfolgen an der echten Spitze waren sie auch beide Niederländische Meister der Senioren.
Selbst mache ich eigentlich gar nichts mehr. Ich fahre nicht besonders gut. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Rennen gewinnen könnte. Ich fühle mich nicht stark genug, um wegzukommen, und Leunis und Duivenvoorden sprinten um eine Klasse besser. Die Wahrscheinlichkeit eines Massensprints wird immer größer: noch zehn Runden zu fahren und noch dreißig Fahrer beieinander. Ich nehme mir vor, zufrieden zu sein, wenn ich unter die ersten sechs komme.
Ich beteilige mich doch mal an einem Prämiensprint, unter dem Vorwand, dass ich testen will, ob ich in einer Runde vom zwanzigsten Platz an die Spitze des Pelotons fahren kann. Ich habe aber nicht genug darauf gedrängt, ich komme als Fünfter durch die letzte Kurve und als Fünfter über die Ziellinie, und es gab vier Prämien. Die gewohnte Lücke hinter uns ist entstanden, und es herrscht kurz Aufregung, ob wir weiterfahren sollen. Aber es ist ebenso eine Gewohnheit, dass die Prämienjäger kurz durchatmen müssen, und ich muss das eigentlich auch.
Nur noch acht Runden. Das Finale beginnt gleich, und noch ist niemand müde. Mein Hinterrad scheint immer mehr wegzurutschen, und die Löcher, die dadurch entstehen, kann ich immer schwerer zufahren. Ich höre manchmal ein kleines Stöhnen in mir drin. Ist dieses Rennen dafür nicht zu leicht? Ich fahre einfach nicht gut.
Kurz danach berühre ich mit meiner Felge den Boden. Aha, ein Platten! Deshalb fuhr ich nicht gut. Ich strecke meine Hand in die Luft, um die anderen zu warnen, Lenker zur Seite, das Peloton zieht an mir vorbei. Ich fühle die Euphorie des Spannungsabfalls. Aber etwas Schönes muss man sich auch echt verdienen. Ich setze mich ein paar Mal hart auf den Sattel und berühre nicht jedes Mal mit der Felge die Straße. Es ist ein schleichender Plattfuß, der Reifen ist nur halb leer. Besser geht es nicht: Jetzt bin ich von der Pflicht befreit, gewinnen zu müssen, aber ich kann noch meine Klasse unter Beweis stellen, indem ich selbst unter diesen Umständen noch einen kleinen Preis gewinne. Ich komme wieder in Gang, und es gelingt mir, den Schwanz des Pelotons zu erreichen. Vier Runden bleibe ich Letzter, damit ich die anderen nicht mit meinem Schlingern behindere. Noch drei Runden, und ich beginne, mich wieder nach vorne zu pirschen.
»Schleicher«, rufe ich ständig, wenn man mich wegen meiner lächerlichen Kurven beschimpfen will. Ganz nach vorne zu kommen, gelingt nicht, dafür fährt es sich zu schwer mit so einem halbplatten Reifen. Und weil Buis den weggesprungenen Van der Horst jagt, muss ich in der letzten Runde eine extra große Lücke schließen. Ich hatte keine Zeit zu schalten und muss jetzt mit dem 14er durch die Windmauer. Ich komme ran, aber bin jetzt wirklich kaputt. Sechshundert Meter vor der Ziellinie, auf dem vorletzten geraden Stück, sehe ich, wie im Augenwinkel die erwartete Lücke erscheint: Hier findet der Schlusssprint statt. Wer kann, sprintet durch die Lücke an allen vorbei, fährt als Erster in die letzte Kurve und gewinnt das Rennen. Ich kann das jetzt nicht, obwohl die wirbelnde Masse von Lenkern viel weniger aufgeregt ist als sonst. Der Grund: Ein Mann ist doch noch weggekommen, Wielhouwer aus Roosendaal. Den hatte ich nicht gesehen. Der Sprint ist nur noch für den zweiten Platz.
Ich ziehe noch an ein paar Fahrern vorbei, aber nicht schnell genug, ich muss vor der Kurve bremsen, und in die Gruppe hineinzudrängen kostet mich wieder ein paar Plätze, mehr als zehn Mann sind vor mir. Ich komme schlecht aus der Kurve, kurz vor der Ziellinie werde ich noch vom Vereinskollegen Winnubst überholt. Ich zähle zwei Mal die Rücken vor mir: sechzehn. Ich bin also Siebzehnter geworden: im Preisgeld.
Ich fahre zurück zu den Umkleiden, ich fühle die Aufregung schon gar nicht mehr. Es ist unbefriedigend, diese kurzen Rennen. Ich fühle mich, als wären mir die Flügel gestutzt worden, nach all den schönen Rennen in Frankreich, die mehr als drei Stunden dauern. Radsport wird erst Radsport nach hundert Kilometern. Unterwegs zu den Umkleiden wird mir drei Mal gesagt, dass ich den Eindruck machte, nicht besonders gut zu fahren. Ich erkläre, dass ich einen schleichenden Plattfuß hatte, aber trotzdem noch ins Preisgeld gefahren sei. Wer will, darf in den Reifen kneifen. Ich stelle ein paar Mal die Standardfrage: »Bist du noch was geworden?« und erhalte ein Mal die Standardantwort: »Nichts, aber wir sind wieder heil zurückgekommen, und das ist das Wichtigste.«
Ich bekomme den sechzehnten Preis, nicht den siebzehnten. Ein Rechenfehler von mir oder von der Jury, in letzterem Falle endlich mal in die richtige Richtung.
Sonntag, 20. April 1980, Rennen 505. Ronde van Sloten für Senioren. Anzahl der Teilnehmer: einhundertzwanzig. Renndistanz: fünfzig Kilometer.
Das ist die Radrennstrecke im Sportpark, in dem ich schon so oft gefahren bin: ein breiter asphaltierter Weg, zweieinhalb Kilometer lang. Heute ist es weniger windig. Schade, diese flache Strecke ist schon so wenig selektiv.
Beim Start stehe ich neben Buis. Ich merke an, dass er gestern ein starkes Rennen gefahren ist, aber ich habe das scheinbar verkehrt gesehen. Er ist in Wirklichkeit schlecht gefahren, seine eigene Frau hat ihm das danach noch gesagt. Er fragt, warum er mich so wenig vorn gesehen habe, und ich erzähle ihm von meinem Schleicher und dass ich trotzdem noch ins Preisgeld gefahren bin.
Wir fahren los, ich bin vorläufig in der Mitte des Pelotons, das ist hier egal. Ich bin ein wenig lustlos, ich vermisse das Verlangen. Ich sehe mir die Kleidung der Fahrer an. Einige fahren mit, andere ohne Handschuhe. Auch gibt es Fahrer mit langen und Fahrer mit kurzen Ärmeln. Ich versuche, um mich herum alle vier Kombinationen zu entdecken, was mir schnell gelingt. Ich glaube, mir ist langweilig. Ich habe keine Ahnung, was ich zu diesem Radrennen beitragen könnte. Der Unterschied zwischen einfach mitfahren und etwas unternehmen ist bei Strecken wie Sloten absurd groß. Es muss ein Massensprint werden, dabei gehöre ich zu den Besten.
Ganze Teile des Rennens entgehen mir. Dagegen bin ich heute ängstlich veranlagt. Auf dem geraden Stück mit Gegenwind wird das Peloton immer dichter, Fahrer suchen die Lücken, die es nicht gibt, und müssen bremsen, man wird zu eigenartigen Kursänderungen gezwungen. Kurz vor mir gehen zehn Mann zu Boden, ich lenke mit der ausweichenden Welle mit und kann drum herumfahren.
Zweifellos finden vorne unaufhörlich Attacken statt, die sofort wieder neutralisiert werden, aber bis in die Tiefen des Pelotons, wo ich mich befinde, pflanzen die Tempowechsel sich nicht fort.
Die ersten zwei Prämiensprints habe ich verstreichen lassen, aber beim dritten entschließe ich mich, mitzumachen. Aus Langeweile und um die Form zu testen. Prämiensprints sind etwas anderes als Zielsprints. Es gibt vielleicht zehn von hundert Fahrern, die sich bewusst dafür entscheiden mitzusprinten, und noch einmal zwanzig, die sich bereithalten, um zufällige Chancen zu nutzen. Es geht nicht unbedingt um die erste Prämie; Mutige haben viel mehr Möglichkeiten, alleine wegzukommen. Ich brauche fünfhundert Meter, um mich nach vorne zu arbeiten; einen Kilometer vor der Linie führe ich. Ich fahre nicht schnell, bin bereit, mit allen, die an mir vorüberziehen, mitzuspringen. Schnell hintereinander folgen drei Attacken. Ich springe ans Rad des dritten Fahrers, es ist anstrengend. Er schließt nur die Lücke zu den anderen zwei, dann nimmt er die Beine hoch. In vierter Position komme ich über die Brücke, fünfhundert Meter vorm Ziel. Jetzt hören auch die ersten beiden auf, und ich muss wieder an die Spitze. Dreihundert Meter vorm Ziel schießen auf einmal vier Fahrer gleichzeitig an mir vorbei. Ich schalte aufs 12er und beginne zu sprinten. Was schiefgelaufen ist, weiß ich nicht, aber ich bin auf der falschen Straßenseite, im Wind. Ich komme an den Vieren vorbei, aber dann muss ich noch hundert Meter, und mehr als zweihundert Meter für eine Prämie zu sprinten, ist nicht schlau. Fünfzig Meter vor dem Ziel falle ich zurück. Van der Horst, der scheinbar an meinem Hinterrad gefahren ist, zieht an mir vorbei. Dass dies ein Prämiensprint ist, entlässt mich aus der Pflicht, Widerstand zu leisten, und ich werde Zweiter. Zehn Gulden verdient.
Van der Horst versucht, durchzuziehen. Sobald er das macht, beginnt sofort eine Jagd. Ich muss mich anstrengen, um mich dreißig Plätze weiter hinten in die Schlange einzureihen. Vor mir entsteht eine Lücke: Jetzt muss ich verdammt noch mal auch noch mithelfen, Van der Horst und einige andere wieder einzufangen. Es scheint so, als säße ich schon wieder in der Windmauer von gestern, aber ich wusste es eigentlich schon: keine Form. Das wird übrigens nur meine Fahrweise beeinflussen, nicht meine Chancen.
Ich brauche zwei Runden, um mich von dem Prämiensprint und den Nachwirkungen zu erholen. Danach warte ich ruhig mitten im Peloton auf das Finale. Drei Runden vor dem Ziel nutze ich eine Situation, in der es sich staut, um vom fünfzigsten auf den zehnten Platz vorzurutschen. Als ich da bin, sehe ich, dass Buis die gleiche Situation genutzt hat, indem er mal wieder eine neue Spitzengruppe gebildet hat. Mit zwei anderen ist er weg, sie haben zweihundert Meter. Es ist nicht meine Aufgabe, daran etwas zu ändern.
Zwei Runden vor Schluss hat die Buis-Gruppe ihren Vorsprung etwas vergrößert, es scheinen jetzt ungefähr zwanzig Sekunden zu sein. Spannend für sie, aber drei Mann sind zu wenig. Und mit der Geschwindigkeit, die ein Peloton auf den letzten Kilometern entwickelt, können enorme Rückstände wieder wettgemacht werden.
Van der Horst fährt an die Spitze und hat wieder eine ganze Schlange hinter sich, aber jetzt scheint ihm das nichts auszumachen. Er rast schnell weiter, er eröffnet die Jagd auf Buis. Damit ich meinen Platz vorne nicht verliere, muss ich mithelfen, ich fühle mich langsam auch etwas besser. Aber die Pedaltritte an der Spitze tun jedes Mal weh: Das ist ein starker Gegenwind, wenn man ihm mit fünfundvierzig Kilometern pro Stunde entgegenstrampelt.
Bei der Glocke für die letzte Runde haben Buis und seine Mitstreiter nur noch hundert Meter, und es steht jetzt fest, dass sie eingeholt werden. Aber das geht auf so viele Arten und Weisen; ich fühle, dass etwas passieren wird. Da: Van der Horst attackiert. Ein anderer springt hinterher, ich bleibe machtlos hinten an der Spitze des Pelotons zurück. Dann kommt ein konzentrierter Wutanfall, und ich versuche es auch. Glücklicherweise gibt es den Brückenkopf zwischen mir und Van der Horst. Ich schaffe es an sein Hinterrad und warte da kurz. Nein, er ist nicht bereit, mich an die Spitze zu bringen. Ich springe an ihm vorbei; alleine fahre ich durch die zwei Kurven und strample dann gegen den Wind. Ich muss weiter, ich darf nicht mal zurückschauen, wie viele mit mir mitkommen. Ich denke: Du Riesenidiot, das hat wieder gar keinen Sinn, du vermasselst nur deinen Sprint.
Ich schaffe es. Ich finde den Anschluss zur Buis-Gruppe, sofort nach Van der Horst. Buis sagt etwas zu ihm, was ich nicht verstehe. Ich schaue zurück: Zu meiner Überraschung sehe ich, dass ich alleine nach vorne gekommen bin, hinter mir ist eine Lücke von dreißig oder vierzig Metern. So wie nach jedem Zusammenschluss fällt das Tempo ab: Eine Sekunde lang dauert der Moment, in dem ein Mann mit Form und Mut ganz entscheidend wegspringen könnte. Ich bin das nicht. Das gesamte Peloton schließt auf. Noch fünfzehnhundert Meter, es wird also ein Massensprint. Coppi steht wieder hinter mir.
Die Spannung des Massensprints macht süchtig, genau wie Zeitnot beim Schach. Solche Belange innerhalb so kurzer Zeit; so viel, das schiefgehen kann. Und das ist ein Massensprint um den ersten Platz! Nervös war ich vor einer Runde, jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun, als an die Unsicherheit des Ergebnisses zu denken.
Ich fahre an vierter oder fünfter Position, aber weiß, dass alle anderen endschnellen Fahrer ganz nah hinter mir sind: Kloosterman, Hagman, Solaro, Cornelisse, Van der Horst, Kouwenhoven, Buis, die meisten von ihnen Ex-Profis. Vorne zu fahren, wäre in diesem Moment noch möglich und vorteilhaft für viele weniger gute Fahrer, aber das Eigenartige ist, dass sie das selten tun. Oft schieben sie als Entschuldigung die Kamikaze-Zustände des Sprints vor, aber vorne sind die Gefahren eben relativ gering. Oft sieht es bei einem Massensprint so aus, als ob sich die Fahrer in der Reihenfolge des zu erwartenden Ergebnisses aufstellen.
Du musst ständig vorne bleiben, raus aus den ersten fünf kann auch sofort raus aus den ersten zwanzig bedeuten. Du darfst keine Angst haben, an der Spitze zu fahren, und wenn es so weit ist, darfst du nicht zu schnell fahren, denn das kostet zu viel Kraft, und nicht zu langsam, denn dann können sie so schnell an dir vorbei, dass du vielleicht eingebaut wirst.
Ich springe mit jedem Rad mit, das an mir vorbeifährt, bleibe am Hinterrad und überhole, wenn das Tempo gefährlich abfällt. Ich hoffe auf diese merkwürdige, aber häufig vorkommende Erscheinung des chancenlosen Sprinters, der aus Verzweiflung dann halt den Sprint für das ganze Peloton anzieht.
Diesmal kommt er nicht, und ich lasse mich überraschen. Sechshundert Meter vor dem Ziel, kurz vor der Brücke, wird um mich herum beschleunigt, und bevor ich mich anschließen kann, sind sechs oder sieben Mann an mir vorbeigerauscht. So fahre ich auf die Brücke, doch noch in ganz guter Position. Und wieder runter, noch fünfhundert Meter. Ich schalte hoch aufs 13er, schaue kurz, ob die Schaltung gut spurt. Auf dem letzten Stück von zweihundert Metern werden wir den Wind genau im Rücken haben, aber erst kommt noch eine leichte Kurve, und jetzt weht der Wind von rechts hinten. Kloosterman, der an der Spitze fährt, lenkt deshalb nach links.
Ein Sprint ist bewusstseinsverengend: Hier ist eine Leere in meiner Erinnerung. Dreihundert Meter vor dem Ziel bin ich wieder dabei. Etwas muss schiefgelaufen sein, denn ich bin jetzt hinter einer Fahrerreihe, die fächerartig von der Straßenmitte bis zum linken Straßenrand reicht. Ich kann mich nicht dazwischendrängen. Aber wenn ich warte, füllt sich auch die rechte Straßenseite. Keine Sekunde zu verlieren. Ich halte mich zurück, damit mein Vorderrad freies Spiel hat, lenke nach rechts und sprinte dann kurz mit aller Macht. Sobald mein Hinterrad das Vorderrad von Kloosterman passiert hat, tauche ich wieder ganz nach links und erhole mich kurz. Wer jetzt an mir vorbeifährt, muss mich aus dem Wind nehmen. Ich fahre an der Spitze, schaue aus dem Augenwinkel nach hinten. Ich sehe, wie das Spalier hinter mir nach rechts immer mehr zunimmt, aber sie wissen, dass es noch zu früh ist. Meine Taktik hat einen Nachteil: Das ist ein Sprint fürs 12er, aber das kann ich jetzt noch nicht auflegen, dann komme ich nicht schnell genug weg. Noch hundertfünfzig Meter. Noch höchstens zwei Sekunden, dann muss ich loslegen. Ich ziehe mein Tempo an. Wie ein Blitz kommt ein Fahrer in einem roten Trikot zu mir vor, neben mich. Ich setze an, um mitzuziehen und gleich vorbeizusprinten, aber er lenkt frech sofort nach links. Also verdammt noch mal, was für ein Arsch, so grob habe ich das noch nie miterlebt. Ich muss voll in die Bremsen, es ist ein Wunder, dass ich nicht stürze.
Er fährt weiter, ich bin geschlagen. Rechts bricht jetzt alles los. Räder schieben sich an mir vorbei, hundert Meter vor dem Ziel bin ich Fünfter. Aber durch die raue Kraftexplosion des Sprints ist links doch wieder eine Lücke entstanden. Es ist, als würde ich dort wie von selbst hineingezogen, ich bin wieder Dritter.
Neid, Überzeugung, ein Schlag auf den Schalthebel zum 12er, vier Mal mit aller Macht treten, und ich hätte sogar gewonnen. Aber ich bin noch verwirrt von dem Ausbremsen. Ich komme nicht mal aus dem Sattel. Ein paar Tritte auf dem 13er, da ist das Ziel. Dem Mann im roten Trikot entweicht ein Schrei der Enttäuschung: Hagman ist rechts an ihm vorbeigezogen und gewinnt, ihm fehlt eine halbe Radlänge. Ich liege wiederum eine halbe Radlänge hinter ihm und bin Dritter. Ich bin dicht unterhalb der Jury durchgefahren, an der Stelle sehen sie einen oft nicht. Ins Preisgeld fahren und nicht gesehen werden, ist mir oft genug passiert, aber diesmal geht es gut; ich werde schon ausgerufen.
Blumen, Podium. Der Mann im roten Trikot, natürlich ist das Van Berkel, der Cowboy, der überhaupt nicht lenken kann, und es ist ihm auch egal.
Ich sage was über das Ausbremsen.
»Du darfst nicht mit deinem Mundwerk sprinten, Krabbé, du musst mit deinem Fahrrad sprinten«, antwortet er.
Wenn er gewonnen hätte, hätte ich Protest gegen ihn eingelegt. Ich bin enttäuscht, aber ach, es kommen noch so viele Rennen.
* Senioren hieß zu der Zeit: 35 Jahre und älter.