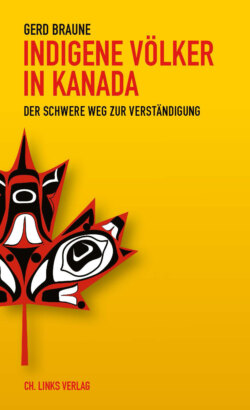Читать книгу Indigene Völker in Kanada - Gerd Braune - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eine »indianische Magna Charta«
ОглавлениеDer Pontiac-Krieg hat dennoch weitreichende Folgen. Am 7. Oktober 1763 gibt der britische König Georg III. eine »Royal Proclamation«, eine Königliche Proklamation heraus. Sie regelt, wie das nunmehr britische Nordamerika regiert wird und welche Rechte die französischstämmige Bevölkerung haben soll, sie enthält Vorschriften über Handel und Landerwerb und Gründung von Siedlungen. Sie legt aber auch eine Grenzlinie zu einem riesigen Gebiet im Landesinneren fest, das als »Indian Reserve« bezeichnet wird. Dieses Gebiet westlich des Gebirgszugs der Appalachen sollte den indianischen Völkern vorbehalten sein. Ziel der Proklamation ist, die Beziehungen zu den indianischen Völkern zu stabilisieren. Die Briten wünschen sich Ruhe an der westlichen Grenze ihrer nordamerikanischen Atlantikkolonien. Expansion, wenn sie denn stattfindet, soll in geordneten Bahnen verlaufen.
Die zentrale Botschaft dieser Proklamation ist klar: Die »Nationen oder Stämme der Indianer« sollen das Land, das für sie als Jagdgründe vorbehalten ist, nutzen können, soweit sie es nicht an die Krone übergeben haben oder das Land von der Krone gekauft wurde. Kein Privatmann darf indianisches Land kaufen. Falls die indianischen Völker Land aus freien Stücken verkaufen wollen, dann nur an die Regierung, und dies im Rahmen »eines Treffens oder einer Versammlung« der Indianer. Damit werden die indianischen Völker als Verhandlungspartner anerkannt, die in einer Beziehung »Nation zu Nation« Landgeschäfte mit der britischen Krone abschließen.16 Ein Jahr danach, im Sommer 1764, versammelten sich mehr als 2000 indigene Führungspersönlichkeiten in Niagara und ratifizierten die Proklamation als »Treaty of Niagara« mit der Krone.17 Die Königliche Proklamation ist somit die erste konstitutionelle Basis für alle Verhandlungen über Landrechte und den Verkauf von Land. Sie wirkt bis heute. Die kanadische Verfassung von 1982 bezieht sich in Abschnitt 25 ausdrücklich auf die Proklamation von 1763. Als 2013 des 250. Jahrestags der »Royal Proclamation« gedacht wurde, wurde sie als »Kanadas ›indianische Magna Charta‹« bezeichnet.18 Sie ist ein »entscheidendes Dokument in den Beziehungen zwischen indigenen und nichtindigenen Menschen in Nordamerika«. Denn die Proklamation erkennt die indianischen Nationen als autonome, politische Einheiten an, die zwar unter dem Schutz der britischen Krone leben, aber ihre eigene interne politische Autorität behalten. Sie ist die Basis für die Ausübung von Hoheitsrechten über das Land, das heute Kanada ist, durch die Ureinwohner und die Neuankömmlinge.19
Die Proklamation von 1763 hatte Folgen nicht nur für die Beziehungen zwischen britischen Kolonisten und indianischen Völkern. Siedler in den 13 Kolonien an der heutigen US-Ostküste waren verärgert, dass die Proklamation ihre Expansion nach Westen behinderte. Als ein Jahr später das britische Parlament auch noch die Québec-Akte verabschiedete, die zum Ärger der protestantischen Siedler nicht nur die religiösen Freiheiten der katholischen Québecer und das französische Zivilrecht garantierten, sondern das Gebiet der Kolonie Québec zudem bis an die Großen Seen und an den Ohio ausbreitete, wuchs der Unmut. In den amerikanischen Kolonien stieg das Verlangen nach Selbstbestimmung. 1775 brach der Revolutionskrieg aus. US-Milizen besetzten vorübergehend Montreal, der Versuch, die Stadt Québec zu erobern, scheiterte aber. 1776 erklärten die Vereinigten Staaten ihre Unabhängigkeit, die durch den Vertrag von Paris 1783 offiziell anerkannt wurde.20
Für die indianischen Völker war der Pariser Friedensvertrag von 1783 ein schwerer Rückschlag. Er hob die Landrechte, die ihnen in der Proklamation von 1763 zugestanden worden waren, wieder auf. Das Land westlich des Ohio-Flusses gehörte nun den jungen Vereinigten Staaten und ihren Bewohnern, die nach Expansion drängten. 1793 versuchten daher 29 indianische Nationen, eine neue Konföderation zu bilden, die sich den US-Amerikanern entgegenstellen sollte. Einer der Verhandlungsführer war Mohawk-Chief Joseph Brant (Mohawk-Name: Thayendanegea oder Tyendinaga) von den Sechs Nationen, der schon im Siebenjährigen Krieg und in der Amerikanischen Revolution auf der Seite der Briten stand. Die Bemühungen, ein Bollwerk gegen die vordringenden Amerikaner zu bilden, scheiterten aber an der Uneinigkeit der indianischen Völker.21
Unter den indianischen Völkern, die sich nun weiterem Zustrom amerikanischer Siedler ausgesetzt sahen, gewann eine neue Führungsperson an Statur: Tecumseh, der Häuptling der Shawnee. Er war ein erbitterter Gegner der US-Amerikaner, die sein Volk zu einem Vertrag gezwungen hatten, mit dem sie einen Großteil ihres Landes an die Siedler hatten abtreten müssen. Sie hatten Tecumsehs Vater getötet und Shawnee-Dörfer zerstört. Als 1812 der Krieg zwischen Großbritannien und den USA ausbrach, stellte sich Tecumseh auf die Seite der Briten. Dies führte ihn und seine Krieger in das heutige Kanada. Seine Konföderation indianischer Nationen, zu der auch die in der heutigen kanadischen Provinz Ontario lebenden Delawaren gehörten, war der letzte große, am Ende aber vergebliche Versuch, indianisches Territorium vor dem Ansturm von Siedlern zu schützen.