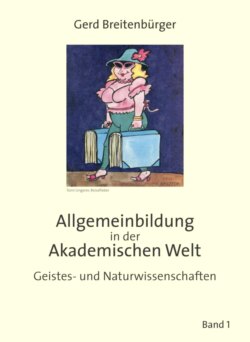Читать книгу Allgemeinbildung in der Akademischen Welt - Gerd Breitenbürger - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2.3 Lurchi und das Biotop
Ein Biotop ist ein Ort, an dem sich ein Lebewesen wohl fühlt, daher sein Wohnort, sein Habitat, und für sein Überleben sorgen kann, da die Anpassung stimmt. Die Temperaturen, die Ernährungs-, Fortpflanzungs- und Konkurrenzlage, alles ist überschaubar und hat das rechte Maß. Was dem Lurchi sein warmer Wohlfühl-Tümpel, ist dem Studierenden seine Wohngemeinschaft, die feste Beziehung, die Mensa, seine Stammkneipe und hoffentlich die Universität. Goethe denkt an dieser Stelle eher an Auerbachs Keller in Leipzig als den Urtyp des studentischen Biotops
Uns ist ganz kannibalisch wohl,
Als wie fünfhundert Säuen!
Wem es so wohl geht, muss ja nicht unbedingt dumm sein. Wenn der Student diese Situation bewusst zur Kenntnis nimmt, wandelt sich sein Biotop zu seiner "Umwelt", die aber etwas mehr umfasst als Natur. Diesen Begriff verdient er in den Augen der Anthropologen damit, dass er ein Lurchi plus x sein möchte, man kann sagen, etwas Besseres als ein Lebewesen, das nur eine Funktion seiner Umgebung ist und auf die die Soziobiologen ihn reduzieren, wenn sie einen konsequenten Determinismus befürworten. Der studierte Lurchi steht dem entgegen. Auch wenn das so pathetisch wie Goethe heute niemand mehr sagen möchte, das andere Extrem lässt sich aber so bezeichnen: Er wolle "die Pyramide meines Daseins immer weiter zuspitzen". Faust hat allerdings alles studiert und alles gesehen, er muss "ärschlings" in die Hölle abfahren. Wer nur den Appetit seiner Gene spazieren führt, die sich laut Soziobiologie vermehren wollen, lebt in der falschen Gesellschaft. Man darf sich über die Soziobiologen nicht lustig machen, aber auch sie gehen meist genau dann spazieren, wann sie es wollen, sehen es aber einfach anders. Auch sie wollen mehr sein als ein Lebewesen in seinem Biotop. Der Aufbau einer Welt kann mit kleinen Schritten beginnen. Wer vor dem schwarzen Brett steht und ein Zimmer sucht, neigt zur Emphase. "Was um Gottes willen habe ich hier verloren?!" Die Variante "Was in aller Welt habe ich hier verloren?!" könnte ihn aufmerken lassen. Er hat sie, die Welt, nämlich nicht verloren, er hat sie noch gar nicht gewonnen. Aber sie bietet sich an mit einer ersten Lektion. Welten gibt es nicht zum Nulltarif. Wer eine Welt haben will, muss sie erobern. Und peinlich für den Geist des Abendlandes, der ja auch an diesem Ort wehen soll, es geht tatsächlich gleich um Volkswirtschaftliches. Ein Gut ist nämlich das, was knapp ist und Suchkosten sind meist komplex: Zeit – Geld – Nerven: Wo soll ich heute Nacht schlafen. Wer sein Zimmer aber schon gefunden hat und nach drei Wochen feststellt, die Vermieterin ist eine "dumme Kuh" und das auch vernehmlich zum Ausdruck bringt, wird schon wieder fristlos vor dem Brett stehen. (Urteil Landgericht Berlin, AZ. 63 S. 410/04). Eine persönliche Welt ist immer auch eine gefährdete Welt.
2.3.1 Umwelt, deren Grenzen kein Thema sind
Es kann produktiv sein, sich assoziativ den immer nächsten Gedanken einfallen zu lassen."Und da fällt mir noch ein … Und dann … und dann." Assoziationen sind Vorstufe des Denkens und nerven immer, wenn man die Pointe eines Mediziner Witzes erwartet und zwischendurch ausgiebig die Sprache auf die Staupe des Schoßhundes kommt. Assoziationen können hüpfen, das ist ihre Schwäche und ihre Stärke. Aber hier geht es um die Welt, von der Marlene erkannte, dass es ihre Welt ist und sonst gar nichts. Ist sie bescheiden? Ist eine solche Welt sehr viel oder wenig? Man kann, wie in der Universität, von räumlichen und inhaltlichen Details eine persönliche Summe bilden und eine gesamte Intuition entwickeln. Was bleibt, ist die Frage der Grenzen. Die Griechen waren sehr anspruchsvoll und verstanden unter Kosmos alles, was darin ist, alles Seiende umfassend. Aber um Himmels willen auch nicht mehr. Wichtig war ihnen, trotz des Unendlichkeits-Gedankens bei Olympia, dass diese Welt nicht unendlich und damit beunruhigend ist. Man verliert jeden Überblick über das, was unendlich ist und damit alle Sicherheit. In einer solchen Welt gibt es einen ganz anderen Drive. Heute meint der Begriff "Welt" den subjektiv erlebten Lebensbereich, also die Umwelt und seine Bedingungen. Die „Welt“ der Feldmaus wäre die im Märchen; denn Welt wäre hier vermenschlicht. Auf dem realen Weizenfeld ist es aber lediglich die "Umwelt", das Biotop, das jede Maus zum Leben braucht und sonst nicht. Die Welt des angehenden Akademikers ist das magische Sechseck, wenn es denn reicht, das jeder selbst bestimmen muss: Bude, Uni, Mensa, Job, Party-Keller und die Freundschaften.
An eine weitere Begrenzung unserer Welt denken wir noch am wenigsten. Ludwig Wittgenstein, der analytische Philosoph und Positivist, saß lange in einer Hütte tief im Wald und hat eine Definition riskiert, die eine sehr viel raffiniertere Begrenzung ausdrücken will: Ein Sachverhalt ist das, was wir in sprachlichen Aussagen benennen können. Damit kommen wir in den Bannkreis von Sprache und deren Regeln. Daher soll es heißen:
Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.
(Ludwig Wittgenstein, Tractatus 5.6).
Es ist die ganz große Lücke, das schwarze Loch im Geist, von dem wir eben nicht sagen können, wie es beschaffen ist, wohl aber, dass es existieren muss: Was ist jenseits der Sprache, und was ist hier die Welt, die vermutlich auch noch unendlich ist. Wie kommt es, dass die Sprache meine Welt bestimmt. Wenn es theologische Inhalte sein sollten, wären sie nicht von Interesse für den Positivisten, da absolut nicht erfahrbar. Kommt da die Kunst und mit ihr die ebenfalls unendlichen Ausdrucksmöglichkeiten, so ist sie unzweifelhaft Bestandteil meiner Welt, aber auch hier verzichten die genauen Wissenschaften darauf, sich geistig und essentiell angesprochen zu fühlen. Sie üben nicht mit einem sacrificium intellectus (Aufopfern des Geistes) Verzicht auf interessante Aspekte unserer Wirklichkeit. Sie definieren nur das als ihre Welt, was in den Augen anderer, der Geisteswissenschaften, als eine reduktive Halbwelt erscheint. Nur was sie beobachten können, kann Objekt ihrer Wissenschaft und somit ihrer Sprache sein. Die Naturwissenschaftler sind abhängig von ihren Methoden, was die ihnen erschließen, können sie sprachlich erfassen. Die Wolke ist für den Träumenden das Segelschiff seines Fernwehs, für das er unendliche Worte finden kann. Für den Positivsten und Meteorologen ist sie ein Kumulus, der in einer bestimmten Höhe mit einem bestimmten Wassergehalt dahinzieht. Was ist sie "wirklich? Für den einen ein äußerer Ausdruck seiner unbegrenzten Innerlichkeit, seiner Welt, für die er eine Sprache erfinden kann, für den anderen ein Objekt, das seine Fachsprache kurz und bündig abhandelt. Beide Feststellungen zusammengenommen sagen, was Wirklichkeit ist.
Wittgensteins Bestimmung geht sehr weit, schließt das Grenzenlose nicht aus. So schön dieser Satz ist, noch schöner wäre zu wissen, was Sprachgrenzen denn nun sind, denn es sollen die Grenzen zum Nichts sein, was sehr aufregend ist. Die Sprachwissenschaft hat seit der Romantik gezeigt, dass jede Sprache mit grammatischen und lexikalischen Eigentümlichkeiten ihre Besonderheiten und damit Grenzen in Syntax und Ausdruck kennt. (Vom deutschen Philosophen Johann Georg Hamann, gest. 1788 bis George Lakoff). Mancher warnt aber auch davor, diesen Sachverhalt zu dramatisieren. Man kann sich durchaus mit dem Angehörigen eines Volkes unterhalten, dessen Sprache 17 Ausdrücke für Schnee unterscheidet, auch über Schnee. Da treffen Grenzen aufeinander, ohne die Welt zu sein. Wittgenstein würde aber auch nicht ausschließen, dass jede naturwissenschaftliche Theorie und jedes Gedicht neue sprachliche Sachverhalte schafft. Vor allem auch dann, wenn man riskiert zu sagen, jedes Gedicht ist ein neues Wort, eine Gesamtbedeutung. Außerdem zeigt sich im Kontrast von Sprachen, dass sie ihre Defizite kompensieren können. Wittgenstein hat recht, wenn schon im Gebrauch eines jeden Wortes die Gefahr besteht, seine Begrenztheit zu unterschätzen, das heißt, er muss sie nüchtern und einfach verwenden. Für die Wissenschaften zählt nicht die Aura, die aus einem Wort Poesie machen kann. Für den Hausgebrauch könnte man aber durchaus sagen, die Sprache ist die Grenze unserer Welt. Aber man kann auch behaupten, dies sei ein unsinniger Satz; denn die Sprache erlaubt die Bildung unendlich vieler und unterschiedlicher Sätze. Wenn meine Nomenklatur (Liste meiner Begriffe) nur 6 Ausdrücke für 6 verschiedene Zitrusfrüchte kennt, ist sie offensichtlich begrenzt, aber das kann ich nur sagen, wenn ich an eine 7. Zitrusfrucht denken kann und viele andere Früchte, schließlich auch noch an die Früchte meiner Arbeit. Es ist schließlich immer noch Sprache, wenn ich von einer Diplomarbeit sage, sie war eine "echte Zitrone". Die Möglichkeit erlaubt, das Wirkliche überhaupt in seiner Grenze auszudrücken, auch zu definieren. Wer von sechs Früchten spricht, schließt die Möglichkeit einer siebten und weiteren Frucht erst einmal aus. Sie ist unmöglich. Die Kategorie „möglich/unmöglich“ ist nun aber wiederum ein Treibsatz für die Sprache, sich unendlich viele Ausdrucksmöglichkeiten zu schaffen. Über die Metaphern wird aus der begrenzten Welt eine phantastisch-unbegrenzte Welt. Nur der Positivist kann diesen Schritt nicht mit vollziehen. Poesie ist nicht seine Sache.
Die Gesetze oder auch All-Sätze und Theorien, die seine Welt beschreiben, müssten als die Grenzen seiner Welt bezeichnet werden. Alles andere interessiert den Naturalisten nur am Rande. Unbegrenztheit besitzen dann die irisierende Phantasie und die Emotionen. In der Sprache treffen sie zusammen, die Welt der immer weiter vorgeschobenen Grenzen und die Grenzenlosigkeit des Geistes, und das immer in einer Weise, die den Positivisten nicht ratlos lässt, sondern in der Annahme bestärkt, alles richtig zu machen.
Gerade weil jeder seine eigene Welt hat, kann er an seine Grenzen stoßen. Die Philosophie Karl Jaspers (Psychiater und Philosoph, gest. 1969) kennt Grenzsituationen, die jedem Menschen begegnen.
Wir sind immer in Situationen, in denen die menschliche Existenz sich als Unbedingtheiten erfährt. "Wir sind immer in Situation. Ich kann an ihrer Veränderung arbeiten. Aber es gibt Grenzsituationen, die immer bleiben, was sie sind: ich muss sterben, ich muss leiden, ich muss kämpfen, ich bin dem Zufall unterworfen, ich verstricke mich unausweichlich in Schuld. Die Grenzsituationen sind neben dem Staunen und dem Zweifel der Ursprung der Philosophie.“
(Karl Jaspers, Einführung in die Philosophie, 1950, zitiert nach dem "Philosophischen Wörterbuch").
Bei diesen Situationen erlebt der Mensch seine Begrenzung. Sie sind wichtig für ihn, kommen aber nicht unbedingt in der umgrenzenden Sprache auf ihn zu. Existentielles geschieht auch ohne Sprache, es gibt diese Welt mit ihrer Stärke und regt Sprache immer an.
Es gibt biologische und biographische Determinanten, die unsere Welt bestimmen im Sinne von beeinflussen. Aber auch wenn wir sie individuell ausgestalten, unterliegen wir den von Jaspers genannten Strukturen, auf die wir Antworten finden müssen. Sie werden Grenzsituationen genannt, weil der Mensch an die Grenzen seiner Existenz, seines Selbstbewusstseins geführt wird. Wer sich von seinem Studium herausfordern und verändern lässt, erlebt eine Grenzsituation in diesem Sinne der Existenzphilosophie. Sie sind tatsächlich Grenzen unserer Welt, aber es sind nichtsprachliche Facetten einer Welt, die immer auch Enge zu schaffen in der Lage ist. Das Medium Sprache kann dann mit seiner Freiheit dazu dienen, sie wieder aufzulösen.