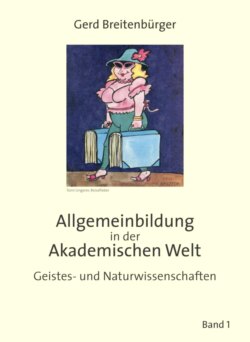Читать книгу Allgemeinbildung in der Akademischen Welt - Gerd Breitenbürger - Страница 40
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2.3 Die Schicksalsfrage: Eintritt Ja oder Nein.
ОглавлениеDer Akademiker hat einen akademischen Grad erworben oder ein akademisches Abschlussexamen abgelegt, also einen Doktortitel oder ein Staatsexamen. Aber auch wenn er noch Studierender an einer Universität oder Hochschule ist, wird er als Akademiker bezeichnet.
Jedes Buch, in gewisser Weise auch das Buch der Bücher selbst macht da keine Ausnahme, darf für sich in Anspruch nehmen, ein Hinweis auf das zu sein, was in ihm geschrieben steht, aber auch auf das, was es alles nicht enthält. Das Konkrete ist umgeben von dem, was ihm als möglich hinzuzudenken ist. Wer von der Bibel spricht oder in ihr liest, liest nicht im Totenbuch der alten Ägypter oder noch früher, im Gilgamesch-Epos. Aber sie gehören zum Kultur- und Sinnhorizont dieses besonderen Buches, das eine Semantik (Lehre von den Bedeutungen), besitzt. Mit dem ersten Schriftzeichen in Uruk ist der Bezug auf eine Situation geschaffen worden, die Konkretes und nicht Sichtbares, Geistiges umfasst. Diese frühe Entwicklung führt bis zum Akademiker, der mit seinem Wissen an der Theorie und an einem Wissenspool teilhat und konkret in seinem Beruf das Theoretische benutzt, um die Praxis zu gestalten. Das Konkrete funktioniert nur, weil es von einem Kranz der Möglichkeiten eingefasst ist. Nur Gott, so man will, und den Urknall müsste man wohl ausnehmen, sie sind ihre eigene und einzige Möglichkeit.
Was der Akademiker kann, tut der Intellektuelle schon lange. Er hat bei uns meist eine wissenschaftliche Ausbildung oder eine künstlerische, muss aber nicht Akademiker sein. Über seinen Beruf hinaus erhebt er seine Stimme, um zu stören, um Kritik öffentlich zu üben an Dingen, die eigentlich außerhalb seiner Kompetenz liegen. Deswegen leitet er seine Legitimation, so auftreten zu dürfen, nicht aus einer akademischen Ausbildung ab, sondern aus Werten der Gesellschaft, die grundsätzlich und allgemein anerkannt sind. Intellektuelle haben eine Chance, gehört zu werden, weil sie einen Namen haben und unbequeme Dinge sagen. Heinrich Böll, Günter Grass, Joseph Beuys verstanden sich als Intellektuelle, die politisch-moralisch oder auch ästhetisch etwas zu sagen hatten ("Der Fortschritt ist eine Schnecke", Günter Grass, "Jeder ist ein Künstler", Joseph Beuys), das sie als richtungsweisend für alle verstanden haben.
Beim Eintritt in die akademische Welt begleitet und leitet uns eine erste, durchaus zufällig zustande gekommene Meinung, die wir höchstwahrscheinlich im Laufe des Studiums ändern müssen. Egal, welches Fach man wählt, mit einer Fachausbildung ist immer auch die Möglichkeit verbunden, über ihre Grenzen hinweg seine Neugier ausleben zu können. Das muss nicht weiter kommentiert werden. Nachdenkenswert ist aber die früh erlittene Déformation professionelle, wenn der junge Spezialist für südafrikanische Schwanz-Schmetterlinge auch noch seine Wohnung mit Schmetterlingstapete tapeziert und nicht mehr weiß, was ein heimischer Kohlweisling ist. Kauzige Eigenarten werden früh angelegt, daher ihre Zähigkeit, entsprechend früh kann man ihnen aber auch entgegenwirken. Die Übertreibung dieser Art ist meist kein Thema für den, der ein Studium aufnimmt. Wohl aber besteht die Gefahr, sich das Lernen erleichtern zu wollen, indem man der Lernlust, die es ja gibt, frönt und zu tief in die Hintergründe eines Themas einsteigt. So interessant es auch ist, sich im Rahmen der Volkswirtschaftslehre vielleicht ein Semester lang mit der politisch-ökonomischen Konvergenztheorie zu befassen, die immer noch in ihren Aussagen aktuell ist, die Ökonomie der knappen Zeit begleitet die Lektüre eines jeden Buches.
Es ist ein allgemein menschliches Verhalten, hauszuhalten mit den Ressourcen (etwa: Reserven an Geldmitteln, an Rohstoffen, Arbeitskräften) wie es heißt, wozu auch die Zeit gehört. Es ist konstitutiv, grundlegend für unsere Welt. Wissenschaften, etwa Volkswirtschaftslehre oder Psychologie, sind dann akademische Fächer, in denen dieses Verhalten systematisch als Thema vorkommt, auch als Gegenteil, verschwenderisches Verhalten. Sie formulieren es als "ökonomisches Prinzip", indem es nicht mehr umgangssprachlich heißt, “ich habe jetzt keine Zeit für Statistik II", sondern "Wenn ich bis November die Arbeit nicht fertig habe, muss ich neu planen." Die Gedanken und Gefühle, die da mitschwingen, machen aus einem Fachstudium eine ganze Welt, persönlich und umfassend. Bei aller Regulierung, jeder interpretiert sein Studium auf seine Weise.
Die Realität sind Tier und Mensch und das Reich der Pilze. Sie sind das Lebend-Seiende, wie der Philosoph sagt. Man kann sie aufführen, in einem Thesaurus. Auf sie beziehen sich die akademischen Wissenschaften, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Das sind Teile der akademischen Welt, aber jeder Teil ist auch ein Ganzes, eine Welt für sich. Um einen Überblick zu erhalten, hat sie der Philosoph Nicolai Hartmann hierarchisch nach ihren Eigenschaften und Fähigkeiten geordnet, nach einem Prinzip, das jeder Ebene und jeder Schicht ihr Recht lässt ("Schichtenlehre"). Man kann das Schema benutzen, um seine Fachdisziplin in ein größeres Ganzes einzuordnen, mit entsprechendem Sinnzuwachs und dem Vorteil einer geistigen Griffigkeit. Systematische Ansätze haben aber immer auch etwas Steriles, das gilt hier bei der Wissenschafts-Orientierung, wenn sie reduktiv vorgeht und dann vom Einzelfall abstrahiert.
Eine erste Annäherung an interessierende Fragen wie an ganze Wissenskom-plexe gelingt besonders gut, wenn man mit einer positiven Erwartungshaltung beginnt und sein Vorwissen anreichert. Nicht Vorurteile sind das Problem, die ein jeder hat, man muss sagen, glücklicherweise. (Schon manch einer hat gemeint, die Universität sei ein guter Ort für ihn und hat tatsächlich Recht behalten). Vorurteile, wenn es denn die richtigen sind und wir auch noch fähig sind, sie in Frage zu stellen, sind nützlich, das ist allgemein anerkannt. Wir sind darauf angewiesen, kategorial zu denken, die Engländer trinken Tee und die Franzosen vin rouge, und damit ordnen wir unsere Welt. Vorläufig, wenn wir kritisch bleiben. Kritisch bedeutet, dass wir uns bewusst werden, dass erste Ordnungsprinzipien, die sich unserer Wahrnehmung anbieten, nicht das letzte Wort sein müssen.
Das Problem ist die bisweilen aus Lässigkeit verschlafene Offenheit, von den Vorurteilen weg zu kommen. Aus der Vogelperspektive einen ersten Blick auf das "Ganze" zu tun, hat den Reiz, Orientierung zu gewinnen, ohne Lehrgeld bezahlen zu müssen. Das kommt früh genug, denn das Richtige gibt es nicht ohne das Falsche. Hier, im Vorfeld der Orientierung, ist der Eintritt in eine Welt nur eine Hypothese, potentiell und lebt immer von alternativen Gedanken.