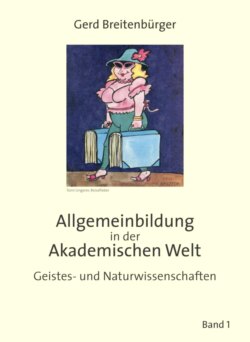Читать книгу Allgemeinbildung in der Akademischen Welt - Gerd Breitenbürger - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.1.2 "Wahr" und "falsch": die Kriterien der Logik
ОглавлениеDie Welt der Wissenschaften ist eine Welt, in der man Recht haben will und auch haben muss und bisweilen auch bekommt. Der Wissenschaftshistoriker Thomas S. Kuhn (Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, 1967 dt.) meint trocken und wenig erfreut, dass einem der Meinungsdurchbruch erst gelingt, wenn die Meinungsgegner ausgestorben sind. Am Küchentisch kann man schon mal nachgeben, der Klügere gibt nach, nicht so hier. Hartnäckige Rückzugsgefechte sind üblich, wenn man widerlegt wird. Der Klügere gibt sowieso nicht nach und der weniger Kluge erst recht nicht, selbst wenn jeder weiß, dass das, was man nicht beweisen kann, nur schiere Behauptung ist. Man muss es mit einer gewissen Bekümmernis feststellen. Was den Status der Wahrheit angeht, so ist sie bei mancher Wissenschaft doch sehr relativ wahr. Wahrheiten, die in Paradigmata (Lehrmeinungen) geronnen sind, werden freundlicherweise so genannt: "beispielhaft". Die naturwissenschaftliche Erkenntnistheorie ist da weniger entgegenkommend und spricht von asymptotischen Annäherungen, die mit Wahrheit nicht viel zu tun haben. Nur Astrologie und Parapsychologie, diese fragwürdigen Wissenschaften und fraglosen Lebenshilfen dürfen ungestraft von "Wahrheit" sprechen und tun es auch, da sie so formulieren, dass man sie nicht falsifizieren kann. Was nicht erlaubt ist nach dem Credo aller anderen Wissenschaften.
Eine sehr enge aber auch präzise Form von "Wahr" und "Falsch" vertritt die Logik. "Oskar schläft in der Vorlesung" ist entweder wahr oder falsch, vorausgesetzt, er ist überhaupt drin und dösen sei nicht schlafen zu nennen. Immerhin bemerkenswert, dass Aristoteles es schon viel kürzer sagte: A ist A und nicht A'. Die Fundamente der Logik, wie sich denken lässt, stammen von ihm. Für die Psychologie ist aber wichtig, welchen Schluss Elvira daraus zieht. "Er hat die ganze Nacht in einem Studentenkeller verbracht." "Er freut sich sicher, wenn ich ihn aufwecke." Wahr – falsch? Mal ja – mal falsch? Mit anderen Worten, die wesentlichen Dinge mit ihren vielschichten Umständen sollten in unserem Leben so passieren, dass explizit entschieden werden könnte, ob etwas wahr oder falsch ist. Aber weil dem nicht so ist und in unserem Alltagsleben diese Frage ständig nur unter der Hand mitläuft und entschieden wird, können wir den Umstand so hochschätzen, dass sich Wissenschaft deutlich abhebt von der alltäglichen Welt des Meinens und Glauben. "Wahr" und "falsch", darunter tut sie es nicht. Wenn alle Stricke reißen, gibt es noch die statistische Wahrscheinlichkeit. Wissenschaft, das ist der Kult der zutreffenden Aussage.
"In meiner Studienzeit vor Jahren wurde die Hohlwelt diskutiert. Aufgebaut war sie als ein Kosmos, der auf der Innenseite einer gigantischen Kugel platziert war." Distanzen der Sterne und anderer Beziehungen ließen sich als korrekte Berechnungen darstellen. In einer folie à deux, einer Liebe, in der beide verrückt sind, funktioniert alles intern störungsfrei, von außen ist sie der helle Wahnsinn. Das "Falsche" sagen zu können, ist für die Wissenschaft so wichtig, wie das "Wahre", das wird noch zu zeigen sein. Auch der Politiker würde sich dem Satz mit herzlicher Zustimmung anschließen. Er ist natürlich für jeden ein wichtiger Grundsatz, auch für den Positivisten, der ihn aber von allen am wenigsten mag. Für ihn ist es schmerzlich, auch nur zeitweilig an die Existenz von Dingen zu glauben, die nicht sind und trotzdem ausführlich über sie zu reden, forschen, schreiben. In ein leicht chaotisches Meinungsbild von unserer Wirklichkeit ziehen wir die Korsettstangen einer Struktur, an der wir auch bei Meinungsverschiedenheiten erst einmal unser Sicherheitsbedürfnis festmachen können. Bildung erlaubt in zwangloser Weise, die Metaebene zu beziehen, die es ermöglicht, noch den letzten Unsinn mit Geist und Grazie zu vorzubringen. Das ist ein halbseidener Aspekt von Wissenschaftlichkeit: Sie versteht es, aus einer falschen Behauptung eine richtige zu machen. Sie behauptet und weist nach, dass die falsche Annahme wichtig für sie und ihr Fortschreiten ist und ändert elegant ihre Argumentation nach dem Motto: es ist wahr, dass die Aussage x falsch ist. Aber sie ist ungemein ertragreich. Dieser Notbehelf des Denkens kommt zur Anwendung, wenn Porzellan statt Gold gewonnen, Amerika statt Indien entdeckt wird, die chemische Grundlagenforschung unverhofft neue Wege aufschließt oder von dem ersten Atommodell zu den weiteren fortgedacht und fortgeschritten wird. Es gibt den „fruchtbaren Irrtum.“, nicht nur, wenn es um die Partnerwahl geht.
Behauptungen werden auch in den wissenschaftlichen Diskursen aufgesellt, ohne sicher zu sein, ob das Gesagte wahr oder falsch ist. Was in der Politik ganz ungeniert geschieht, wird hier in Form von Hypothesen angeboten, Behauptungen in Form von Vermutungen. Das Renommee des Autors spielt eine Rolle sowie die Aussicht auf nachzuliefernde Beweise. Fasst er das, was er ziemlich sicher zu wissen glaubt, in konziser (bündiger) Form zusammen, kann er Thesen aufstellen, für die der Beweis aber auch noch aussteht.
Der Positivist ist aber nicht dazu verdammt, auf Cocktailparties nur zu schweigen und Cognac zu trinken, was aber der eine oder andere zu befürchten scheint. Auf einer bestimmten Meta-Ebene wird alles so flüssig, dass alle Wissensgebiete, alle Fächer, eine Chance haben, assoziativ oder kausal zeitnah zusammen zu kommen. Wenn die Bienen ihre Beute in fünfeckigen Wabenzellen deponieren, hat das wenig zu tun mit dem Einordnen von Karteikarten. Aber was materiell so verschieden ist, ist auf der Metaebene sehr wohl vergleichbar. Wer Natur und Geist aufeinander beziehen will, muss von den Inhalten in die Strukturen gehen. Wie die Libelle ihre Flügel bewegt, war die direkte Inspiration für den Helikopter. Was auf der Objektebene nicht zueinander passt, ergibt auf der Struktur- und Metaebene wahre oder nur brauchbare Aussagen.