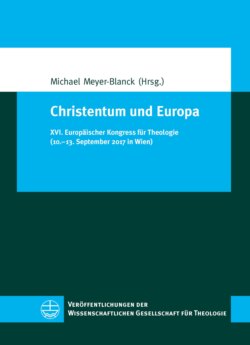Читать книгу Christentum und Europa - Группа авторов - Страница 63
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Konfession als Kultur
ОглавлениеIch selbst teile die grundsätzlichen Anliegen von Thomas Kaufmann, konturiere jedoch den Begriff der Konfessionskultur noch einmal anders. Für mich stellt das Konzept der »Konfessionskultur« in erster Linie ein analytisches Instrumentarium dar, um zu beschreiben, in welchen Formen, Medien, Verfahren sich die verschiedenen Sozialformen des Christentums im Prozess der nachreformatorischen Epoche der institutionellen Pluralisierung christlicher Religion immer wieder selbst erzeugt, wahrnehmend interpretiert und praktisch vollzogen haben. Der Begriff »Konfessionskultur« ist für mich kein Spannungsbegriff, mit dem die Dualität von Konfession und Kultur als zwei selbstständige Dimensionen in den Blick genommen wird. Es geht mir nicht um die alte Weber’sche Frage, wie distinkte Bestände konfessioneller Doktrin das Andere der Kultur geprägt haben. Es geht nicht um komplexe Beziehungsfelder von zwei prinzipiell geschiedenen Bereichen oder Entitäten. Oder um die Diffusion, Transformation, Appropriation des einen in oder durch das andere. Vielmehr sehe ich für die Geschichtsschreibung des konfessionellen Zeitalters einen großen Vorzug darin, unter dem Stichwort »Konfessionskultur« die frühneuzeitlichen Konfessionen selbst mithilfe kulturalistischer Analysekategorien in einem fundamentalen Sinn als Kulturen zu begreifen und systematisch zu untersuchen. Ich plädiere dafür, den Kulturbegriff selbst auf die Konfession anzuwenden und Kultur nicht als das Gegenüber zur Konfession zu verstehen, das von der Konfession in unterschiedlichen Graden durchwirkt oder geprägt wird. Für mich ist »Konfessionskultur« ein integraler Begriff und ein operatives Konzept zur Erforschung frühneuzeitlicher Konfessionalität.
Mit dem Kulturbegriff der hermeneutischen Kulturanthropologie4 verstehe ich unter Kultur ein Zeichen- und Symbolsystem, mittels dessen eine miteinander kommunizierende Gruppe von Menschen ihre Deutungen von Gott und Welt objektiviert und subjektiviert, ausdrückt und verinnerlicht, mittels dessen sie ihre eigene Identität immer wieder hervorbringt und ihre soziale Ordnung stets aufs Neue herstellt. Im Zentrum dieses performativen Kulturbegriffs stehen interaktive symbolische Handlungen von historischen Akteuren und insbesondere das Vermögen dieser Handlungen, im Moment der darstellenden Aufführung Wirklichkeiten zu erzeugen – und zwar soziale genauso wie auch religiöse Wirklichkeiten.5
Wenn Konfessionen in diesem Sinne als Kulturen, als performative Praktiken, verstanden werden, dann lösen sie sich damit keineswegs in ununterscheidbare, beliebige, ephemere, völlig ambigue Formationen auf. Im Gegenteil. Denn die Konfessionalität erzeugenden Handlungen vollziehen sich ja nicht voraussetzungslos, sondern schreiben sich ein in Konventionen und Traditionen und verwenden geronnene Elemente. Aber Konfessionen stellen in einer solchen Sicht eben auch nichts Statisches, ein für alle Mal Gegebenes dar,6 sondern werden beschreibbar als konflikthafte soziale Prozesse, als kreative und situative Hervorbringungen, die eine Geschichte haben, das heißt wechselnden Einflüssen und Konjunkturen unterliegen.
Einen weiteren Vorzug, unter Verwendung eines solchen übergreifenden Kulturbegriffs die Etablierung und den Selbstvollzug frühneuzeitlicher Konfessionen zu untersuchen, sehe ich darin, eine Errungenschaft der Konfessionalisierungsforschung gerade nicht aufzugeben: nämlich die vergleichende, transkonfessionelle Betrachtungsweise, die ich nach wie vor für erstrebenswert halte. Viele in den Konfessionen geschehende Prozesse vollziehen sich eben in der Tat sehr ähnlich und formanalog, und zwar längst nicht nur die Verfahren zur internen Homogenisierung und Disziplinierung.
Aber auch das Augenmerk auf die Funktionalisierung von Religion und die Frage nach ihrer politischen Instrumentalisierung durch frühmoderne Staatsgewalten, der die Konfessionalisierungsforschung stark nachgegangen ist, würde ich unter keinen Umständen aufgeben wollen – und zwar durchaus aus genuin theologischen, nach wie vor aktuellen religionskritischen Erwägungen.
Den größten Mehrwert eines genuin kulturgeschichtlichen Zugangs gegenüber der Konfessionalisierungsforschung sehe ich jedoch darin – und hier treffe ich sicher ein Anliegen, für das auch Thomas Kaufmann stark eintritt –, dass andere, auch theologisch relevante Gegenstände und Phänomene der frühneuzeitlichen Konfessionsgeschichte wieder (oder erstmals) in den Blick geraten. Der Kulturbegriff eröffnet andere Wahrnehmungseinstellungen und forscherliche Fokussierungen. Wenn Kultur als Zeichen- und Symbolsystem definiert wird und Konfessionen damit als symbolische Praktiken begriffen werden, dann tritt ein Gegenstand ins Zentrum der Aufmerksamkeit, den ich in der Tat auch aus kirchen- und theologiehistorischer Warte für hervorragend geeignet halte, um die unterschiedlichen Sozialformen des Christentums, wie sie sich im 16. und 17. Jahrhundert herausgebildet haben, zu typisieren: nämlich die innerhalb der Konfessionen entwickelten unterschiedlichen Symbolverständnisse und Verwendungen des Symbolischen, das heißt die unterschiedlichen Bestimmungen des Verhältnisses von Signifikat und Signifikant innerhalb des symbolischen Handelns. Und damit zusammenhängend die Frage, welchen Ereignissen, Personen und Instanzen die Macht zur symbolischen Re-Präsentation zugesprochen wird. Und welche Medien für geeignet gehalten werden oder überhaupt potentiell imstande sein sollen, Sinn, Ordnung, Transzendenz in der Welt gegenwärtig zu setzen.
Das konfessionelle Zeitalter weist eine kaum überschaubare Vielfalt an Antworten und Möglichkeiten auf, mit all diesen Fragen umzugehen. Man könnte die Konfessionen als verschiedene Arten begreifen, die fundamentale »Krise der Repräsentation«, wie sie von Michel Foucault (1926–1984) und Michel de Certeau (1925–1986) für den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit diagnostiziert wurde, zu bewältigen.7 Konfessionen wären dann Handlungs- und Interpretationsgemeinschaften, in denen es – bei aller internen Differenzierung – zumindest ein grundsätzliches Gefälle, eine Tendenz gibt, das im Repräsentationsbegriff waltende Verhältnis von Signifikant und Signifikat auf eine distinkte Weise theoretisch zu bestimmen und praktisch zu vollziehen.
Der Katholizismus erschiene in einer solchen Analyseperspektive tendenziell als Präsenzkultur, in der es eine Vielfalt von Medien, Ereignissen und Orten gibt, in denen der Zusammenfall von irdischem Signifikanten und unsichtbarem Signifikat kultiviert wird.8 Insbesondere äußerem Handeln wird in dieser konfessionellen Kultur performative Wirkmacht zugeschrieben. Daran hängt dann eine ganze Amtstheologie und Ekklesiologie, in deren Zentrum der handelnde Opferpriester als kultischer Vermittler und die Kirche als heilsanstaltlicher Handlungsraum steht. Im Barockkatholizismus wurde die katholische Handlungsreligion zusätzlich dynamisiert, dramatisiert, geradezu theatralisiert, um die verwandelnde Kraft dieser performativen Aktionen noch sinnenfälliger und spektakulärer innerlich erfahrbar zu machen und um insbesondere die exklusive Fähigkeit der römisch-katholischen Kirche zur Verwandlung und Vergegenwärtigung des Unsichtbaren öffentlich zu demonstrieren.9
Die protestantischen Kulturen wären schließlich in einem solchen Konzept eher als Differenzkulturen zu beschreiben, in denen die bleibende Differenz zwischen irdischem Signifikant und göttlichem Signifikat im Re-Präsentationsvorgang immer eingedenk gehalten werden sollte. Vor allem aber wurden hier nicht äußere Handlungen oder gar Artefakte als Medien der Re-Präsentation favorisiert; vielmehr innere, mentale Vorgänge wie die biblische Memoria, das Hören und Lesen der Schrift. Lutheraner und Reformierte blieben in hohem Maße an das Wort gebunden; sie hörten es in der Predigt und lasen es in Katechismen und Erbauungsbüchern. Ihre religiösen Orte waren die Pfarrkirche und das Haus.
Im Vergleich dazu stand den Katholiken ein ungleich größeres Spektrum an Medien symbolischer Repräsentation zur Verfügung. Andachtsbücher und Katechismen besaßen und lasen sie auch. Auch sie pflegten zuhause ihren Herrgottswinkel. Aber sie hatten fünf Sakramente mehr als die Protestanten, dazu eine kaum überschaubare Vielfalt von Sakramentalien zur Heiligung aller möglichen Lebensvollzüge. Darüber hinaus konnten sie Wallfahrten und Flurprozessionen unternehmen, Reliquien küssen, Schluckbilder verzehren, Rosenkränze halten, die Landschaft mit Bildstöcken sakralisieren. Wer all das mitmachen wollte, konnte es tun. Und wer es nicht wollte, konnte es auch lassen und bei den alten und neuen Orden stärker personal und intellektuell ausgerichtete Angebote abfragen.