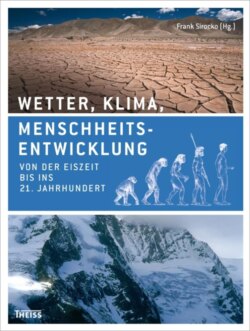Читать книгу Wetter, Klima, Menschheitsentwicklung - Группа авторов - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die letzten 55.000 Jahre anhand von 14C
ОглавлениеDie bekannteste und am häufigsten eingesetzte Methode der Datierung von Seesedimenten ist die Radiokarbonmethode. 14C bildet sich in der Stratosphäre durch die Reaktion der Höhenstrahlung mit dem Stickstoff der Luft, wobei aus dem stabilen Isotop 14N unter Umwandlung eines Protons zu einem Neutron das instabile 14C gebildet wird. Das 14C-Isotop verbindet sich mit Luftsauerstoff zu 14CO2 und gelangt auf diesem Wege in den Kohlenstoffkreislauf zwischen Atmosphäre, Biosphäre, Geosphäre und Hydrosphäre. Einer der wichtigsten Prozesse in diesem Kreislauf ist die Fixierung des CO2 in Pflanzen (terrestrische Bäume und aquatische Algen) durch Fotosynthese. Ist der Kohlenstoff einmal fixiert, beginnt der Zerfall des instabilen 14C mit einer Halbwertszeit von 5730 Jahren.
6.1 Freeze-Kern aus dem Schalkenmehrener Maar (SMf) mit 137Cs-Datierungen und markanten Hochwasserlagen (Pollenanalyse: F. Dreher).
Mit dieser Methode kann daher biogener Kalk (CaCO3), aber auch jede pflanzliche Substanz aus organischem Kohlenstoff datiert werden, das heißt Algen, Blattreste, Samen und Holz. Die Methode wird daher benutzt, um biogene Partikel in den Seesedimenten zu datieren, aber ebenso Knochen (Anwendung in der Archäologie) oder Baumstämme. Insbesondere die Baumstämme stellen ein wichtiges Geoarchiv dar, da diese aus Jahresringen aufgebauten Stämme auch über die Zählung dieser Ringe unabhängig datiert werden können. Wenn die Bildungsrate von 14C in der Atmosphäre immer konstant wäre, müssten Jahresringzählungen und 14C-Datierung der Ringe immer genau übereinstimmen. Leider ist diese Voraussetzung aber nicht gegeben, da die Produktion von 14C in der Atmosphäre sich mit Änderungen der Intensität der Höhenstrahlung, der Sonnenstrahlung und des Erdmagnetfeldes in der Vergangenheit häufig geändert hat. In Kapitel 8 wird dieses Ungleichgewicht erläutert, das andererseits die Möglichkeit eröffnet, die Intensität der Sonnenstrahlung in der Vergangenheit zu rekonstruieren.
An der Universität Hohenheim sind Hunderte von Baumstämmen aus den Schottern von Main und Donau systematisch untersucht und die Baumjahresringe gezählt worden, um daraus eine kontinuierliche Baumringchronologie (Dendrochronologie; Abb. 6.2) zu entwickeln (BECKER 1992, FRIEDRICH et al. 2004). Parallel dazu wurden die Baumringe mit 14C datiert (KROMER & FRIEDRICH 2007). Die Abweichungen zwischen der Baumringchronologie und der 14C-Chronologie werden im Holozän weitgehend durch die Sonnenaktivität bestimmt. Diese Kurve der Sonnenaktivität ist Grundlage vieler Abbildungen in den Kapiteln 18–32.
Mit heutiger Massenspektrometer-Messtechnik können organische Proben bis zu einem Alter von 55.000 Jahren datiert werden. Das größte Problem bei der Radiokarbondatierung ist aber, dass das Ablagerungsalter im Sediment nur in Ausnahmefällen auch dem Bildungsalter der organischen Substanz entspricht. So steht ein Baum unter Umständen erst einmal 150 Jahre, bevor er stürzt, und benötigt dann einige Jahrhunderte, bis er vollständig verrottet ist. Die dabei gebildeten kleinsten Boden- und Holzpartikel werden unter Umständen erst nach Jahrtausenden durch Bodenerosion in den nächsten See gespült. In diesem Falle wären dann Partikel, die schon Jahrhunderte und Jahrtausende alt sein können, in viel jüngerem Sediment abgelagert. Diese Umlagerung von alten Bodenpartikeln stellt für die Maare der Eifel ein ernst zu nehmendes Problem dar, denn in Seesedimenten führen die oben aufgelisteten Differenzen zwischen Bildungsalter der organischen Substanz und Ablagerungszeitpunkt im See aber doch zu erheblichen Abweichungen der 14C-Alter im Vergleich zum Depositionsalter (HAJDAS et al. 1995, BJÖRCK & WOHLFARTH 2001). Zuverlässige Alterseinstufungen von Seesedimenten sind nur möglich, wenn eine große Anzahl von Proben ein in sich konsistentes Muster ergibt. Am zuverlässigsten haben sich dabei Proben von Samenresten und kleinen Zweigen erwiesen. Die ersten dieser Datierungen am Kern UM2 sind in die entsprechenden Abbildungen der Kapitel 18–32 eingearbeitet. Eine eigenständige Publikation zur 14C-Datierung des Kernes UM2 war bei Erscheinen dieses Buches in Vorbereitung.
6.2 Grundlagen der Dendrochronolgie und 14C-Datierung von Baumringen, zusammengestellt von M. Friedrich, Universität Hohenheim.