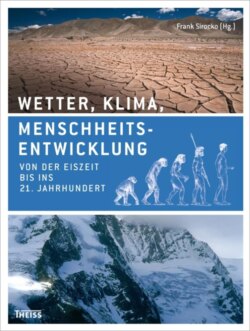Читать книгу Wetter, Klima, Menschheitsentwicklung - Группа авторов - Страница 40
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kalt- und Warmereignisse
ОглавлениеDie Abbildung 7.5 zeigt die meteorologische Situation für je einen besonders kalten und warmen Tag im Sommer und im Winter. Beim winterlichen Kaltereignis im Februar des Jahres 2005 (Abb. 7.5a) strömte kalte Luft aus Skandinavien nach Deutschland, wobei diese Strömung von einem ausgeprägten, beinahe stationären Hochdruckgebiet über dem östlichen Nordatlantik angetrieben wurde. Solche beinahe stationären Hochdruckgebiete werden als „blockierende Hochdrucklagen“ bezeichnet. Die Trajektorien, welche die Zugbahn der kalten Luftmassen in den drei Tagen vor der Ankunft in der Eifelregion darstellen, dokumentieren einen sehr raschen Transport von mehr als 2000 km innerhalb dieser kurzen Zeitspanne.
Beim winterlichen Warmereignis (Abb. 7.5b) spielen ein intensives Tiefdruckgebiet, das vom zentralen Nordatlantik über die Britischen Inseln zieht, und seine ausgeprägte, weit nach Süden reichende Kaltfront die Hauptrollen. An der Vorderseite der Front wird warme Luft aus den Subtropen über Spanien bis nach Polen transportiert. Die Trajektorien zeigen, dass die Luftmasse, welche in der Eifelregion für eine außergewöhnliche winterliche Erwärmung sorgte, drei Tage zuvor noch über dem westlichen Mittelmeer lag und die Alpen überquerte, bevor sie nach Deutschland gelangte, das heißt, auch dieses Ereignis ist mit kräftigen Winden verbunden.
Im Sommer ist die Auswirkung von Hoch- und Tiefdruckgebieten für Kalt- und Warmereignisse im Vergleich zum Winter vertauscht. Während eines sommerlichen Kaltereignisses (Abb. 7.5c) führt ein mäßig intensives Tiefdruckgebiet im baltischen Raum zum Transport kühler nordatlantischer Luftmassen nach Zentraleuropa. Diese Situation war in den nasskalten Sommern der Kleinen Eiszeit vermutlich sehr häufig und damit wohl auch verantwortlich für schlechte Getreideernten, die nachfolgend zu Hungersnöten geführt haben (GLASER 2001, 2008; Kap.30, 31).
Beim sommerlichen Warmereignis (Abb. 7.5d) hingegen wird die Wettersituation wieder durch ein ausgedehntes, stationäres Hochdruckgebiet über Westeuropa bestimmt. In einem solchen Hochdruckgebiet sinken die Luftmassen zumeist ab, was einen wolkenfreien Himmel zur Folge hat. Außerdem sind die Luftmassen häufig über mehrere Tage „gefangen“ und können sich dank der intensiven Sonneneinstrahlung sehr stark erwärmen. Die Trajektorien, die wiederum den Transport der aufgewärmten Luftmassen in den drei vorangegangenen Tagen illustrieren, sind für den in Abbildung 7.5d gezeigten Fall verhältnismäßig kurz, was auf schwache Winde in der stationären Hochdrucklage zurückzuführen ist. Besteht eine solche Wetterlage über einen längeren Zeitraum von bis zu einigen Wochen, kann dies zu einer Hitzewelle führen, wie zum Beispiel im Sommer 2003.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ein polwärts beziehungsweise äquatorwärts gerichteter Transport von Luftmassen, verbunden mit oft relativ stationären Hoch- und rasch vorbeiziehenden Tiefdruckgebieten, hauptverantwortlich ist für ausgeprägte Temperaturanomalien in der Eifelregion wie auch in anderen Gebieten der mittleren Breiten. Direkte Aufheizung oder Abkühlung durch Strahlung führt in manchen Fällen zu zusätzlicher Verstärkung oder Abschwächung solcher Anomalien. Warum sich allerdings diese Konstellationen von Tief- und Hochdruckgebieten entwickeln, ist damit noch nicht erklärt. Die Abbildung 7.5 beschreibt nur die beobachtete meteorologische Situation.
7.5 Meteorologische Situation während eines winterlichen Kaltereignisses (a), eines winterlichen Warmereignisses (b), eines sommerliehen Kaltereignisses (c) und während eines sommerlichen Warmereignisses (d). Dargestellt sind die Temperaturen in einer relativ bodennahen Schicht (auf 900 hPa, das heißt in einer Höhe von etwa 1 km) und der auf Meeresniveau reduzierte Bodendruck (schwarze Konturlinien, Konturabstand 5 hPa). Trajektorien über die vorausgegangenen drei Tage der in der Eifelregion auf 900 hPa ankommenden Luftmassen sind als Pfeile eingezeichnet.