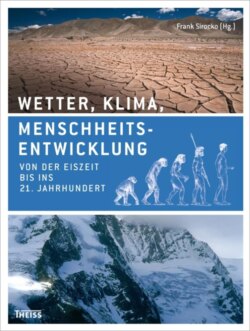Читать книгу Wetter, Klima, Menschheitsentwicklung - Группа авторов - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ulmener Maar: Kern UM2
ОглавлениеDas Foto des UM2-Kernes (Abb. 6.5) zeigt insbesondere in den obersten Metern eine unruhige Sedimentation, die im Falle der extremen Umlagerung bei 2,3 m mit starken mittelalterlichen Hochwassern und/oder dem Bau der Ulmener Burg im 11. Jahrhundert in Zusammenhang steht. Das Ulmener Maar ist nicht nur das kleinste Maar der Eifel, sondern hat auch sehr steile Hänge über und unter Wasser und eine komplizierte hydraulische Anbindung an den Dellbach, der eigentlich am Maar vorbeifließt, bei Hochwasser aber in das Maar einströmen kann (Abb. 5.5). Die feinkörnigen Sedimente des Dellbaches sind aufgrund der im Einzugsgebiet des Maares anstehenden fast weißen Sandsteine des Unterdevons (Kap. 1) sehr hell. Helle Lagen aus gebleichten Quarz- und Feldspatkörnern in Siltkorngröße finden sich über den gesamten Kern verteilt und dokumentieren die fortwährende Aktivität von Hochwassern, das heißt Phasen, in denen der Dellbach seine feinkörnige Suspensionsfracht in das Maar ergossen hat. Mit den klastischen Körnern werden aber auch Pflanzenreste umgelagert, die im 14C-Signal älter sind als das Ablagerungsereignis und die 14C-Datierung erschweren.
6.5 Foto des Rammkernes UM2 aus dem Ulmener Maar mit pollenanalytischen Zeitmarken.
Für den Kern UM2 gibt es derzeit 162 14C-Alter, die aber zeigen, dass im Ulmener Maar die Umlagerung von Bodenpartikeln durch die Suspensionseinträge ein wichtiger Prozess ist. Das Ulmener Maar hat also ein hohes Potenzial als Anzeiger für Starkregen beziehungsweise Hochwasser, ist aus dem gleichen Grund aber auch problematisch zu datieren. Die Pollenkurve des Ulmener Maares (Abb. 6.6) zeigt mit Ausnahme einer extremen Umlagerung bei 6–6,30 m eine sehr ähnliche Abfolge wie das Meerfelder Maar (Abb. 3.5), sodass die palynostratigraphischen Alterseinstufungen weitgehend übertragen wurden. Lediglich für das Ende der Römerzeit gibt es eine Abweichung: Das Birkenmaximum am Beginn der frühmittelalterlichen Ausbreitung der Hainbuche und Rotbuche wird in den ELSA-Kernen auf 470 AD (AD = Anno Domini, nach Christus) datiert, als die Römer sich aus der Eifel zurückzogen und die größte Wahrscheinlichkeit besteht, dass Felder aufgelassen wurden und Birken sich als Pioniervegetation neu ausbreiten konnten (Kap. 27).
Die 14C-Datierung aller ELSA-Kerne umfasst mittlerweile über 200 Datierungen und wird in einer eigenen Publikation vorgestellt werden. Die Datierung aller Kerne, die für die nachfolgenden archäologischen Kapitel als Grundlage dienen, basiert also vor allem auf den palynologischen Markerlagen, die in den Abbildungen 3.5 und 6.1 bis 6.6 auch eingetragen sind. Ebenso sind in diese Abbildungen einzelne verlässliche 14C-Datierungen aufgenommen worden.
6.6 Pollenprofil des Kernes UM2 aus dem Ulmener Maar mit pollenanalytischen Zeitmarken (Pollenanalyse: F. Dreher).