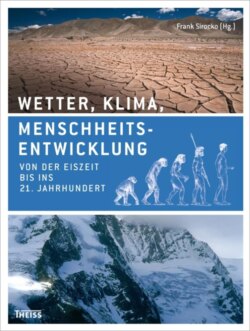Читать книгу Wetter, Klima, Menschheitsentwicklung - Группа авторов - Страница 41
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Stürme
ОглавлениеIn Abbildung 7.6a ist die typische Entwicklung eines mitteleuropäischen Sturmes skizziert. Ein solcher Sturm tritt fast immer im Winter zwischen November und März in Verbindung mit einem intensiven Tiefdruckgebiet auf, das im Atlantik entsteht. Der Entstehungsort liegt meist in einer Region mit einem sehr starken horizontalen Temperaturkontrast, wo also kalte, polare Luftmassen und wärmere aus gemäßigten Breiten nahe beieinanderliegen (Abb. 7.6a, linke Seite). Über dieser Region befindet sich in einer Höhe von etwa 10 km der Jetstream, ein starker, räumlich relativ eng begrenzter Wind aus im Mittel westlicher Richtung mit maximalen Geschwindigkeiten von über 250 km/h. Je ausgeprägter der Temperaturkontrast am Boden ist, desto größer sind auch die Windgeschwindigkeiten des Jets in der Höhe. Kleine Störungen auf dem Jet werden verstärkt und breiten sich in Form einer Welle aus (Abb. 7.6a, links, grüne Linie). Dies führt zur Ausbildung sogenannter Höhentröge und -rücken, die dann auch am Boden das Temperaturfeld beeinflussen. Östlich des Höhentroges (grünes T) wird in der gesamten Troposphäre – das heißt in den unteren 10 km der Atmosphäre – warme Luft nach Norden transportiert. Diese Warmluftzufuhr spielt bei der Bildung und Intensivierung eines Tiefdruckgebietes am Boden, das (auf der Nordhalbkugel) entgegen dem Uhrzeigersinn umströmt wird (schwarze gestrichelte Linie), eine entscheidende Rolle. Höhentrog und Tiefdruckgebiet wandern nun nach Osten. Die weitere Verstärkung der wellenförmigen Störung in der Höhe führt schließlich zu einem Überschlagen der Welle (Abb. 7.6a, rechts, grüne Linie über Zentraleuropa). Auch diese Verstärkung überträgt sich in untere Schichten und bewirkt, zusammen mit anderen Prozessen wie der Kondensation von Wasserdampf in Wolken (bei der große Mengen an sogenannter latenter Energie frei werden), eine starke Intensivierung des Bodentiefs. Diese ist maximal, wenn die Strukturen in der Höhe und am Boden direkt übereinander zu liegen kommen. Typischerweise besitzt ein solches Tief dann stark ausgebildete Fronten, an denen warme und kalte Luftmassen aufeinandertreffen. Die stärksten bodennahen Winde treten dort auf, wo der horizontale Druckunterschied am größten ist, normalerweise in der Umgebung der Kaltfront. Dort kommt es auch zu einer markanten Änderung der Windrichtung – in dem in Abbildung 7.6a skizzierten Fall zu einer Drehung ungefähr von West auf Süd, eingetragen als gelber Pfeil. Im weiteren Verlauf zieht das Tief dann weiter nach Osten und schwächt sich dabei wieder ab.
7.6 Meteorologische Situation während eines mitteleuropäischen Sturmes: a) schematische Darstellung, b) und c) Stürme „Vivian“ und „Wiebke“ im Februar 1990. Dargestellt sind die Temperatur auf 850 hPa (farbige Konturen, Konturabstand 2,5 °C) und der auf Meeresniveau reduzierte Bodendruck (schwarze Konturlinien, Konturabstand 5 hPa).
Als Beispiel für eine solche Entwicklung zeigen die Abbildungen 7.6b und c die meteorologische Situation während der Stürme „Vivian“ und „Wiebke“ im Februar 1990 (SCHÜEPP et al. 1994). In Farbe ist die Temperatur in einer relativ bodennahen Schicht dargestellt (auf 850 hPa, was einer Höhe von etwa 1,5 km entspricht). Die schwarzen Linien zeigen den Bodendruck, reduziert auf die Höhe des Meeresspiegels. Am 27. Februar befindet sich das Zentrum des Orkantiefs „Vivian“ über Skandinavien, während im Nordatlantik ein neues Tief entsteht. Dieses verstärkt sich in den darauf folgenden zwei Tagen zum Orkan „Wiebke“ – von einem Orkan spricht man bei bodennahen Windgeschwindigkeiten von mindestens 118 km/h. Das Tiefdruckzentrum befindet sich am 1. März über Norddeutschland. Die stärksten Winde treten in Frankreich, West- und Süddeutschland auf, was daran zu erkennen ist, dass dort die schwarzen Isolinien des Drucks besonders dicht zusammenliegen.