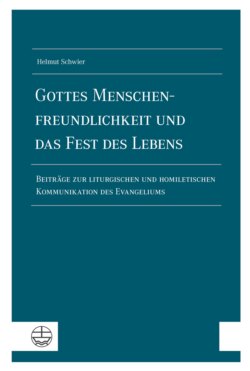Читать книгу Gottes Menschenfreundlichkeit und das Fest des Lebens - Helmut Schwier - Страница 47
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Der Anstieg: Prinzipielle Überlegungen zum Bekenntnis-, Erbauungs- und Quellenbuch
ОглавлениеDie Altarbibel wird im evangelischen Gottesdienst – hoffentlich konzeptionell bewußt – nicht benutzt. Sie liegt aufgeschlagen am zentralen Ort des Raumes. Ihre »Nicht-Benutzung« stellt allerdings durchaus einen Gebrauch dar, nämlich den »symbolischen Gebrauch«7 der Bibel; dieser soll die komplexe Wahrnehmung eröffnen, daß die Bibel nichts weniger ist als die maßgebliche Urkunde der Selbsterschließung Gottes. Hier geht es also nicht nur um den »im Wort gegenwärtigen Gott«, wie es die katholische Liturgiewissenschaftlerin Teresa Berger zu allgemein beschreibt,8 sondern um die protestantische Einsicht in den Charakter der Heiligen Schrift als einzige Regel und Richtschnur des Glaubens. Ihr eignet dogmatisch gesprochen »sufficentia«, allerdings nicht im Sinne einer »Vollkommenheit«, sondern verstanden als zuverlässige »Vollständigkeit«.9
Hieraus ergibt sich bereits eine fundamentalliturgische Folgerung von einigem Gewicht. Nicht erst die Lesung und Auslegung der Schrift als Verkündigung von Ambo und Kanzel, sondern das gesamte Gottesdienstgeschehen erwartet und eröffnet Gottes Gegenwart in, mit und unter menschlichen Worten. Dies wäre durchaus noch mit Luthers oft strapazierter Äußerung in der Torgauer Kirchweihpredigt von 1544 kompatibel,10 tendiert aber deutlich zu deren Überschreitung, zumindest zur Korrektur ihrer Rezeptionen. Denn ein starres »Wort-Antwort-Schema« ist nicht in der Lage, das komplexe Gesamtgefüge des Gottesdienstes zu erfassen. Die Altarbibel provoziert dagegen durch ihren symbolischen Gebrauch dazu, Gottes zuverlässige Gegenwart nicht nur in, mit und unter, sondern auch vor den menschlichen Worten des Liturgen zu glauben und zu denken und dementsprechend menschliche Worte und Handlungen als in Gottes Gegenwart geschehend. Als kleine Zwischenbemerkung (und Trostwort für die Kirchenmusiker unter uns) sei hier eingefügt, daß dann der Gottesdienst eben nicht erst mit dem Gemeindelied beginnt oder gar mit der Begrüßung des Liturgen, deren Bedeutung ohnehin chronisch überschätzt wird und deren Ausführung zumeist die Geistlosigkeit einer Sitzungseröffnung widerspiegelt.
Dieses weite Verständnis von Gottes zuverlässiger Gegenwart erfordert jedoch eine Rückbindung an die Schrift, weil – wie Eberhard Jüngel in Aufnahme Karl Barths zu Recht hervorhebt – angesichts der wunderbaren und notwendigen Fülle sprachschöpferischer Tätigkeit des Glaubens es doch »Vieles [gibt], was Gott nicht ist«.11 Deshalb braucht die Altarbibel Lektionar und Kanzelbibel, also Lesung und Auslegung. Deren Funktionen sind einerseits kreativ-innovativ, andererseits regulativ. Während jene Funktion einsichtiger ist – auf sie komme ich im materialen Teil zurück –, bietet das Verständnis der Bibel als Regulativ und Steuerung natürlich Probleme und offene Fragen: Was heißt hier Bibel? Ein Einzeltext, und wenn ja, welcher? Oder jeder mit gleichem Wert? Oder die Texte des Kanons in ihrer Gesamtheit – aber was ist dann mit den Widersprüchen und Irrtümern in der Bibel? Wie kann man regulieren, wenn man gerade nicht auf Leitvorstellungen wie die »Mitte der Schrift« oder den »Kanon im Kanon« zurückgreifen will? Welche hermeneutischen Entscheidungen sind hier berührt?
Damit uns diese Fragen nicht zum Rückweg zwingen, will ich versuchen, sie zu beantworten; dabei werden zunächst die Grundfunktion der Bibel als Quellenbuch und biblisch-theologische Überlegungen hilfreich sein.
Unter den derzeitigen biblisch-theologischen und hermeneutischen Entwürfen ist der vor kurzem veröffentlichte Entwurf meines Heidelberger Lehrers Gerd Theißen für mich überzeugend, weil er die Vielfalt biblischer Zeugnisse bewahrt und gleichzeitig die Überzeugungskraft der Bibel im Horizont modernen und ökumenischen Denkens und Verstehens reflektiert.12
Die Vielfalt biblischer Zeugnisse wird gleichzeitig bewahrt wie strukturiert durch die Analyse und Konstruktion elementarer Grundmotive. Sie bilden die Tiefenstrukturen in den Texten, die auf die Oberflächenstrukturen wie eine regulierende Grammatik wirken. Das bedeutet: »nicht die vielen Wörter und Sätze, die vielen Geschichten, Bilder und Normen sind in der Bibel das Entscheidende, sondern ihre Grundmotive.«13 Die Grundmotive bilden jedoch kein strenges System, sondern »eher ein loses Regelgefüge mit Überschneidungen und Berührungen«.14 Theißen selbst operiert mit einer durchaus offenen Liste, die mal elf, mal vierzehn, mal fünfzehn Grundmotive enthält, Die wichtigsten sind das Schöpfungs-, Weisheits-, Wunder-, Distanz-, Exodus-, Stellvertretungs-, Einwohnungs-, Glaubens-, Agape- und Positionswechselmotiv.15 Diese Motive erscheinen je in verschiedenen Themen, Textgattungen und auch Traditionsbereichen und lassen Verbindungen erkennen, die an der Oberfläche keineswegs offensichtlich sind. Veranschaulichen wir dies am Beispiel des Positionswechselmotivs:16
Dies Motiv findet sich explizit in dem bekannten Logion: »wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener« – also: wer der Erste sein will, soll bereit sein, die Position des Letzten zu übernehmen – so Mk 10,43 und öfter. Das Motiv begegnet zunächst bei unterschiedlichen Themen: bei der Deutung der Geschichte, deren Auf und Ab als Gottes Erhöhen und Erniedrigen interpretiert wird, in ethischen Mahnungen als Aufforderung zur Demut, in der Christologie bei der Erniedrigung ans Kreuz und der Erhöhung durch Gott und schließlich in der eschatologischen Deutung, daß die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten sein werden. Das Motiv begegnet weiter in verschiedenen Gattungen (in Hymnen, in der Jesusüberlieferung und in Erzählungen, exemplarisch in der von der Fußwaschung) und schließlich in verschiedenen Traditionsbereichen: Nehmen wir an, es verschlug einen Christen, der durch die synoptischen Evangelien geprägt ist, in eine paulinische Gemeinde, so konnte er dort den Philipperhymnus mitsingen. Die Vorstellung einer präexistenten Erlösergestalt, die vom Himmel kommt und dorthin zurückkehrt, wird ihm unbekannt gewesen sein, aber er kannte die Geschichte vom Weg Jesu ans Kreuz und dessen Worte von Erniedrigung und Erhöhung. Falls eine johanneische Christin anwesend war, so wird sie kühner noch als alle anderen die Erniedrigung ans Kreuz als eine verborgene Erhöhung interpretiert haben. Selbst ein Anhänger des Jakobusbriefes kann sich von Texten mit dem Positionswechselmotiv angesprochen fühlen, denn er kennt die Regel aus Jak 4,10: »Erniedrigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen.«
Die Grundmotive können darüber hinaus als regulative Sätze formuliert werden,17 beschreiben also nicht einfach religionswissenschaftlich erfaßbare Traditions- und Bildmotive, sondern – das ist das Entscheidende! – sie werden zu Bestandteilen einer Theorie der christlichen Religion. Zu dieser Theorie gehören außerdem eine gewisse Hierarchisierung der Motive und die Berücksichtigung von zwei grundlegenden Axiomen – nämlich das Axiom des Monotheismus und das des Erlöserglaubens – als den fundamentalsten Regeln der christlichen Grammatik, die sie gleichzeitig mit der jüdischen Grammatik verbinden wie von ihr trennen.18
Theißen entwirft dann eine anregende Theorie der urchristlichen Religion, die semiotische, kulturwissenschaftliche und systemische Einsichten mit historisch-kritischer Exegese verknüpft. Wären wir in einem Seminar, würden wir diese Theorie, ihre grundlegenden Axiome und Motive nun konkretisieren und überprüfen müssen. Dies geht hier nicht. Stattdessen will ich auf die gestellten Fragen zurückkommen und Konsequenzen bedenken.
Dieser Heidelberger Entwurf zeigt, daß die Analyse der Bibel als Quellenbuch eine Religionstheorie ermöglicht, die wiederum zu einer Theologie des Neuen Testaments führen kann. Hier regulieren weder ein Einzeltext noch der Gesamttext in seiner Oberflächengestalt oder gar ein dogmatischer Lehrbegriff. Steuerungskraft haben vielmehr die beiden Axiome und die Basismotive, die den Geist der Bibel in, mit und durch ihren Buchstaben hindurch repräsentieren. Diese geistreiche Grammatik muß nun nicht durch Lektüre eines mehr oder weniger spannenden Lehrbuchs gelernt werden – das müssen nur die Theologinnen und Theologen tun –, sondern sie wird wie bei dem Erwerb der Muttersprache durch Hören und Sprechen und Gebrauchen internalisiert. D. h.: Wir internalisieren sie, wenn wir biblische Geschichten hören, biblische Texte lesen, uns mit den biblischen Personen von Adam bis Paulus, von Eva bis Junia identifizieren19 und dialogisch wie konfrontativ die wirklichkeitserschließende und -verändernde Kraft der biblischen Botschaft erfahren und auf diese Weise die Bibel als Erbauungsbuch nutzen.20
Dies ermöglichen Lesungen und Auslegungen in der Liturgie. Sie sind daher prinzipiell notwendig: Sie entlarven das Viele, das Gott nicht ist, zeigen zuverlässig, wer der Eine Gott ist und wie er sich in Kreuz und Auferweckung »in einzigartiger Weise an Person und Geschick Jesu gebunden«21 hat, und sie geben Geist und Buchstaben der Bibel in guter erbaulicher Absicht kund.
Beenden wir diesen Anstieg mit einer ersten praktischen Konsequenz: Eine Kritik der Auswahl der Texte für gottesdienstliche Lesungen und Auslegungen müßte neben Verständlichkeit, Bezug zum Kirchenjahr und Prädikabilität darauf ausgerichtet sein, daß die Texte die Pluralität der biblischen Grundmotive wiedergeben. Dies erscheint mir – unbeschadet aller notwendigen Einzelkritik an Texten, Abgrenzungen und Zuordnungen – im evangelischen Sechsjahreszyklus aufs Ganze gesehen eher gewährleistet zu sein als in den anderen Modellen eines Dreijahreszyklus oder einer lectio continua. Daß der leider erst 1995 vorgelegte gründliche Entwurf einer Revision der Perikopenordnung22 aus pragmatischen Motiven von den Kirchen nicht weiterverfolgt wurde, ist allerdings auch unter dem Aspekt der biblischen Pluralität höchst bedauerlich, bot er doch neben neuen Zuordnungen eine noch stärkere Aufnahme alttestamentlicher Texte (110 von 417 Perikopen) und eine Durchmischung der Predigttexte, die die alte Starrheit, in der 2. Reihe ausschließlich, in der 4, und 6. Reihe überwiegend über epistolische Texte zu predigen, überwunden hätte.
Übrigens – davon, daß viele unserer jetzigen Lesungen schwer zu hören und zu verstehen sind, können Sie sich an fast jedem Sonntag im Selbstversuch überzeugen.