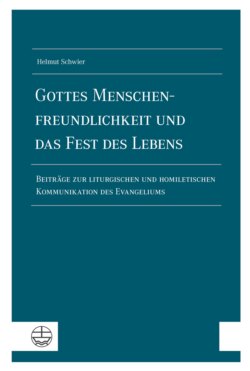Читать книгу Gottes Menschenfreundlichkeit und das Fest des Lebens - Helmut Schwier - Страница 60
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein Blick auf die theologisch-literarische Chronologie
ОглавлениеDie Rede von der Auferstehung in Form von Bekenntnissen, Erzählungen, Andeutungen oder theologischen Argumentationen lässt sich in gewissen Grenzen auch diachron zuordnen. Dabei ist zu beachten, dass die frühere, meist liberalprotestantische Auffassung, nach der es eine lineare Entwicklung vom Einfachen zum Komplexen, von niedriger zu hoher Christologie gab und Paulus natürlich immer im Zentrum steht, zu grob und zu einfach ist. Dass sich die Christologie erst nachösterlich entwickelte, ist davon unbenommen.1 Außerdem ist hinsichtlich der Grenzen die methodisch bedingte Unsicherheit zu berücksichtigen, die Texte genau datieren oder mündliche Vorformen einwandfrei erheben zu können.
Geht man von den unzweifelhaften schriftlichen Zeugnissen aus, so bieten 1Thess2 und vor allem 1Kor etwa Anfang der 50er-Jahre elaborierte Auferstehungsrede. Dabei ist 1Kor 15,3b–5 ein durch V.3a explizit ausgewiesenes Traditionsstück, das zum Bekenntnisgut des frühen Christentums gehört, damit zeitlich auf die 40er-Jahre und geographisch wohl auf das hellenistische Milieu Antiochias verweist, das Paulus in der Frühzeit geprägt hat. Von dieser Basis ausgehend lassen sich dann auch andere alte Texte und Formeln erkennen: Eng verwandt wegen der Protophanie vor Petrus sind die kleine Doppelformel in Lk 24,34 (»Der Herr ist wirklich auferstanden und Simon erschienen«)3 sowie die unterschiedlichen Kontrastformeln, die das menschliche und das göttliche Handeln kontrastieren: Ihr habt Jesus getötet – Gott hat ihn auferweckt.4 Diese gehören als Umkehrruf in die frühe judenchristliche Gemeinde, vielleicht nach Jerusalem.
Wir haben also historisch betrachtet sehr früh nach der Kreuzigung Jesu (um 33) schriftliche Belege für den Auferstehungsglauben, und zwar in Gestalt von Umkehrrufen, Glaubens- und Bekenntnisformeln und in Gestalt der meist partizipial konstruierten Gottesprädikationen,5 die vor und spätestens mit Paulus zur Theologie- und Christologiebildung führen – im Kern: Gott ist als derjenige grundsätzlich zu bestimmen, der Christus von den Toten auferweckt hat. Alle diese Formeln zielen der Sache nach auf die Weckung des Glaubens oder sie führen sogar, wie man an Paulus sieht, zu Lebenswende und Beauftragung. Ostern ist auch historisch das »Urdatum«6 des Christentums und gleichzeitig hat es »als das ursprüngliche und endgültige Offenbarungsgeschehen […] zu gelten«.7 In Übereinstimmung mit unseren historischen Kenntnissen und den Einsichten in die Literaturentwicklung gibt es keine Ostererfahrung und Beschreibung des Osterereignisses seitens sog. neutraler Zeugen. Ostererfahrung ist Begegnung mit dem Auferstandenen in Vision oder Audition und als Offenbarung zu verstehen, also als Gottes eigene Erschließung und Selbstkundgabe. Sie ist ursprünglich und endgültig: Von hier aus wird nicht etwas, sondern alles neu gesehen, neu gedeutet und vor allem – es wird neu und anders gelebt.8
Diese grundlegende neue Wirklichkeitsperspektive spiegelt sich dann in den literarischen Zeugnissen seit den 50er-Jahren wider. Nicht erst am Ende der neutestamentlichen Christologie, sondern schon vor und seit Paulus ist Christus der lebendige kyrios (1Kor 8,6) und damit der auferweckte Herr der Welt, dem zu glauben ist (Röm 10,9 f.). Der Gekreuzigte ist mit dem Philipperhymnus, den Paulus zitiert, redigiert oder selbst verfasst hat, der Herr aller Herren und Empfänger der Proskynese und Anbetung (Phil 2,10 f.) und etwas später im Kol (ca. 60–70) der Erstgeborene der Schöpfung und der Erstgeborene aus den Toten (Kol 1,15.18).9 Schon hier wird also sog. hohe Christologie greifbar, die sich dann spätestens ab den 90er-Jahren im Eph, Hebr und in der Apk mit neuen Ausdrucksformen und Metaphern verbindet.10
Nur wenig früher, bzw. dann etwa zeitgleich mit diesen Texten, wird die Erzählüberlieferung entwickelt. Natürlich ist es möglich, dass die Geschichte vom leeren Grab schon zur mündlich überlieferten Passionsgeschichte gehört, zumal es historisch keine frühen Belege für ein Passionskerygma ohne Ostern gibt; aber der Text in Mk 16,1–8 ist literarisch und theologisch so sehr mit der markinischen Theologie verbunden, dass es meines Erachtens wahrscheinlicher ist, für diese Geschichte vom Jahr 70 auszugehen. Erst ab da gibt es greifbare schriftliche Erzählüberlieferungen,11 die dann in den nächsten 30 Jahren von den anderen Evangelisten ausgebaut und weitergeführt wurden. Die Ostererzählungen gehören in die gleiche Zeit wie die hohe Christologie der späten Briefe und der Apk. Die Ostererzählungen und die Evangelien sorgen dafür, dass der endzeitlich-richterliche Menschensohn, das Lamm Gottes, der Sohn und logos vor aller Zeit auch eine irdische Geschichte erhält und mit einem konkreten Menschen, seiner Botschaft und Lehre sowie seinem Wirken in Israel unlösbar verbunden ist. Christus, Sohn Gottes und kyrios ist dieser Jude Jesus.
Das Jude-Sein des Auferstandenen findet sich interessanterweise auch in einer mittelalterlichen Darstellung: im sog. Psalter Ludwigs des Heiligen (Anfang 13. Jh.), in dem in der Mahlszene der Emmausgeschichte auch Jesus den im IV. Laterankonzil (1215) allen Juden zur Auflage gemachten »Judenhut« trägt.12 Jedoch wurde dieser Aspekt erst im christlich-jüdischen Dialog und in den Neubestimmungen der Erwählungs- und Israeltheologie der evangelischen Kirchen am Ende des 20. Jahrhunderts wahrgenommen.
In dem weiterführenden Grundlagentext »Kirche und Israel«, den sich alle Mitgliedskirchen der Leuenberger Kirchengemeinschaft (heute: Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa) auf der Vollversammlung in Belfast 2001 einstimmig zu eigen gemacht haben, heißt es kompakt dogmatisch formuliert:
»Das Bekenntnis ›Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich‹ schließt das Bekenntnis zur Person Jesu als des ›Christus‹, als des ›Sohnes Gottes‹ und als Inkarnation des schöpferischen Wortes Gottes ein (Joh 1,14). Dieser Gehalt des Glaubens an Jesus kommt in dem Bekenntnis zur Sprache: Jesus ist ›wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch‹ (vere Deus – vere homo). Dieses Bekenntnis hält den Gehalt des Inkarnationsglaubens nur dann fest, wenn das ›wahrhaft Mensch geworden‹ das ›wahrhaft Jude‹ unmittelbar und unverlierbar einschließt. Nicht ein beliebiger, sondern eben dieser Mensch – von Geburt Jude, Angehöriger des Volkes Israel, stammend aus dem Geschlecht Davids – ist zu Ostern als der Christus, als der Sohn Gottes offenbar geworden. Indem Gott den Juden Jesus als den wahren Zeugen des Kommens der Gottesherrschaft sichtbar macht, bezeugt er seine definitive Selbstbindung an Israel.«13
Das Osterereignis steht also weder im Kontrast zum historischen Jesus und zum Judentum, noch steht es in Kontinuität zu Jesus, aber im Kontrast zum Judentum. Sachgerecht ist es – aus christlicher Sicht – als Gottes Selbstbindung an Israel zu verstehen, vertieft und erweitert um die Erwählung der Kirche aus Israel und den Völkern. Die Erwählung der Kirche als Volk Gottes ist Erwählung mit Israel.14 Dies hat unter anderem Konsequenzen für Zeugnis und Mission: »Die Gemeinsamkeit des Zeugnisses von dem Gott Israels und das Bekenntnis zum souveränen Erwählungshandeln dieses Einen Gottes ist ein gewichtiges Argument dafür, daß sich die Kirchen jeglicher gezielt auf die Bekehrung von Juden zum Christentum gerichteten Aktivitäten enthalten.«15