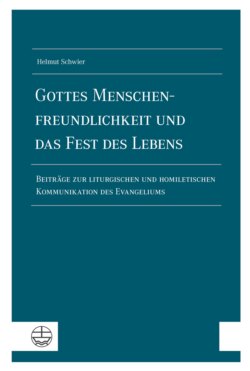Читать книгу Gottes Menschenfreundlichkeit und das Fest des Lebens - Helmut Schwier - Страница 56
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Theorien: Pluralität in der Exegese
ОглавлениеDie historisch-kritische Methode, so lernt man bereits im Proseminar, besteht aus einem Ensemble verschiedener Fragestellungen,66 die einander ergänzen, aber aus unterschiedlichen Ansätzen der Forschungsgeschichte zusammengewachsen sind.67 Die Pluralität ist also bereits in der klassischen Methode selbst verankert. Neuere Fragestellungen können und müssen, wollen sie diskursfähig bleiben, hier anknüpfen und Ergänzungen bringen: Soziologische und sozialgeschichtliche Forschungen fanden einen klaren Anknüpfungspunkt in der Frage nach dem »Sitz im Leben«, der nun konkreter, z. B. sozioökonomisch, bestimmt wurde; linguistische Analysen widmen sich vor allem dem Text in seiner Endgestalt, der infolge literarkritischer Entdeckungsfreuden mitunter verloren gegangen war. Zu dieser Pluralität tritt die Pluralität der sogenannten »engagierten Lektüreformen«68, also beispielsweise der christlich-jüdischen, der befreiungstheologischen, der feministischen, der psychotherapeutischen oder auch der fundamentalistischen Lektüren, sowie deren Konkurrenz untereinander und zur historisch-kritischen Exegese.
Die Pluralität in Exegese und Lektüreformen ist nicht deren Verhängnis, sondern deren Chance. Diese These sei zunächst erläutert. Im Anschluss an Gerd Theißen lässt sich formulieren: Exegetische Methoden sind »bewährte Dialogregeln über Texte, die Konsens ohne Zwang und Dissens ohne Feindschaft ermöglichen sollen«.69 Die Anwendung der exegetischen Methoden zielt auf die Eröffnung eines Spielraums von Auslegungen, nicht auf die Suche nach der einen richtigen Interpretation. Dazu gehören eine Grenzziehung gegenüber unangemessenen Auslegungen und eine Gewichtung der wahrscheinlichen Auslegungen; hier erweisen sich ExegetInnen als AnwältInnen der Texte. Grenzziehung und Gewichtung, Konsens- und Dissensfeststellungen werden argumentativ vorgenommen. Auch hier gibt es Vorverständnisse und der wissenschaftliche Diskurs ist nicht immer herrschaftsfrei, aber die Prämissen und Interessen können durch methodische Disziplin, durch die Beachtung des Kohärenz- und des Korrespondenzkriteriums,70 sowie durch die gegenseitige Kritik offengelegt und begrenzt werden. Deshalb kann man auch in einer exegetischen Proseminararbeit mit der Kraft eines Arguments sogar exegetischen »Staranwälten« widersprechen.
Während solch eine wissenschaftliche Exegese, die Auslegungspluralität ermöglicht, applikationsfern und identitätsoffen geschieht, also auf Verstehen statt auf Einverständnis gerichtet ist, prinzipiell von Christen wie von Atheisten betrieben werden kann, zielen die genannten »engagierten Lektüreformen« auf Anwendung, Identitätsbegründung und Änderung der Praxis. Deren Konkurrenz untereinander ist zudem härter als bei der wissenschaftlichen Exegese und an einigen Stellen auch nicht integrativ aufzulösen: Fundamentalistische Bibellektüre steht beispielsweise im Gegensatz zu den emanzipationsorientierten Lektüren, weil sie bereits die Möglichkeit jeglicher Sachkritik kategorisch ausschließt. Die Notwendigkeit der engagierten Lektüren ist nicht zu bestreiten. Denn sie eröffnen gerade verschiedenen Menschen und Gemeinschaften neue Zugänge zur Bibel und zeigen gleichzeitig eine große Nähe zur Parteilichkeit der biblischen Botschaft und zu deren Identifikationsangeboten.71
Wie steht es aber nun mit der Konkurrenz zur wissenschaftlichen Exegese? Zur Kennzeichnung dieser Beziehung hilft das bereits genannte Begriffspaar »Provokation und Korrektur«. Alle provokativen Gehalte der Lektüren müssen immer wieder an den Texten gezeigt und belegt werden können, um nicht in Ideologisierungen oder Projektionen zu enden. Als Anwältin des Textes muss die Exegese dabei ihres Amtes walten, den Text verteidigen und Auslegungen korrigieren.72 Die jüngste Geschichte des Faches belegt ihrerseits, welche produktiven Entwicklungen innerhalb der Exegese z. B. durch die christlich-jüdischen oder die feministischen Lektüren hervorgerufen, provoziert worden sind.73
Die hier favorisierte wissenschaftliche Exegese, die man »polyvalente Exegese« nennen kann,74 bietet Anschlussmöglichkeiten zu den pluralen engagierten Lektüreformen, zu den kerygmatheologischen Anwendungen, die die Hermeneutik über lange Zeit dominiert hat, zum interdisziplinären Vorgehen75 und auch zu den Ansätzen einer »Neuen Biblischen Theologie«, in der die Differenzen und Kontinuitäten nicht begrifflich eingeebnet werden, sondern die ihrerseits zu verständlicher Sprache und systematischer Orientierung verhelfen soll.76 Die polyvalente Exegese lässt sich ihrerseits durch Neues provozieren, hält aber selbst engagiert daran fest, dass ihr wichtigstes Ziel, das Verstehen, im Grunde zweckfrei ist, einen Wert in sich darstellt.77