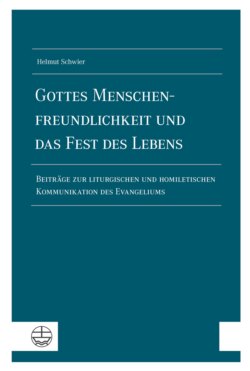Читать книгу Gottes Menschenfreundlichkeit und das Fest des Lebens - Helmut Schwier - Страница 53
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Theorie: Die Bibel in der Landschaft privater, kirchlicher und öffentlicher Religionskultur
ОглавлениеW. Steck entwirft PT als Wahrnehmungswissenschaft und stellt damit nach den Verständnissen der PT als Anwendungswissenschaft und als Handlungswissenschaft einen dritten Typ dar. Dieser dritte Typ wird in den praktisch-theologischen Standortbestimmungen und Theoriediskussionen derzeit allgemein favorisiert und unter den Leitperspektiven Phänomenologie (Failing / Heimbrock), Ästhetik (Grözinger) oder Semiotik (Meyer-Blanck) nur verschieden akzentuiert. Der Proklamation eines »Paradigmenwechsels« sollte man sich allerdings enthalten.10
Steck zielt auf die Gestalt »einer theoretisch ausgearbeiteten Topographie des zeitgenössischen Christentums« bzw. der »religiösen Lebenswelt«.11 Damit wird der seit Schleiermacher geltende Basissatz, dass PT »nicht Praxis, sondern Theorie der Praxis« ist, aufgenommen und umgesetzt, wobei der Praktischen Theologie Stecks eine intermediäre, also eine »zwischen Theorie und Praxis pendelnde Denkform«12 zugehört.
Die »Kartografierung« führt Steck zur Anlehnung an die wissenssoziologischen Theorien von A. Schütz, Th. Luckmann und P. L. Berger. Steck geht es um die Analyse der grundlegenden, teils hintergründigen und daher zu rekonstruierenden Strukturen der religiösen Lebenswelt,13 die im noch ausstehenden zweiten Band geboten werden sollen. Leitkategorien sind für Steck Individualisierung, Säkularisierung und Rationalisierung.14 Kartografierung und pendelnde Denkform erfordern weiche Übergänge von Praxis und Theorie und verbieten die Konfrontation oder Fremdbestimmung der Praxis durch steile und von außen kommende Begriffe. Die Leitkategorien Individualisierung, Säkularisierung und Rationalisierung scheinen dagegen geeignet für weiche Übergänge und für diagnostische Klärung. Mit ihrer Hilfe lässt sich Praxis verstehen, wie sie sich selbst beschreibt, und gleichzeitig taugen sie zur wissenschaftlichen Analyse und Reflexion.
Steck nimmt einerseits die drei Dimensionen Rösslers auf, mündet dann aber nicht in eine sektorielle Ausführung, die man Rössler vorwerfen kann, sondern versucht mit Recht die Wechselbeziehungen noch stärker zu berücksichtigen. Das soll dadurch gelingen, dass die drei Dimensionen immer wieder »überblendet«15 werden durch die Grundunterscheidung »privat – öffentlich«.16 Diese Grundunterscheidung, führt zu einer weitreichenden Konsequenz, die sich von Rössler deutlich unterscheidet. Das kirchliche Christentum bildet mit dem individuellen und dem öffentlichen Christentum nicht mehr eine Trias und wird infolge der »Überblendung« nicht mehr zu einer eigenen Grundgestalt neuzeitlichen Christentums; vielmehr ordnet es sich ein »in die Palette der vielfältigen, voneinander unterschiedenen und sich überschneidenden Praxishorizonte […], die mit Hilfe des dualen Interpretationsrasters rekonstruiert werden sollen«.17 Etwas einfacher ausgedrückt: Private und öffentliche Religionspraxis bilden das grundlegende Erkenntnis- und Verständnisraster, kirchliches Christentum wird hier je nachdem entsprechend einsortiert. Dass dies mit Stecks Leitkategorien Individualisierung und Säkularisierung konvergiert, dürfte deutlich sein.
Vier kritische Überlegungen sind hier anzumerken:
1.Die Grundunterscheidung »privat – öffentlich« finde ich hilfreich in den Beschreibungen und manchen Interpretationen. Aber sie kann leicht normativen Charakter bekommen und dieser Übergang muss zumindest als solcher erkennbar und überprüfbar sein.
2.Die Grundunterscheidung »privat – öffentlich« ist ein typisch neuzeitlichbürgerliches Phänomen; solche Phänomene, Konventionen und Konstrukte sind gerade nicht überzeitlich gültig.
3.Die genannte »Überblendung« führt bei Steck nicht zu einer »Ausblendung« des kirchlichen Christentums als aspektreiches Phänomen, tendiert aber zu dessen Marginalisierung, zumal in dem Aufrissschema des Gesamtentwurfs neben dem privaten und öffentlichen Christentum als gleichberechtigte dritte Größe nun plötzlich das »urbane Christentum« erscheint.18
4.Die bei Topografieherstellungen zweifellos notwendig engen Interdependenzen von Praxis und Theorie, Wahrnehmungen und Deutungen, Rekonstruktionen und Konstruktionen dürfen nicht zu bloßen Zirkelschlüssen führen.
Wie sieht nun die biblische Topografie des heutigen Christentums unseres Kulturkreises aus? Waren die Auswirkungen und Deutungen der Hausbibel nur in einem sehr großen Maßstab umrisshaft gezeichnet worden, ist dieser Landkartenausschnitt nun präziser zu erfassen. Peter Cornehl hatte bereits vor rund 30 Jahren dargestellt, dass die protestantische Bibelfrömmigkeit zwei unterschiedliche Grundtypen aufweist:19 einen biblizistisch-pietistischen Typ, der in dieser Frage immer wieder auch in Nähe zur konfessionellen Kirchlichkeit steht, und den bürgerlich-liberalen Typ einer ethisch-kulturell orientierten distanzierten Kirchlichkeit. Es lässt sich zeigen, dass die Bibel über lange Zeit in der literalen Kulturwelt des Bürgertums verankert war.20 Jedoch bedeutet dies – nimmt man wie Cornehl Schleiermachers kleine Erzählung »Die Weihnachtsfeier« als Interpretationsgrundlage hinzu – eben nicht die Präsenz der Bibel als Text, sondern als allgemeines Reservoir von Geschichten, Bildern und Einzelsprüchen, die mit der Erfahrung verbunden bürgerliche Kultur und Ethik bestimmen21 und ein »Medium gemeinsamer religiöser Kommunikation der Christen untereinander«22 bieten. Trotz Harnacks Rettungsversuch vor 100 Jahren ist gerade diese Bibelfrömmigkeit durch die historische Bibelkritik prinzipiell infrage gestellt worden. Als Text wird die Bibel in den pietistischen und konfessionalistischen Kreisen präsent gehalten. Hier verbinden sich andächtige Lektüre und gemeinschaftliche Auslegung – häufig durchaus in kritischer Abgrenzung zum pastoralen »Herrschaftswissen«. Dass hier das sog. Laienelement im Vordergrund stand, ist bleibend wichtig.
Die Hausbibel dient dem Einzelnen innerhalb der Familie oder Gruppe zur Erbauung, und zwar wird in den idealtypisch unterschiedenen Frömmigkeiten die Bibel als Text gelesen und ausgelegt, oder sie ist als Sprach- und Symbolreservoir kommunikativ präsent; in beiden Ausprägungen ist die gekannte, gelesene und ausgelegte Bibel ein überaus wichtiges Medium, denn sie dient der Identitätsvergewisserung und Kontinuitätssicherung des Protestantismus.23
Inzwischen gibt es einerseits verschiedenste Bibelarbeitsformen und -methoden, die offenbar wachsenden Zuspruch finden (von den klassischen Auslegungen in gemeindlichen Bibelstunden oder auf Kirchentagen über narrative Ausführungen und experimentelle Formen musikalischer Gestaltung bis zum Bibliodrama).24 Andererseits ist zwar vielleicht noch nicht das Ende des »Gutenbergzeitalters« gekommen,25 aber doch eine erkennbare Verschiebung von der literalen zur multimedialen Kulturwelt samt ihrem audiovisuell geprägten Erlebnisdesign und den nicht immer durchschaubaren Kommerzialisierungen. Wer kann bestreiten, dass die Bibel auf CD-ROM, multimedial ausgeführt oder der Chat im Internet neue Ausdrucks- und Lebensformen der Erbauung sind oder zumindest werden könnten?
Diese Entwicklung hat Rückwirkungen auf die Bibel als Bekenntnis- und Quellenbuch. Die Kartografierung als Bekenntnisbuch ist besonders betroffen, da dieses auch an der Plausibilität literaler Kommunikation hängt. Denn Lektionar und Kanzelbibel kennzeichnen die evangelische Predigt als Auslegung der Schriftlesung in öffentlicher Rede. Nicht nur das Verfertigen und Halten, auch das Hören solcher Auslegung einer Lesung will gelernt sein. Das Predigthören braucht eine längere Einübung und setzt daher, nachdem die Tradition des Kirchgangs keine Verbindlichkeit mehr beanspruchen kann, auf Einsicht und Akzeptanz solcher Textauslegung samt ihrer lebenspraktischen Bedeutung.
Ein aktuelles Beispiel: In den Berliner Zeitungen werden Gottesdienste und Predigten durchaus wahrgenommen und montags kritisch kommentiert. Über einen großen Gottesdienst im Berliner Dom berichteten verschiedene Zeitungen in langen Artikeln. In der Süddeutschen Zeitung kommentierte der Verfasser nach einer ausführlichen, teils zitatweisen Wiedergabe der Predigt abschließend: »Der protestantische Gottesdienst ist selbst an hohen Feiertagen intellektuell ungenügend und rituell unterentwickelt. Er vernachlässigt den aufgeklärten Besucher ebenso wie den, der an das Geheimnis glaubt.«26 Das Beispiel belegt neben der Kritik am Prediger auch die Notwendigkeit der Einübung in das Predigthören und die offenbar großen Barrieren, die das vielen sympathischen Zeitgenossen unglaublich erschweren. Auch hier liegt eine tiefere Ursache schwindenden Gottesdienstbesuchs, was gleichzeitig durch die relativ größere Akzeptanz von Gottesdiensten mit Erlebnisgehalten illustriert wird.27
Stecks Individualisierungsthese würde bedeuten, dass auch die Funktion als Bekenntnisbuch auf die Erbauung des Einzelnen zielt. Dafür spricht, dass sowohl Anfertigung, Präsentation und Rezeption der Kanzelrede individuelle Akte sind28 und individuelle Akzeptanz erfordern. Diese Akte erscheinen aber gleichzeitig als immer noch auch durch gemeinschaftliche Konvention geregelt, so dass hier wenigstens Individualität und Sozialität zusammenzukommen haben. Der Gefahr muss gewehrt werden, dass hier nur noch privatisiert wird und der Öffentlichkeitsanspruch verloren geht. Dass die Frage nach Privatheit und Öffentlichkeit des Christentums in Fokussierung auf die Kirchen eine fundamentale und gleichzeitig politisch aktuelle ist, füge ich nur als Nebenbemerkung an.29
Die Erklärungskraft der Individualisierungsthese Stecks ist wichtig, insofern sie die Individualisierungsgehalte der Bibel als Bekenntnisbuch offenlegt und verdeutlicht; sie ist jedoch begrenzt, insofern sie die Bedeutung von Gemeinschaften und Lebensverbänden ignoriert. Möglicherweise führt die »Überblendung« durch das genannte Dual »privat-öffentlich« gerade nicht zu einer neuen kritischen Perspektive auf die Leitkategorien »Individualisierung« und »Säkularisierung«, sondern zu deren bloßer Verdopplung.
Die Kartografierung der Bibel als Quellenbuch ergibt ein Ensemble historischer Karten. Die Funktion der Bibel im schulischen Religionsunterricht hat sich so in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach verändert.30 Nachdem die »Evangelische Unterweisung«31 mit der Einsicht in die schulisch zu begründende Notwendigkeit des Religionsunterrichts abgelöst wurde, empfahlen Ingo Baldermann und Gisela Kittel die Bibel als »Buch des Lernens« und stellten die Bedeutung der biblischen Sprache für gegenwärtiges Selbst- und Weltverstehen heraus. Hubertus Halbfas und Peter Biehl entwarfen unterschiedliche Modelle der Symboldidaktik, während der problemorientierte Religionsunterricht, an den Biehl positiv anschließt, biblische Themen und Texte dann aufgreift, »wenn sich in ihnen Probleme der gegenwärtigen Lebenswelt widerspiegeln, wenn sie exemplarischen Charakter für bestimmte Perspektiven der christlichen Tradition besitzen und wenn die darin ausgedrückten Sinngehalte den Interessen der Schüler(innen) in einer bestimmten Altersstufe entsprechen«.32 Die Schulbibel ist also nicht mehr selbstverständliches Unterrichts- und Bildungsmedium, sondern wird aufgrund didaktischer Überlegungen hin und wieder gewählt. Als Unterrichtsgegenstand werden dann verstärkt Erkenntnisse der historisch-kritischen Forschung berücksichtigt, was im Interesse der Stellung des Religionsunterrichts als ordentliches Unterrichtsfach zu begrüßen ist. Zur Zeit scheint man in der Praxis eher mit Mischformen des text- bzw. problemorientierten Unterrichts zu experimentieren, in denen auch die emotionalen und aktionalen, kommunikativen und meditativen Komponenten des Lernens neue Zugänge zur Bibel eröffnen.33 Dabei ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass auch die biblischen Symbole interpretationsbedürftig sind.34
Eine auch nur annähernd befriedigende Topografie der kritischen Bibelwissenschaft kann hier nicht geboten werden – nicht einmal unter der uns jetzt beschäftigenden Fragestellung der praktisch-theologischen Reflexion der Bibelfrömmigkeit. Ein exemplarischer Eckpunkt sei zunächst aber genannt.
Da schreibt ein junger Privatdozent aus seiner Universitätsstadt an eine mütterliche Vertraute im Heimatort: »Wenn die Wasser der Kritik, ich meine der historischen, mir hoch zu gehen anfangen, und ich darf sie doch nicht dämpfen – dann rette ich mich nach dieser leider notwendigen Sintflut auf die einfachen und großen Felsen: ich sinne über das Vaterunser nach, diesem übermächtigen Schatze, oder ich lese jene Abschnitte der Bibel, die ich immer verstanden habe, und die Jeder versteht. […] Von hier allein aus kann die schwankende Waage wieder in stilles Gleichgewicht gebracht werden.«35
Ein erstaunliches Bekenntnis dieses jungen 24-jährigen Theologen, der später einer der letzten großen Universalgelehrten werden wird: Adolf von Harnack. Die Bibel gerät bei ihm, wie Cornehl gezeigt hat,36 in eine Doppelrolle: sie ist Mittel der Affirmation und Gegenstand historischer Forschung; sie enthält für jeden unmittelbar zugängliche religiöse Gewissheiten undübergeschichtliche Wahrheiten, die einem Rettungsfelsen im Meer gleichen, und sie erfordert kritische Untersuchungen, um das Fremde und Anstößige zu entlarven. In seiner epochalen Vorlesungsreihe über das »Wesen des Christentums« kehrt diese Doppelrolle übrigens wieder: Die Religion Jesu, konzentriert in den Vorstellungen von Gott, dem Vater und dem unendlichen Wert der Menschenseele,37 und damit Kern jeder echten Religion, bietet den Rettungsfelsen, von dem aus auch die historische Kritik zwar konsequent, aber wenig bedrohlich betrieben werden kann. Dass die Kritik dagegen konsequenter und folgenreicher zu betreiben ist, haben Albert Schweitzer an der damaligen Jesusforschung und Rudolf Bultmann für die neutestamentliche Theologie insgesamt gezeigt. Damit zerbrach eigentlich die Möglichkeit, die schwankende Waage auf diese Weise wieder in ein stilles Gleichgewicht zu bringen. Theologie und Kirche täten den Christenmenschen einen falschen Dienst, würden sie diesen Weg zur Balance heute empfehlen. Diese Topografie gehört zwar der Vergangenheit an, wirkt aber bis heute.