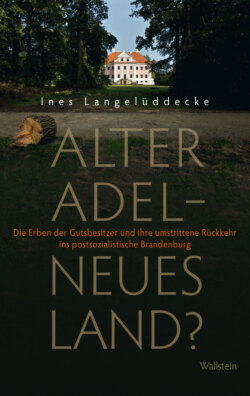Читать книгу Alter Adel - neues Land? - Ines Langelüddecke - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Perspektiven über das Gutsdorf hinaus
ОглавлениеIn der ständischen Gesellschaft unterschieden sich die Horizonte von Adligen und Dorfbewohnern. Während die Leute im Dorf ihren Arbeits- und Besitzverhältnissen entsprechend in unterschiedlicher Weise auf den Gutsbesitzer als Arbeitgeber und als dörfliche Autoritätsperson bezogen waren, waren die Adligen in Netzwerke eingebunden, die über das Gutsdorf hinausreichten. Als Folge des mittelalterlichen Lehnswesens standen die Adelsfamilien als sozial abgeschlossene Gruppe untereinander und zum preußischen König in enger Beziehung. Der Berliner Königshof war bis zum Ende der Monarchie 1918 ein Ort kultureller Repräsentation wie auch der politischen Lobbyarbeit, den die adligen Gutsbesitzer für ihre Interessen nutzen konnten, beispielsweise wenn es um die von ihnen geforderten Schutzzölle für Getreide ging. Über die Erste Kammer des preußischen Abgeordnetenhauses verfügte der Adel bis 1918 über eine direkte politische Einflussmöglichkeit.[17] Adlige Männer verfolgten häufig Laufbahnen im preußischen Militär und konnten sich so Karrierewege eröffnen, die aus dem Gutsdorf hinausführten.[18] Über ihre spezifischen Netzwerke waren die Adligen in größere regionale Zusammenhänge eingebunden. Zudem verfügten sie durch die Vorstellung einer generationenübergreifenden Familientradition über zeitliche Horizonte, die zumeist länger in die Vergangenheit zurückreichten als die üblichen Vorstellungswelten der Dorfbewohner. Je stärker der Adel im 19. und 20. Jahrhundert gesellschaftlichen Abstiegstendenzen ausgesetzt war, umso wichtiger wurde es für seine Angehörigen, diesen innerfamiliären Zusammenhalt zu stärken und sich dadurch als herausgehobener Stand nach außen hin abzugrenzen.[19]
Das Ende der Monarchie, die politischen Veränderungen der Weimarer Republik, die Inflation und die Weltwirtschaftskrise verstärkten in den adligen Familien die Wahrnehmung eines rapiden gesellschaftlichen und teilweise auch sozialen Abstiegs. Das konnte wiederum zu einem Interesse an und einer Hinwendung zur nationalsozialistischen Ideologie führen. So war in der NSDAP der Adel bereits im Januar 1933 überrepräsentiert.[20] Dabei waren es weniger die vermögenden Gutsbesitzer als die verarmten, sozial destabilisierten Teile des Kleinadels, die diesen politischen Radikalisierungsprozess vorantrieben.[21] Die meisten brandenburgischen Gutsbesitzer ließen nach dem Umbruch von 1918 eine offen republikfeindliche, monarchistische Gesinnung erkennen. Institutionell schlug sich diese in der Mitgliedschaft in der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) oder im Stahlhelm – Bund der Frontsoldaten nieder.[22] Neben der anfänglichen Begeisterung für den Führer speiste sich aus dieser (Selbst-)Wahrnehmung einer gesellschaftlich abgeschlossenen Gruppe mit ausgeprägtem Sendungsbewusstsein, das über die Gegenwart hinausreichte, aber auch der adlige Widerstand gegen Hitler bezog sich darauf.[23] Das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 war vor allem von adligen Offizieren vorbereitet und ausgeführt worden, die sich aus vielfältig verwobenen Freundes- und Familienkreisen kannten und die für ihre Aktivitäten adlige Netzwerke in Anspruch nehmen konnten.[24] Als ländliche Bastionen adliger Herrschaft und gesellschaftlicher Vorrangstellung waren die Adelsgüter von den Nationalsozialisten weitgehend unangetastet gelassen worden und boten damit eine Ausgangsbasis für die Organisation des Widerstands, der zum Attentat auf Adolf Hitler führte.[25]