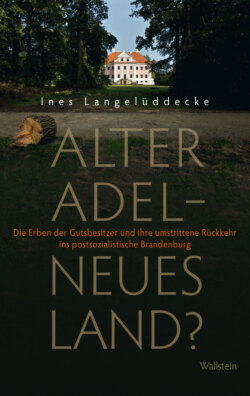Читать книгу Alter Adel - neues Land? - Ines Langelüddecke - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der »Junker« als Figur der Kritik im 19. und 20. Jahrhundert
ОглавлениеParallel zur allmählichen Abschaffung der ständischen Privilegien seit Beginn des 19. Jahrhundert veröffentlichten Publizisten und Wissenschaftler wie Hugo Preuß, Max Weber oder Ferdinand Tönnies in der Zeit des Kaiserreichs verschiedene Schriften, in denen die »Junker« in den Fokus ihrer politisch linksliberal motivierten Kritik gerieten. So schrieb Preuß 1897:
»Alle Versuche, das Junkertum in einen modernen, politischen Adel zu verwandeln, mussten und müssen fruchtlos sein. Man kann einer sozialen Gruppe nicht ihre spezifischen Existenzbedingungen nehmen, ohne sie selbst aufzulösen. Und die Existenzbedingungen dieses Junkertums wurzeln ein für allemal in rückständigen Wirtschaftsformen.«[26]
Weber und Tönnies lasteten den »Junkern« zudem an, dass sie durch ihre Interessenpolitik die Entwicklung des Kaiserreichs von einem Agrar- zu einem Industriestaat blockierten. Vor allem kritisierten sie die Bildung der Fideikommisse als privilegierte Besitzform, mit der die Adelsfamilien ihren Landbesitz der Marktkonkurrenz entzogen.[27]
Einen administrativ-politischen Ausdruck fand die Junkerkritik mit der Auflösung Preußens 1947, aber vor allem mit der Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone 1945 als einer grundlegenden gesellschaftlichen Umwälzung. Diese politischen Weichenstellungen bildeten den Abschluss eines Entwicklungsprozesses, in dem seit dem 19. Jahrhundert die adligen Gutsherren immer weiter an Macht und Einfluss verloren hatten. Die Alliierten begründeten die Auflösung Preußens im Kontrollratsgesetz Nr. 46 vom 25. Februar 1947 damit, dass Preußen »seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland gewesen ist«.[28] Auf ähnliche Weise hatte das führende KPD-Mitglied Anton Ackermann am 14. Juni 1945 den Aufruf der KPD zur Bodenreform erläutert. Darin forderte Ackermann dazu auf,
»gleichzeitig mit der völligen Vernichtung der Überreste des Hitlerstaates und der Hitlerpartei den reaktionären Schutt aus der Vergangenheit hinwegzuräumen, den die feudalen Überreste darstellen, vor allem der reaktionäre preußische Militarismus mit allen seinen ökonomischen und politischen Ablegern«.[29]
In der DDR wurde die Anti-Junker-Propaganda zur offiziellen politischen Leitlinie, mit der die Bodenreform legitimiert und die ländliche Bevölkerung in den neugegründeten sozialistischen Staat integriert werden sollten.[30] Auch im westlichen Teil Deutschlands wurden die Adligen als Führungsschicht des preußischen Staates zu den Hauptschuldigen des Zweiten Weltkriegs erklärt, so etwa in der 1946 erschienenen Schrift »Die deutsche Katastrophe« des Historikers Friedrich Meinecke.[31] Weitergeführt und zugespitzt wurde diese Deutung dann in der These des »deutschen Sonderwegs« von einer jüngeren bundesrepublikanischen Historikergeneration in den 1960er und 1970er Jahren, die damit vor allem an die Forschungen des in der NS-Zeit in die USA emigrierten deutsch-jüdischen Historikers Hans Rosenberg anknüpfte.[32] Rosenberg beendete seine 1978 erschienenen Ausführungen über »Die Pseudodemokratisierung der Rittergutsbesitzerklasse« damit, dass er deren »Helfersdienste bei der Heraufbeschwörung der deutschen Katastrophe und in ihrem Gefolge die historische Vernichtung des ostdeutschen Gutsbesitzertums« feststellte und mit den Worten schloss: »Wer möchte wohl ernsthaft daran glauben, dass im Falle einer deutschen Wiedervereinigung im westlichen Sinne die ostelbische Rittergutsbesitzerklasse wiederauferstehen würde?«[33] Mit diesen Überlegungen sollte Rosenberg recht behalten. Den Nachfahren der Gutsbesitzer wurde 1990 ihr ehemaliger Familienbesitz nicht restituiert.