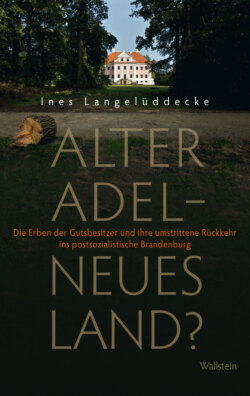Читать книгу Alter Adel - neues Land? - Ines Langelüddecke - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Rückblende I: Die vertriebenen Adligen und ihre soziale Situation seit 1945
ОглавлениеDie allermeisten der enteigneten brandenburgischen Adelsfamilien waren 1945 aus der sowjetisch besetzten Zone geflüchtet. Sie gehörten damit zu den ungefähr 14 Millionen vertriebenen Deutschen nach 1945.[48] Mit der Ankunft in den westlichen Besatzungszonen war häufig ein sozialer Abstieg der vormals landbesitzenden und vermögenden Adelsfamilien verbunden. Schwierigkeiten bei der Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche sowie Versorgungsengpässe bei Nahrungsmitteln und Heizmaterial bestimmten die ersten Nachkriegsjahre. Der Rückgriff auf adlige Netzwerke und Verwandtschaftsbeziehungen konnte die Etablierung im Westen erleichtern, dennoch hatten gerade Vertriebene mit einer landwirtschaftlichen Berufsausbildung in der stärker auf die Industrie ausgerichteten Wirtschaft in den westlichen Besatzungszonen häufig einen schweren Start.[49] Eine finanzielle Unterstützung durch staatliche Stellen erhielten die geflohenen brandenburgischen Gutsbesitzer in den allermeisten Fällen vorerst nicht. Lediglich die Gutsbesitzer aus der Neumark, dem Teil Brandenburgs östlich der Oder-Neiße-Grenze, gehörten rechtlich gesehen zu den Vertriebenen aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches. Diese Gruppe hatte ab 1952 Anspruch auf den sogenannten »Lastenausgleich«. Die Vertriebenen erhielten in der Bundesrepublik Sozialleistungen, Renten und eine Entschädigung für das verlorene Vermögen.[50] Die meisten der brandenburgischen Gutsbesitzer hatten jedoch in dem Teil Brandenburgs gelebt, der ab 1945 zur sowjetischen Besatzungszone gehörte, und waren deswegen anfangs vom Lastenausgleich ausgenommen.[51] Erst mit der Novellierung des Lastenausgleichsgesetzes von 1965 wurde die ungleiche Behandlung der Flüchtlinge aus der SBZ/DDR aufgehoben. Die ersten Entschädigungszahlungen erhielten die früheren Gutsbesitzer allerdings erst ab 1971 – und damit mehr als 25 Jahre nach ihrer Enteignung. Bei der Entschädigung des verlorenen Vermögens wurde der Einheitswert von 1935 zugrunde gelegt. Die so ermittelten Grundbeträge wurden nur bis zur Höhe von 4.800 Reichmark (RM) vollständig in Deutsche Mark (DM) entschädigt, bei Eigentum im Wert von bis zu 100.000 RM verminderte sich die Entschädigung auf ungefähr 25 % des Grundbetrags und bei Schäden über einer Million Reichsmark lag die Entschädigung nur noch bei ungefähr 6,5 % des enteigneten Vermögens.[52]
Die ersten Auszahlungen an die Enteigneten der Bodenreform von 1945 erfolgten während der sozialliberalen Koalitionsregierung unter Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) und damit in einer Zeit, als die DDR und die Bundesrepublik zum ersten Mal seit ihrer Gründung 1949 über zwischenstaatliche Abkommen verhandelten. Mit dem sogenannten Grundlagenvertrag vom November 1972 zwischen beiden deutschen Staaten war die Anerkennung der Zweistaatlichkeit verbunden. Zwar war in der Präambel des Lastenausgleichsgesetzes der ausdrückliche Vorbehalt festgeschrieben, »dass die Gewährung und Annahme von Leistungen keinen Verzicht auf die Geltendmachung von Ansprüchen und Rückgabe des von den Vertriebenen zurückgelassenen Vermögens bedeutet«.[53] Trotzdem hießen die Entschädigungszahlungen in den frühen 1970er Jahren für die enteigneten Gutsbesitzer-Familien zweierlei: zum einen die späte gesetzliche Anerkennung des individuellen Eigentumsverlustes – und zum anderen die zunehmende Delegitimierung von Rückkehrhoffnungen auf die früheren Güter in einer Zeit, in der mit der politischen Akzeptanz der Zweistaatlichkeit die Aufhebung der deutschen Teilung in immer weitere Ferne gerückt war.