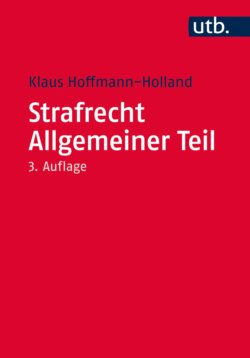Читать книгу Strafrecht Allgemeiner Teil - Klaus Hoffmann-Holland - Страница 64
|65|b) Späterer Erfolgseintritt
Оглавление185Beachtliche Schwierigkeiten bereiten Konstellationen, in denen der Täter glaubt, den erstrebten Erfolg schon erreicht zu haben, dieser aber tatsächlich erst durch eine spätere Handlung herbeigeführt wird. Erstmals relevant wurde diese Problematik in der viel zitierten Jauchegruben-Entscheidung des BGH[194], der folgender Fall zu Grunde lag: A würgte die O mit bedingtem Tötungsvorsatz und stopfte ihr zwei Hände voll Sand in den Mund, um sie am Schreien zu hindern. O lag schließlich regungslos da und wurde von A für tot gehalten. A warf die vermeintliche Leiche in eine Jauchegrube. Erst dadurch erstickte O, die bis dahin nur bewusstlos gewesen war.
186Problematisch ist in den Fällen des späteren Erfolgseintritts zunächst die objektive Zurechnung des Erfolges und insbesondere die Frage, ob sich in diesem die vom Täter geschaffene Gefahr realisiert hat. Da die Verursachung einer Bewusstlosigkeit aber durchaus die Gefahr schafft, dass der Bewusstlose für tot gehalten und im Rahmen der Beseitigung der vermeintlichen Leiche ums Leben gebracht wird, ist die objektive Zurechnung im Jauchegruben-Fall und in vergleichbaren Konstellationen regelmäßig zu bejahen.[195]
187Im Bereich des subjektiven Tatbestandes erscheint demgegenüber fraglich, ob der Täter mit dem erforderlichen Vorsatz gehandelt hat, da er in dem Zeitpunkt, in dem er die tatsächlich zum Erfolg führende Handlung vorgenommen hat, davon ausging, dass der Erfolg bereits eingetreten ist. Nach der älteren Lehre vom dolus generalis[196] sollen die beiden Einzelakte einen einheitlichen Geschehensablauf darstellen, so dass der zunächst bestehende Vorsatz des Täters auch während der zum Erfolg führenden Handlung fortwirkt. Nach dieser Auffassung wäre A im Jauchegruben-Fall nach § 212 Abs. 1 StGB zu bestrafen, da der im Zeitpunkt des Würgens bestehende Tötungsvorsatz auch noch im Zeitpunkt des Werfens der vermeintlichen Leiche in die Jauchegrube fortbestünde. Demgegenüber geht eine beachtliche Auffassung in der Literatur davon aus, dass die beiden Teilakte des Geschehens selbständig zu bewerten seien, mit der Folge, dass der Vorsatz erlösche, sobald der Täter annimmt, dass der tatbestandliche Erfolg eingetreten ist. Da er dann in demjenigen Zeitpunkt, in dem er den Erfolg tatsächlich herbeiführt, nicht mehr vorsätzlich handelt, sei er nicht aus einem vollendeten Vorsatzdelikt zu bestrafen.[197] Nach dieser Auffassung hätte sich A im Jauchegruben-Fall nicht nach § 212 Abs. 1 StGB strafbar gemacht, sondern wegen versuchten Totschlags gemäß §§ 212 Abs. 1, 22, 23 Abs. 1 StGB (durch das Würgen) in Tatmehrheit mit fahrlässiger Tötung gemäß § 222 StGB (durch das Werfen in die Jauchegrube).
188Der BGH überträgt demgegenüber die von ihm entwickelten Grundsätze zum Irrtum über den Kausalverlauf auch auf die Konstellation des späteren Erfolgseintritts und kommt hierdurch in der Regel zur Bejahung des Tatbestandsvorsatzes|66|.[198] Auch im Jauchegruben-Fall nahm er an, dass es sich im Rahmen des nach allgemeiner Lebenserfahrung Voraussehbaren bewege, wenn ein irrtümlich für tot gehaltenes Opfer erst durch die Beseitigungshandlung ums Leben kommt. Da auch keine andere Bewertung der Tat geboten sei, läge eine unwesentliche Abweichung des Kausalverlaufs vor, mit der Folge, dass sich A wegen eines vorsätzlich begangenen, vollendeten Tötungsdelikts strafbar gemacht habe.