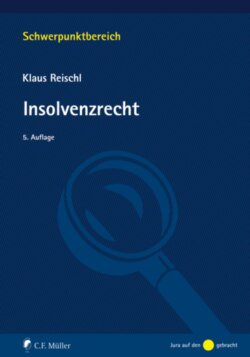Читать книгу Insolvenzrecht - Klaus Reischl - Страница 77
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Exkurs: Die Tätigkeiten des vorläufigen Verwalters
Оглавление155
Die Tätigkeiten des vorläufigen Verwalters sind davon geprägt, dass es in der Regel einen laufenden Geschäftsbetrieb gibt. Nicht nur der starke, sondern auch der schwache vorläufige Insolvenzverwalter (mit Zustimmungsvorbehalt) ist zur Sicherung und Erhaltung des Vermögens des Schuldners im Sinne von § 22 Abs. 1 S. 2 Nr 1 InsO bis zur Eröffnung des Verfahrens verpflichtet; er kann dem aber nur im Rahmen der Befugnisse nachkommen, die ihm das Gericht gem. § 21 InsO eingeräumt hat[40]. Neben der Ermittlung, Aufzeichnung und Sicherung der künftigen Masse sowie der Vorbereitung einer Sanierung hat auch der vorläufige Verwalter in aller Regel dafür zu sorgen, dass das Unternehmen weiter läuft, damit kein Wertverfall vor Insolvenzeröffnung eintritt. Pragmatisch müssen die Versorgungs- und Lieferdienste (Strom, Telefon, Rohstoffe) wieder in Gang gesetzt, die Arbeitnehmer beruhigt und die Gläubiger kontaktiert werden. Im Hinblick auf spätere Anfechtungen wird er den Gläubigern, vor allem Banken, Sozialversicherungs- und Finanzbehörden, den Insolvenzantrag mitteilen und dessen Kenntnisnahme dokumentieren (erforderlich zum Nachweis der Kenntnis für eventuelle Insolvenzanfechtungen, vgl § 130 Abs. 1 S. 1 Nr 2 InsO).
156
Der zur Betriebsfortführung verpflichtete starke vorläufige Verwalter (§ 22 Abs. 1 S. 2 Nr 2 InsO) hat umgehend die laufenden Geschäfte anhand von Deckungsrechnungen auf Rentabilität zu prüfen und defizitäre Verträge abzulehnen oder Kündigungen auszusprechen, um die Masse nicht zu schmälern. Der schwache Verwalter wird in enger Abstimmung mit dem Schuldner entsprechend vorgehen und diesen von der Eingehung unrentabler Verträge abzuhalten versuchen sowie frühzeitig die Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen prüfen. Eine Betriebsstilllegung darf der vorläufige Insolvenzverwalter nur in Ausnahmefällen veranlassen[41], nämlich wenn der Betrieb so defizitär operiert, dass jedes Weiterwirtschaften die Masse schmälern würde[42] und das Insolvenzgericht der Schließung zustimmt (§ 22 Abs. 1 S. 2 Nr 2 InsO); der Entscheidung der Gläubigerversammlung als Herrin des eröffneten Verfahrens soll möglichst nicht vorgegriffen werden, § 157 S. 1 InsO. Ebenso unzulässig sind Verwertungshandlungen, wenn sie die Grenze der erlaubten Verwaltungstätigkeit überschreiten, also in die betriebsnotwendige Substanz eingreifen[43]. Etwas anderes gilt, wenn sich die Stilllegung bereits abzeichnet und sich gute Veräußerungsgelegenheiten ergeben. Als Maßstab zur Abgrenzung bietet es sich an, darauf abzustellen, ob ein ordentlicher Kaufmann in einer vergleichbaren Situation ebenso gehandelt hätte[44]. Die Zustimmung des Schuldners genügt nicht, insoweit ist in Anlehnung an § 22 Abs. 1 S. 2 Nr 2 InsO die gerichtliche Zustimmung erforderlich[45]. Es empfiehlt sich zudem die vorbereitende Einbeziehung eines etwaigen vorläufigen Gläubigerausschusses, vgl §§ 22a, 160 InsO. Der Einzug von (auch nicht zedierter) Forderungen wird bei vorläufiger Insolvenzverwaltung regelmäßig als zusätzliche Maßnahme gemäß § 21 Abs. 1 S. 1 InsO angeordnet (vgl auch § 21 Abs. 2 S. 1 Nr 5 InsO); der Verwalter hat hierfür ein gesondertes Treuhandkonto einzurichten, die Drittschuldner zu informieren und zu mahnen.
157
Eine entscheidende Rolle im Insolvenzeröffnungsverfahren spielt die Sicherung der Bezahlung der Arbeitnehmer. Sobald hier Rückstände entstehen, ist erfahrungsgemäß mit passiver Haltung bis hin zur Arbeitsniederlegung oder Kündigung zu rechnen. Die Arbeitslöhne sind zwar durch eine Umlage gesichert, die von allen Betrieben erhoben und über die Agentur für Arbeit als sog. Insolvenzgeld ausbezahlt wird. Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Bezugszeitraum jedoch auf drei Monate begrenzt, ferner entsteht der Anspruch erst nach Verfahrenseröffnung, jeweils rückwirkend für die drei letzten unbezahlten Monate des jeweiligen Arbeitsverhältnisses (s Rn 405, 559). Dieser Zeitraum kann also auch längere Zeit zurück liegen, beispielsweise wenn der Arbeitnehmer zwischenzeitlich den Betrieb verlassen hat. Vielfach ist es so, dass die Liquidität des Unternehmens im vorläufigen Insolvenzverfahren keine Auszahlung der Arbeitslöhne erlaubt, weil diese erst durch Produktion und Warenabsatz erwirtschaftet werden müssen und Kreditmittel grundsätzlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Um den Zeitraum bis zur Insolvenzeröffnung für das Bestandspersonal zu überbrücken (und damit die Sanierung des Betriebs zu ermöglichen), hat sich in der Praxis die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes durch den vorläufigen Insolvenzverwalter als Maßnahme zur Liquiditätssteigerung etabliert. Dabei vermittelt der vorläufige Insolvenzverwalter über eine Bank den darlehensfinanzierten Ankauf der späteren Insolvenzgeldansprüche der Arbeitnehmer; dabei treten die Arbeitnehmer ihre Ansprüche auf Insolvenzgeld ab und erhalten im Gegenzug die jeweiligen Nettolöhne sofort von der Bank ausbezahlt, die nach Eröffnung direkt mit der Agentur für Arbeit abrechnet, so dass das Darlehen zurückgeführt wird. Der Betrieb kann somit während des Eröffnungsverfahrens ohne Personalkosten arbeiten, die (spätere) Insolvenzmasse wird dann nur mit der Verzinsung der Arbeitslöhne für den (maximal dreimonatigen) Vorfinanzierungszeitraum belastet. Es ist aber zu beachten, dass dieses Sanierungsinstrument nur greift, wenn die Löhne nicht schon vor Antragstellung rückständig sind, da der Bezugszeitraum auf drei Monate begrenzt ist; in der Praxis ist dies regelmäßig der Fall, so dass der Insolvenzgeldzeitraum entsprechend kürzer ist. Ferner muss die Agentur für Arbeit der Vorausabtretung gegen Vorfinanzierung zustimmen (§ 170 Abs. 4 SGB III), was sie macht, wenn ein qualifiziertes Sanierungskonzept mit dem Ziel des Arbeitsplatzerhalts vorgelegt werden kann. In der Praxis erfordert dieses (verfehlte[46]) Zustimmungserfordernis eine schnelle Abstimmung zwischen dem Verwalter und der zuständigen Zweigstelle der Agentur für Arbeit. Im eröffneten Verfahren sind die Löhne grundsätzlich voll aus der Masse zu bezahlen (vgl Rn 560).
158
Der vorläufige Insolvenzverwalter muss an das Gericht berichten, sobald er die Prüfung der Deckung der Verfahrenskosten, der Begründetheit des Antrags sowie der Fortführungsaussichten[47] beendet hat, § 22 Abs. 1 S. 2 Nr 3 InsO. Dazu hat er einen Schlussbericht anzufertigen und, falls er parallel als Sachverständiger beauftragt war, ein Sachverständigengutachten zu erstellen. Nach Abschluss des vorläufigen Verfahrens muss er gem. §§ 21 Abs. 2 S. 1 Nr 1, 66 InsO Schlussrechnung legen.
159
[Bild vergrößern]
§ 4 Das Insolvenzeröffnungsverfahren › III. Sonstige Sicherungsmaßnahmen