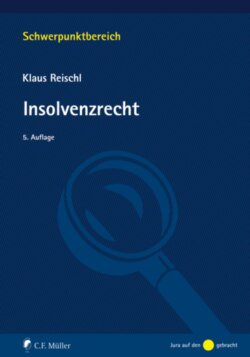Читать книгу Insolvenzrecht - Klaus Reischl - Страница 78
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. Sonstige Sicherungsmaßnahmen
Оглавление160
Die weiteren Sicherungsmaßnahmen sollen vorrangig den vorläufigen Insolvenzverwalter dabei unterstützen, die Gefahr der Masseschmälerung abzuwehren. Dazu gehört vor allem die Einsetzung eines vorläufigen Gläubigerausschusses, § 22a InsO. Neben dem bereits erwähnten Forderungseinzug wird häufig die Einstellung der Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen angeordnet, § 21 Abs. 2 S. 1 Nr 3 InsO (§ 775 Nr 2 ZPO; zum unbeweglichen Vermögen siehe § 30d Abs. 4 ZVG). Im vorläufigen Insolvenzverfahren soll der Status quo aufrechterhalten werden, damit der vorläufige Verwalter ungestört von Einzelzugriffen die Insolvenzreife und Sanierungswürdigkeit des Unternehmens untersuchen kann. Die Einstellungswirkung gilt deswegen nicht nur für die Herausgabevollstreckung der zur Aussonderung berechtigten Vorbehaltseigentümer, sondern auch für absonderungsberechtigte Sicherungseigentümer[48].
161
Nach Bekanntwerden der Insolvenzantragstellung gehen v.a. die Leasinggeber, Eigentumsvorbehaltsverkäufer und Rohstofflieferanten des Schuldners dazu über, ihre Rechte schnellstmöglich durchzusetzen und ihre Realisierbarkeit zu sichern. Ein Betrieb als lebensfähige Wirtschaftseinheit kann dadurch schnell zum Erliegen kommen. Um einen umfassenden Schutz des Betriebswertes zu erreichen, kann das Insolvenzgericht ein Verwertungs- und Einziehungsverbot im Sinne von § 21 Abs. 2 S. 1 Nr 5 InsO für diejenigen Gegenstände und Forderungen anordnen, die für den Betrieb unerlässlich, aber mit Aus- oder Absonderungsrechten belastet sind. Damit das Gericht die Erforderlichkeit zur Fortführung des Betriebs beurteilen kann, ist es auf sachdienliche Angaben des Sachverständigen oder vorläufigen Insolvenzverwalters angewiesen, von dem die Anregung zum Erlass des Beschlusses ohnehin regelmäßig kommt. Dabei ist auf eine konkrete Individualisierung der erfassten Gegenstände zu achten, eine pauschale Anordnung (etwa die bloße Zitierung des Gesetzestextes) ist nicht ausreichend, weil die Reichweite des Beschlusses dann weitgehend im Ermessen des Schuldners bzw des vorläufigen Insolvenzverwalters steht[49]. Dieser Beschluss berührt zwar nicht den Bestand der jeweiligen Verträge, aber die zwischen Schuldner und Gläubigern bestehenden Vertragsregelungen werden vorübergehend außer Kraft gesetzt, vor allem bewegliche Sachen wie Betriebsfahrzeuge und Produktionsmaschinen können zweckgemäß verwendet, Umlaufvermögen veräußert und Betriebsmittel verbraucht werden[50]. Grundstücke sind ebenfalls vom Gesetzeswortlaut erfasst, so dass gemietete Betriebsgrundstücke weiter genutzt werden können, ohne dass der Vermieter sein Vermieterpfandrecht geltend machen kann; auf diese Weise kann auch der Widerspruch gegen die Entfernung von Gegenständen (§ 562a BGB) entkräftet werden. Solche Maßnahmen sind sachlich geboten, um die Lebensgrundlage des Betriebes zu erhalten, denn in Krisenunternehmen ist das Inventar regelmäßig mit Drittrechten (Eigentumsvorbehalt, Leasing, Sicherungsübereignung) belastet und der Forderungsbestand einer Globalzession der Bank oder einer Sicherungsabtretung aufgrund eines verlängerten Eigentumsvorbehalts der Lieferanten verhaftet.
162
Die während der Sperrzeit laufenden Vertragszahlungen (Leasinggebühr, Mietzins) werden als bloße Insolvenzforderungen behandelt. Als Kompensation wird dem Betroffenen zwar eine den geschuldeten Vertragszahlungen entsprechende Nutzungsausfallentschädigung zugesprochen, die jedoch gemäß §§ 21 Abs. 2 S. 1 Nr 5, 169 S. 2 InsO erst ab drei Monaten nach Erlass der Anordnung als Masseverbindlichkeit zu laufen beginnt[51]. Für den Sperrzeitraum besteht (sowohl für Ab- als auch für Aussonderungsberechtigte) zumindest ein Anspruch auf Ausgleich des Wertverlustes für eine etwaige zwischenzeitliche Verschlechterung, beispielsweise aufgrund übermäßiger Abnutzung oder Beschädigung, der als Masseanspruch voll zu befriedigen ist[52]. Um dies zu vermeiden, sollte der vorläufige (schwache) Insolvenzverwalter die verschlechterten oder beschädigten Gegenstände vor Insolvenzeröffnung zurückgeben. Als Konsequenz der Überlagerung der vertraglichen Regelungen durch die gerichtliche Anordnung nebst dreimonatiger Suspendierung der Zinszahlung muss die Nichtzahlung den Verzugseintritt im Sinne von § 112 Nr 1 InsO hindern, da die Masse andernfalls zur Nachzahlung erheblicher Beträge verpflichtet wäre, um eine Kündigung und Herausgabeklage nach Verfahrenseröffnung zu vermeiden.
163
Als weitere Kataloganordnung ist die Postsperre (§§ 21 Abs. 2 S. 1 Nr 4, 99 InsO) zu nennen, die umfassend zu verstehen ist und damit auch den E-Mailverkehr betrifft[53], den man aber kaum kontrollieren kann[54]. Das Kostenrisiko der Sperre, beispielsweise für den Nachsendeauftrag an den vorläufigen Verwalter, trägt unter Umständen der Verwalter[55]. Bei Erlass der Postsperre ist aber der erhebliche Begründungsaufwand zu beachten, der aus verfassungsrechtlichen Gründen (Art. 10 GG) auch nicht in der Beschwerdeinstanz nachgeholt werden kann, denn das Begründungserfordernis dient der Selbstüberprüfung des Gerichts und dem Schutz vor automatisierten Anordnungen[56]. Die Durchsuchung der Geschäftsräume darf auch ohne ausdrücklichen Beschluss erfolgen, weil bereits der Eröffnungsbeschluss als Anordnung im Sinne von Art. 13 Abs. 2 GG anzusehen ist[57]. Bezüglich der Privaträume bedarf es jedoch des Erlasses eines richterlichen Durchsuchungsbefehls, der auf der Grundlage von § 21 Abs. 1 S. 1 InsO vom Insolvenzgericht erlassen werden kann[58]; etwaige Mitbewohner haben die Durchsuchung zu dulden[59]. Unzulässig ist hingegen die Ermächtigung zur Durchsuchung von Räumen Dritter, weil insoweit Art. 13 Abs. 1 GG überwiegt und die §§ 21, 22 InsO keine hinreichende Ermächtigungsgrundlage bieten[60]. Die Befugnis, Betretungsrechte bezüglich des Betriebsgrundstücks auszusprechen, ist als Ausfluss des Hausrechts sowohl für den vorläufigen starken als auch schwachen Insolvenzverwalter zulässig[61]. Ist kein vorläufiger Insolvenzverwalter, sondern nur ein Sachverständiger bestellt, kann dieser vom Insolvenzgericht nicht ermächtigt werden, die Wohn- oder Geschäftsräume zu betreten, da dessen Tätigkeit nicht unter die §§ 21, 22 InsO fällt, sondern eine vorbereitende Ermittlung im Sinne von §§ 5 Abs. 1 S. 2 InsO, 402 ff ZPO ist[62]. Dem betroffenen Schuldner steht in einem solchen Fall analog § 21 Abs. 1 S. 2 InsO die sofortige Beschwerde zu[63].
164
Ein wichtiger Ausdruck der Gläubigerherrschaft ist die in § 22a InsO nunmehr gesetzlich vorgesehene Möglichkeit der Bestellung eines vorläufigen Gläubigerausschusses. Ein solcher Ausschuss muss eingesetzt werden, wenn zwei der in § 22a Abs. 1 InsO aufgezählten drei Schwellenwerte erfüllt werden (über € 4 840 000,00 Bilanzsumme, € 9 680 000,00 Umsatzerlöse oder 50 Arbeitnehmer). Er kann eingesetzt werden, wenn dies erforderlich oder sachdienlich für die Betriebsfortführung ist (§ 21 Abs. 2 Nr 1a InsO) und er soll eingesetzt werden, wenn dies vom Schuldner selbst, vom vorläufigen Insolvenzverwalter oder einem Gläubiger beantragt wird (§ 22a Abs. 2 InsO).
Zu den wesentlichen Aufgaben des vorläufigen Gläubigerausschusses gehört es, den vorläufigen Insolvenzverwalter bei seiner Geschäftsführung zu unterstützen und zu überwachen (§§ 21 Abs. 2 Nr 1a, 69 InsO). Im Rahmen der vom vorläufigen Insolvenzverwalter zu erledigenden Tätigkeiten (s Rn 155 f) sind unter Umständen Entscheidungen über Rechtshandlungen von wirtschaftlich weitreichender Bedeutung zu treffen; der Insolvenzverwalter kann sich absichern, indem er den vorläufigen Gläubigerausschuss hierüber abstimmen lässt (vgl § 160 InsO) bzw sich fachkundigen Rat einholt. Vor allem im Rahmen der Vorbereitung einer in aller Regel schnellstmöglich umzusetzenden übertragenden Sanierung ist die Zusammenarbeit mit dem vorläufigen Gläubigerausschuss hilfreich. So kann man im Investorenprozess die Kandidaten schrittweise auslesen und sich am Ende, getragen von einem Votum des vorläufigen Gläubigerausschusses, auf einen festlegen, dem man den Betrieb noch am Tage der Insolvenzeröffnung (getragen von einem Votum des nunmehr endgültigen Gläubigerausschusses, vgl § 67 Abs. 1 InsO) übertragen kann. Eine Veräußerung im Eröffnungsverfahren wäre aufgrund der daraus resultierenden Haftung des Erwerbers für angelaufene Steuerschulden und Altverbindlichkeiten des Schuldners rechtlich nicht empfehlenswert. Wenn man hingegen mit dem Verkaufsprozess bis zur ersten Gläubigerversammlung im eröffneten Verfahren abwarten müsste, wären die Sanierungschancen in aller Regel auch dahin. Der Gesetzgeber hat daher mit guten Gründen den bereits früher von einigen Gerichten praktizierten vorläufigen Gläubigerausschuss im Gesetz etabliert.
Ferner kann der vorläufige Gläubigerausschuss, falls er vor der Einsetzung eines vorläufigen Insolvenzverwalters bestellt wird, dem Gericht die Person des Verwalters vorgeben, § 56a Abs. 2 InsO. Er hat ein Anhörungsrecht und die Entscheidungsprärogative über die Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung (§ 270 Abs. 3 S. 2 InsO) sowie die Person des Sachwalters (entspr § 56a Abs. 2 InsO) und das Aufhebungsrecht bezüglich eines laufenden Schutzschirmverfahrens (§ 270b Abs. 4 S. 1 Nr 2 InsO). Der vorläufige Gläubigerausschuss nimmt damit im Interesse der Gläubiger zentrale und weichenstellende Aufgaben zu einem Zeitpunkt wahr, in dem höchste Eile geboten ist. Die durch die gesetzliche Verankerung eingetretene Rechtssicherheit und Stärkung der Gläubigerautonomie ist als eine der größten Errungenschaften des ESUG einzustufen.
§ 4 Das Insolvenzeröffnungsverfahren › IV. Gerichtliche Entscheidung