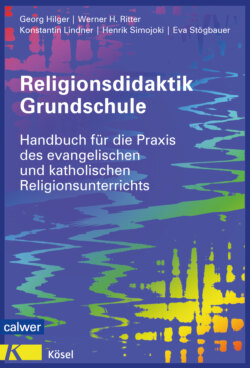Читать книгу Religionsdidaktik Grundschule - Konstantin Lindner - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Praxis: Kompetenzorientierter Religionsunterricht
ОглавлениеNoch gibt es keine allgemein anerkannten Vorschläge, Religionsunterricht kompetenzorientiert zu planen und zu initiieren. Klar ist, dass entsprechende Planungsmodelle keine grundlegenden Revolutionen bisheriger Unterrichtsplanung (s. III.1) bedeuten. Vielmehr bedienen sie sich vorhandener Aspekte und stellen diese in den Horizont der Kompetenzorientierung (vgl. u. a. OBST 2008, 194). Kompetenzorientierter Religionsunterricht denkt den Lernprozess vom Resultat her. Somit ist bei der Unterrichtsplanung und -initiierung leitend, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler erreichen sollen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Kompetenzen über einen längeren Lernprozess hin aufgebaut und nur selten in einer einzigen Unterrichtsstunde erworben werden. Deshalb erscheint es nach wie vor wichtig, für einzelne Unterrichtsstunden Lehr- / Lernziele zu definieren (s. III.1), die zum einen gewährleisten, dass verschiedene Teilkompetenzen religiöser Kompetenz zum Tragen kommen, und zum anderen eine gewisse Flexibilität garantieren, um den Lernenden bedarfs- und situationsangemessene Optionen des Kompetenzaufbaus zu ermöglichen.
Gabriele Obst schlägt folgendes Vorgehen bei kompetenzorientierter Unterrichtsplanung vor (vgl. OBST 2008, 137–146; OBST / ROTHGANGEL 2012):
Identifikation von Anforderungssituationen: Fragen, Probleme, Situationen, die die Schülerinnen und Schüler herausfordern und für deren Bearbeitung bestimmte Kompetenzen nötig sind,
Konstatierung der Lebensbedeutung des Themas für die Schülerinnen und Schüler,
Erhebung der Lernausgangslage der Schülerinnen und Schüler: vorhandene Erfahrungen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen,
Bestimmung von Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler benötigen, um mit der Anforderungssituation zurechtzukommen,
Planung von kompetenzförderlichen Lehr- / Lernsituation,
Etablierung geeigneter Überprüfungsformen,
immer wieder neues Einbringen der religiösen Perspektive.
Ein eigenes Planungsschema zum Aufbau und zur Struktur kompetenzorientierter Lernsequenzen hat Wolfgang Michalke-Leicht vorgelegt (vgl. MICHALKE-LEICHT 2011, 78–83). Andreas Feindt u. a. wiederum verweisen auf sechs Merkmale eines kompetenzorientierten Religionsunterrichts (vgl. FEINDT u. a. 2009, 12–16), die jedoch vieles aufgreifen, was bereits in »vor-kompetenzorientierten« Zeiten eine gute Unterrichtsplanung und -gestaltung auszeichnete:
individuelle Lernbegleitung der Lernenden, um den Kompetenzaufbau zu unterstützen,
Metakognition: Lernende befähigen, ihre Schwächen und Stärken einzuschätzen und Strategien zur Verbesserung offerieren,
Vernetzung von Wissen und Fertigkeiten: Schülerinnen und Schülern zu einem Überblick verhelfen, wie neues Wissen mit vorhandenem verknüpft ist und wie erlangte Fertigkeiten auf andere Bereiche hin angewendet werden können,
Übung und Überarbeitung: Lernende animieren, Kompetenzen zu schulen und in neuen Anwendungssituationen zu nutzen,
kognitive Aktivierung: Situationen schaffen, in denen Schülerinnen und Schüler sich gefordert sehen, eigene Entdeckungen zu machen sowie vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten selbsttätig und kreativ einzusetzen,
lebensweltliche Anwendung: Situierung der Lerngegenstände sowie kompetenzüberprüfende Aufgabenformate in Kontexten, die die Lebenswelt der Lernenden tangieren.
Ann-Kathrin Muth, die Vorschläge für eine kompetenzorientierte Unterrichtsplanung im Religionsunterricht an Grundschulen bietet, orientiert sich am Planungsmodell von Feindt u. a. Vor allem in der stimmigen Erhebung der Lernausgangslage, die für eine individuelle Lernbegleitung notwendig ist, sowie in einer mehrdimensionalen, Selbsttätigkeit und nachhaltiges Üben ermöglichenden Aufgaben- (nicht nur Prüfungs-)Kultur sieht sie wichtige Aspekte (vgl. MUTH 2012, 163). Offene Themeneinstiege bieten Schülerinnen und Schülern die Chance, ihr Vorwissen, ihre Vorstellungen und Gedanken einzubringen (= kognitive Aktivierung) und ermöglichen es den Lehrenden, die Lernausgangslage einzuschätzen und von daher geeignete Lernangebote bereitzustellen, die den Kompetenzerwerb unterstützen. Phasen des Übens und Wiederholens wiederum sind für Grundschulkinder sehr wichtig, um Kompetenzen aufzubauen. Dabei werden neue Formen bedeutsam, »z.B. das Cahier (Themenheft zu einem bestimmten Thema), das Portfolio, verschiedene Fragebögen und andere kreative Aufgabenstellungen« (SAJAK/FEINDT 2012, 103). Je nach Unterrichtsthema legt kompetenzorientierter Religionsunterricht in der Grundschule den Schwerpunkt zudem entweder stärker auf an der Praxis orientierte Übungen oder aber auf kognitive Aktivierung. Die Merkmale Metakognition und Wissensvernetzung dagegen erweisen sich hinsichtlich des Kompetenzerwerbs von Grundschulkindern als weniger produktiv; zudem benötigen Kinder – so Muth – mehrere instruktive Phasen (vgl. MUTH 2012, 164 f.).
Zusammenfassung:
Die Bildungsreform in Deutschland bringt es mit sich, dass sich Religionsunterricht in seiner Bildungsbedeutsamkeit erweisen muss. Unfraglich gehört es zu den Möglichkeiten des Menschen, die Welt religiös wahrzunehmen, zu deuten und zu gestalten. Im Sinne dieser Prämisse gilt es, im Religionsunterricht religiöse Kompetenz in ihren verschiedenen Dimensionen – Wahrnehmungs- und Deutungs-, Urteils-, Kommunikations- sowie Partizipationskompetenz – hinsichtlich religiös-inhaltlicher Kontexte anzubahnen. Ein dementsprechend geplanter Religionsunterricht an der Grundschule denkt vom Ende her und ermöglicht, dass die Kinder über eine längere Lerneinheit hinweg Kompetenzen aufbauen. Dabei ist es zum einen wichtig, die Lernausgangslage der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen, Übungsphasen zu organisieren sowie eine individuelle Aneignung der mit inhaltlicher Auseinandersetzung verbundenen Kompetenzen zu fördern. Zum anderen aber zeigt sich, dass nicht bereits im Vorab alle zu erreichenden Kompetenzen definiert werden können: Vielmehr ist den Inhalten des Religionsunterrichts zuzutrauen, dass sie den Lernenden auch Bildungsaufgaben auftun, die nicht überprüfbar sind; gerade in partizipatorischer Hinsicht.
Lesehinweise:
ENGLERT, RUDOLF (2012): Was bedeutet Kompetenzorientierung für den RU? Neun kritische Punkte. In: SAJAK, CLAUSS PETER (Hg.): Religionsunterricht kompetenzorientiert. Beiträge aus fachdidaktischer Forschung. Paderborn u. a., 61–73.
MICHALKE-LEICHT, WOLFGANG (2011): Lernsequenzen. In: Ders. (Hg.): Kompetenzorientiert unterrichten. Ein Praxisbuch für den Religionsunterricht. München, 78–83.
OBST, GABRIELE (2008): Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen im Religionsunterricht, Göttingen.
OBST, GABRIELE / ROTHGANGEL, MARTIN (2012): Kompetenzorientierte Religionspädagogik. In: GRÜMME, BERNHARD / LENHARD, HARTMUT / PIRNER, MANFRED L. (Hg.): Religionsunterricht neu denken. Innovative Ansätze und Perspektiven der Religionsdidaktik. Stuttgart, 185–197.
SAJAK, CLAUSS PETER / FEINDT, ANDREAS (2012): Zur Signatur kompetenzorientierter Unterrichtsgestaltung im Religionsunterricht. In: SAJAK, CLAUSS PETER (Hg.): Religionsunterricht kompetenzorientiert. Beiträge aus fachdidaktischer Forschung. Paderborn u. a., 89–106.