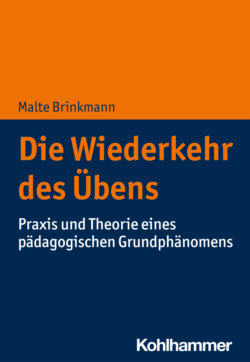Читать книгу Die Wiederkehr des Übens - Malte Brinkmann - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Üben basiert auf Nicht-Können – negative Erfahrungen
ОглавлениеÜben und Übungen haben eine lange Geschichte. Die Rekonstruktion vergessener Formen des Übens, die antiken »Technologien des Selbst« und die mittelalterlichen Exerzitien ( Kap. 5.3 und 8.2) sowie der Blick auf nicht europäische Praktiken des Übens in China ( Kap. 3) und auf mentale Übungen des Bewusstseins und der Meditation ( Kap. 6) zeigen die Vielfältigkeit und Produktivität des Übens. Die kulturgeschichtliche und genealogische Perspektive auf die Praxen des Übens relativiert den modernen Fortschritts- und Machbarkeitsmythos. Die Geschichte der Übung ( Kap. 2) macht deutlich, dass erst in der europäischen Moderne mit Üben vornehmlich Erfolg, Leistung, Perfektionierung und Optimierung verbunden wird. Die perfektionszentrierte und erfolgsorientierte Sicht zeigt aber nur eine Facette dieser Praxis. Nimmt man statt der Ergebnisse und der Erfolge, statt der leistungsbezogenen Kompetenzen und des messbaren Outputs den Prozess in der Erfahrung des Übens in den Blick, dann ergibt sich ein anderes Bild: Geübt wird nämlich, wenn man die angestrebte Fähigkeit und Fertigkeit noch nicht »kann«, wenn man scheitert und es aufs Neue versucht. In den o. g. Beispielen wird sinnfällig: Üben beginnt mit einem Nicht-Können, das – zumindest für den Moment – überwunden werden soll. Deshalb ist Üben eine anstrengende und fordernde Tätigkeit, die Ausdauer, Selbstüberwindung und Fehlertoleranz verlangt. Die Konfrontation mit Nicht-Können und Nicht-Wissen, mit Fehlern, Missverstehen, Scheitern und Stolpern kann als Schmerz, als Irritation oder Enttäuschung erlebt werden. Solche »negativen Erfahrungen« gehören zum Üben dazu. Sie können zwar temporär überwunden werden, ergeben sich aber gleich wieder im nächsten, schwierigeren Schritt. Übt man eine Zeit lang nicht, dann kommt es teilweise zum Verlust oder Vergessen, was wiederum ein erneutes Üben erfordert. Als Strukturen sind negative Erfahrungen für das Üben elementar. Ich werde zeigen, dass die Gerichtetheit des Übens auf ein Ziel hin durch passive, soziale und machtförmige Momente »gebrochen« wird. Üben geschieht auf der Grundlage einer »fungierenden Intentionalität« (Fink 1988, S. 91, Merleau-Ponty 1974, S. 15).
In der Erziehungswissenschaft geraten in letzter Zeit diese negativen Erfahrungen zunehmend in den Fokus der Forschung: Irritationen, Enttäuschungen, Scheitern und Fehler werden als wichtige Momente, nicht als Betriebsunfälle erfolgreichen Lernens und Übens gesehen (Oser/Spychiger 2005, Agostini 2016, Benner 2012, Meyer-Drawe 2008, Brinkmann 2012, Rödel 2018, Buck 2019). Mit der negativen Erfahrung ereignet sich in der Wiederholung des Übens ein Bruch. Dieser Bruch kann als so stark erfahren werden, dass Weiterüben nicht mehr möglich ist: Die oder der Übende bricht ab. Die Irritationen des eigenen Nicht-Könnens, die Enttäuschung der Intentionen und die Konfrontation mit der Widerständigkeit und Andersheit der Sache in den negativen Erfahrungen können aber auch die produktiven Chancen des Übens verdeutlichen. Die Veränderung von Gewohnheiten und die Reorganisation und Transformation von Sedimentierungen und Habitualisierungen sind ohne die Erfassung, Erfahrung und Inszenierung von Negativität nicht möglich. Der Fokus auf negative Erfahrungen resultiert aus einer pädagogischen Perspektive auf Lernen und Üben, die die prozesshaften und edukativen Erfahrungen berücksichtigt. In Kapitel 4 werde ich die pädagogische Lern-, Bildungs- und Übungstheorie vorstellen und von kognitivistischen, konstruktivistischen und empiristischen Theorien des Lernens abgrenzen.
Pädagogisches Üben ist wiederholte Praxis auf Probe. Deshalb üben nicht nur Schülerinnen und Schüler oder Studentinnen und Studenten, sondern auch Pilotinnen und Piloten am Flugsimulator und auch die Feuerwehr. Fehler und Unvollkommenheiten werden zugestanden, die im »wirklichen« Handeln kaum zugestanden würden. Für Pädagoginnen und Pädagogen bedeutet dies: Die Als-ob-Situation der Übung ist keine Leistungs- und Bewertungssituation, sondern eine Lernsituation. Fehler müssen nicht nur zugestanden werden in einer pädagogischen Fehlerkultur. Sie treten nicht nur als Folge von Nicht-Wissen oder falschem Lernen auf. Fehler gehören vielmehr elementar zum Lernen und Üben dazu.4 Üben changiert also zwischen Können und Nicht-Können. Es ist daher sinnvoll, nicht nur die Ergebnisse des Übens – also Erfolge oder Output –, sondern den Übungs- und Lernprozess als Erfahrungsprozess selbst zu betrachten.
Die »negative« Dimension der Erfahrung im Üben ist eine Zumutung und eine Herausforderung für Übende und für Pädagoginnen und Pädagogen gleichermaßen. Für die Didaktik der Übung ( Kap. 7) bedeutet diese Einsicht, dass die konstitutiven negativen Erfahrungen in Lehre und Unterricht gezielt eingesetzt werden können mit dem Ziel, Übensprozesse und bildende Erfahrungen anzuregen. Irritationen, Enttäuschungen und Fehler müssen vorsichtig und behutsam thematisiert werden – z. B. in Aufgabenformaten ( Kap. 7.5), im Unterrichtsgespräch über eine »Sache« ( Kap. 8.5) oder im gemeinsamen und gegenseitigen Verstehen ( Kap. 8.3). Ist aber die Konfrontation mit dem Nicht-Wissen und Nicht-Können zu stark, wird die negative Erfahrung zu deutlich, ereignet sich ein Bruch. Das Weiterüben kann dann unmöglich werden: Die oder der Übende bricht ab und gibt auf. Negative Erfahrungen sollten daher »taktvoll« (Herbart) und mit Rücksicht auf die je individuelle Situation inszeniert und damit die produktiven Potenziale der Übung genutzt werden ( Kap. 4, 7, 8.5).
Auf der Grundlage erfahrungs- und bildungstheoretischer Überlegungen ( Kap. 4.1) lassen sich zudem die Ziele des Übens pädagogisch bestimmen. Konventionelle Ziele der Übung wie Perfektion und Optimierung können kritisch eingeklammert und relativiert werden. Eine bildungstheoretische Perspektive auf die Erfahrung im Üben zeigt, dass nicht nur Fertigkeiten, sondern auch Fähigkeiten im Üben erworben werden können, dass also im Einüben einer Fertigkeit auch das Ausüben einer Fähigkeit stattfindet. Üben ist also nicht nur ein Etwas-üben, sondern immer auch ein Sich-selbst-üben, bei dem man sich »in Form« bringt und sich eine Form gibt. In dieser formatio gestaltet die oder der Übende ihr oder sein Verhältnis zu sich, zu Anderen und zur Welt. Diese Bildung als cura (Sorge) und cultura (Kultur bzw. Kultivierung) hat eine lange abendländische Tradition ( Kap. 2 und 7). Dabei ist nicht Selbsterkenntnis, Autonomie und Emanzipation Ziel übender Selbstsorge ( Kap. 4.4). Üben ist in der hier vorgestellten Perspektive auch Lebenskunst und Lebensziel ( Kap. 6). Bollnow erkennt darin den Wert des Übens: dass »der Mensch (…) nur da ganz Mensch (bleibt, M. B.), wo er übt; er sinkt unter sein Menschsein hinab, wenn er sich nicht mehr übend bemüht« (Bollnow 1978, S. 12).