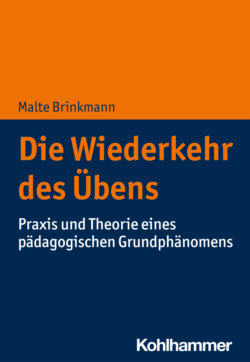Читать книгу Die Wiederkehr des Übens - Malte Brinkmann - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Üben in China
ОглавлениеIm asiatischen Kulturkreis und insbesondere in China hat das Üben eine lange Tradition und genießt als Praxis- und Lebensform sehr großes Ansehen. Sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Lernen ist die Praxis des Übens dominant. Mit dem Üben werden auch Wiederholung, Beharrlichkeit, Sorgfalt, Anstrengungsbereitschaft, Ausdauer, Konzentration und Achtsamkeit wertgeschätzt (vgl. Li 2012). Üben und Lernen werden nicht wie im Westen dualistisch getrennt gesehen, sondern als Einheit praktiziert. Schon das chinesische Wort für Üben, lianxi (练习), bezieht sich sowohl auf geistige und mentale als auch auf leibliche und motorische Praktiken. Geübt werden Fertigkeiten beispielsweise in der Kalligraphie oder in den Martial Arts wie Kung Fu, meditative Praktiken wie Tai Chi, aber auch mathematische Formeln, geschichtliche Zusammenhänge oder komplexe geistige Fähigkeiten wie Urteilen und Verstehen. Das chinesische Wort für Lernen, xuexi (学习), setzt sich aus Üben und Lernen zusammen. In den Gesprächen von Konfuzius steht deshalb ganz am Beginn schon der Satz: »Lernen (xue: 学) und fortwährend üben (Xi: 习): ist das denn nicht auch erfreulich? (学而时习之,不亦说乎)?« (Konfuzius 2010, S. 3; Peng et al. 2018, S. 264). Damit werden Üben und Lernen bzw. Lernen und Üben als eine zusammengehörige Praxis gesehen.9
Zum Üben gehört vor allem eine Haltung, die sich wiederholend aufbaut. Das Selbst-Üben impliziert Ausdauer, Entschlossenheit, Geduld, aber auch Beharrlichkeit und Überwindungsbereitschaft. Die Praxis des Übens ist in China eine tugendhafte, ethische Praxis. Sie basiert auf den o. g. Haltungen und Wertvorstellungen und hat gleichzeitig deren Ausbildung zum Ziel. Etwas üben und Sich-selbst-üben fallen in der Praxis des lianxi (练习) zusammen.
Die westlichen Duale zwischen Repetition und Reflexion, zwischen Tradition und Innovation sowie zwischen Konzentration und Kreation in der Erfahrung und Praxis des Übens gelten hier nicht. Insofern kann das chinesische Üben ein anderes Bild vermitteln. Es soll im Folgenden nicht als exotisches Vorbild dienen, dem nachzueifern wäre. Es soll vielmehr aus einer Perspektive der kulturellen Differenz und Andersheit heraus betrachtet werden (zur kulturellen Fremdheit und zum Antworten darauf vgl. Waldenfels 1998a, b; 1999). Damit soll der Blick geschärft werden für die produktiven und ethischen Aspekte des Übens, die in der europäischen Geschichte und Kultur mittlerweile fast verschüttet scheinen.
Ich werde im Folgenden auf wichtige Aspekte und Charakteristika des Übens in China eingehen, insbesondere auf das Verhältnis von Verstehen und Wiederholen, das Verhältnis von Tradition und Innovation bzw. von Altem und Neuem sowie auf Konzentration und schließlich auf die ethischen Aspekte des Sich-selbst-Übens. Zuvor werde ich einige westliche Vorurteile über die chinesische Lernerin und den chinesischen Lerner bzw. das chinesische Üben in den Blick nehmen und diskutieren. Dazu werden zunächst einige Bemerkungen zu asiatischen und insbesondere zur chinesischen Geschichte und Kultur des Lernens und Übens vorangestellt.