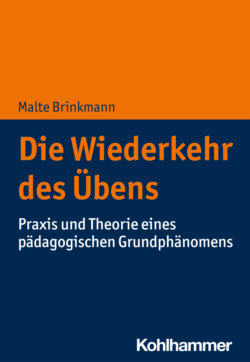Читать книгу Die Wiederkehr des Übens - Malte Brinkmann - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Aspekte einer Theorie des Übens als Praxis und Erfahrung
ОглавлениеEin kleiner Junge strauchelt und kippelt auf seinem roten Fahrrad. Sein Vater hält ihn zunächst am Sattel fest, dann lässt er los. Nach kurzer Zeit kippt der Junge um und fällt hin. Er steigt gleich wieder auf und versucht es erneut. Dieses wiederholt sich mehrfach. Kratzer, Schürfwunden, Tränen und Wut auf das sperrige Fahrrad gehören ebenso dazu wie der Stolz, »es« zu können und es den anderen Kindern und Erwachsenen zu zeigen.
Abb. 1: Fahrradfahren üben: sich bewegen üben (M. Brinkmann, eigene Aufnahme).
Im Klassenrat der 3a sollen auf Anregung der Lehrerin anlässlich verschiedener Vorfälle die Klassenregeln besprochen werden. Die Schülerinnen und Schüler wollen alle Regeln nochmals auf den Prüfstand stellen und eventuelle Konsequenzen bei Regelbruch gemeinsam festlegen. Sie diskutieren über mögliche Prinzipien der Regelgebung, ohne zu einem Ergebnis zu kommen, und üben sich im Urteilen.
Abb. 2: Klassenrat in einer Grundschule: Urteilen üben (Drubig-Photo/Adobe Stock).
Eine Meditierende sitzt im Lotussitz und fokussiert sich auf ihren Atem. Nach einer Weile schweifen ihre Gedanken ab, und sie bemerkt, dass die Konzentration auf den Atemstrom verloren gegangen ist. Sie versucht sich wieder auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Das scheint ihr nicht recht zu gelingen, wie sie später in einem Meditationsprotokoll mitteilt. Der Übungsleiter stellt ihr anschließend Fragen zu ihrem mentalen Zustand und zeigt ihr, wie sie zugleich angespannt und entspannt atmen soll, um zur konzentrierten, fokussierten Atmung zurückkehren zu können.
In einem heterogenen Volkshochschulkurs werden literarische Werke diskutiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sitzen einander zugewandt. Es geht darum, sowohl den Text als auch die Perspektiven der Anderen zu verstehen. Diese stammen teilweise aus nicht europäischen Kulturkreisen. Die Diskussion ist von Missverständnissen geprägt bei gleichzeitiger Anstrengung, die Perspektiven der Anderen anzuerkennen und mit den eigenen Erfahrungen in Verbindung zu setzen. Das zeigt sich in Gesten und Gesichtsausdrücken, die das Gesagte untermalen, häufig aber schon vor dem Gesagten gezeigt werden. Sie wirken wie eine Choreographie, die ein leiblich-körperliches Aufeinander-Antworten in Szene setzt. Die Missverständnisse können nicht aufgelöst werden.
Schülerinnen und Schüler sitzen im Unterricht an Mathematikaufgaben. Ihre Köpfe sind über das Heft gebeugt. Der Blick ist fest auf das Blatt gerichtet. Körperlich zeigt sich ein Dreieck bestehend aus Auge, Hand und Blatt. Sie atmen
Abb. 3: Meditieren üben als achtsames Anhalten des Bewusstseinsstroms (CC0 JD Mason/Unsplash).
dabei, oftmals deutlich vernehmbar, in einem gleichmäßigen Rhythmus. Ihre Körper haben eine angespannte Haltung.
Diese Beispiele aus unterschiedlichen Feldern des Übens stammen aus Projekten der Übungsforschung (Brinkmann 2012), die in Berlin seit 2012 in unterschiedlichen Bereichen betrieben wird.2 Sie stellen exemplarische Praktiken und Erfahrungen im Üben dar. Diese zeigen sich in spezifischen Verkörperungen (vgl. Brinkmann 2020d). An ihnen sollen im Folgenden zunächst wichtige Kennzeichen des Übens herausgearbeitet werden. Diese werden in diesem Kapitel in sieben Punkten überblickshaft und einführend dargestellt und später in den weiteren Kapiteln aufgegriffen und vertieft.
Abb. 4: Schreiben, Lesen, Rechnen üben als Ein- und Ausüben von Kultur (CC0 Martin Vorel/Libreshot).