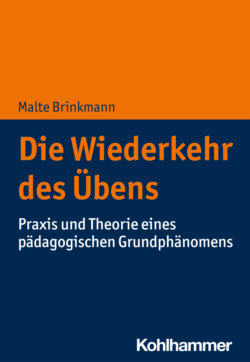Читать книгу Die Wiederkehr des Übens - Malte Brinkmann - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Geschichte des Übens
ОглавлениеDieses Kapitel stellt zunächst die europäische Geschichte des Übens in einer genealogischen und kritischen Perspektive dar. Im darauffolgenden Kapitel 3 wird in einem knappen Blick auf die konfuzianische Tradition des Übens in China eine interkulturell vergleichende Perspektive eröffnet. In dieser wird deutlich, dass es in der europäischen Geschichte der Übung mit der Heraufkunft der wissenschaftlich-technischen Moderne zu einer starken Technisierung und Mechanisierung der Übung kam. Deshalb werden im Folgenden auch die verschütteten produktiven, methodischen und ethischen Aspekte der antiken und mittelalterlichen Übung herausgearbeitet. Es wird sich zeigen, dass diese in vielen Aspekten mit den chinesischen Praktiken des Übens vergleichbar sind. Aus der genealogischen Perspektive ergeben sich schließlich aktuelle Probleme der Übungstheorie und Übungsforschung.
In der Antike gilt die Übung (askesis) als wesentlicher Bestandteil des Lernens (vgl. Platon 2008, S. 70a). Askesis gehört neben den natürlichen Voraussetzungen (physis) und der Lehre (mathesis) zum »pädagogischen Ternar« (vgl. Prange 2005, S. 62).5 Asketische Übungen beziehen sich auf körperliche und geistige Praktiken gleichermaßen.
In den klassischen Texten der antiken Philosophie findet sich eine Fülle von praktischen Übungen für den gymnastischen, medizinischen, erotischen, familiären und philosophischen Bereich. In Anlehnung an Rabbow (1954, 1960), Hadot (2005) und Foucault (1989, 1990a, 2004b) können die griechischen, römischen und christlichen Texte als »praktische« Texte gelesen werden, in denen es auch und vornehmlich um Übung geht. Diese Lesarten knüpfen an Nietzsches Verständnis der griechischen Hochschätzung der Übung an. Sich um sein Dasein und um die anderen Menschen zu sorgen, bedeutet, sich eine Form zu geben, einen Stil auszubilden:
»Eins ist not. Seinem Charakter ›Stil geben‹ – eine große und seltne Kunst! Sie übt der, welcher alles übersieht, was seine Natur an Kräften und Schwächen bietet, und es dann einem künstlerischen Plane einfügt, bis ein jedes als Kunst und Vernunft erscheint und auch die Schwäche noch das Auge entzückt. Hier ist eine große Masse zweiter Natur hinzugetragen worden, dort ein Stück erster Natur abgetragen – beide Male mit langer Übung und täglicher Arbeit daran.« (Nietzsche 1988, KSA 3, S. 530)
Sorge, Form- und Stilgebung verweisen auf den elementaren Zusammenhang von Üben, Leiblichkeit und Bildung, also jener formatio (engl./frz. formation), in
Abb. 6: Gymnastische Übungen auf einer antiken griechischen Vase (CC0 Met Museum Archiv).
der nicht Geist, Kognition oder Intellekt über das Körperliche und Sinnliche herrschen, nicht das Künstliche über das Natürliche dominiert, sondern in der Übung und die Sorge um sich zusammenfallen.
Im antiken Griechenland gilt: Reines Wissen (episteme) oder schiere Kunstfertigkeit (techne) ohne Übung ist ebenso sinn- und nutzlos wie Übung ohne Wissen und Kunstfertigkeit. Die praktischen Übungen sind mit den Praktiken des Wissens verzahnt und werden als Selbstsorge und Lebenskunst gepflegt. Nicht die Unterwerfung unter ein moralisches Gesetz oder eine soziale Norm, sondern der tüchtige und tugendhafte Lebenswandel (arete) ist Ziel der Übung. Tugend gilt in der Antike nicht als Zustand der Reinheit (wie im Christentum), auch nicht als kognitiv zu erreichende moralische oder ethische Kompetenz, sondern als ein Verhältnis zu sich selbst, das eine Praxis ist und auf ein Können bzw. ein Selbst-Können zielt. In der griechischen Terminologie heißt dieses Selbst-Verhältnis und Selbst-Können Selbstsorge (epimeleia heautou). Sie macht Übungen notwendig, die mit einer Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für sich selbst und für Andere einhergehen (vgl. Foucault 1990a, S. 97). Foucault nennt drei Praktiken (pratiques) oder Übungen6 der Selbstsorge: »(…) in der Diätetik als Kunst des Verhältnisses des Individuums zu seinem Körper; in der Ökonomik als Kunst des Verhaltens des Mannes als Oberhaupt der Familie; in der Erotik als Kunst des wechselseitigen Benehmens des Mannes und des Knaben in der Liebesbeziehung« (ebd., S. 123). Dazu gehören Tugenden wie Mäßigung (sophrosyne) und Selbstbeherrschung (enkrateia). Zu einem gelingenden Leben (eudaimonia) tragen nach Aristoteles im Wesentlichen Übungen bei, weil nur eine wiederholte Handlung Tugend zur Haltung (ethos) werden lässt:
»Denn das, was wir tun müssen, nachdem wir es gelernt haben, das lernen wir, indem wir es tun. So wird man durch Bauen ein Baumeister und durch Zitherspielen ein Zitherspieler. Ebenso werden wir durch gerechtes Handeln gerecht (…)«. (Aristoteles 1985, S. 1103a f.)
Üben als Sorge um sich hat also eine ethische Dimension. Diese kann nur praktisch, d. h. in konkreten Tätigkeiten wiederholend eingeübt und ausgeübt werden. Sie manifestiert sich in einem ethischen Handeln, das sich zu einer Haltung (griech.: ethos) verdichtet. Etwas üben und können korreliert also mit einem Verhältnis des Übenden zu sich selbst. Ich werde in den Kapiteln 8.4 und 8.5 diese durch Üben zu kultivierende Haltung am Beispiel der Kritik und des professionellen Ethos von Lehrpersonen genauer darstellen. Hier gewinnt das Phänomen dann seine ethische Dimension durch Ausprägung von Haltungen wie Treue, Redlichkeit (»Üb immer Treu und Redlichkeit«) oder Kritik (»Kritik üben«). Üben und Übung zielen also nicht nur auf eine Sache, die geübt wird und im frühen und wiederholten Üben besser gekonnt werden soll. Sie zielen nicht allein auf die Aneignung einer Technik, mit der die Sache geübt wird. Üben und Übung zielen auch auf den Übenden selbst, auf seine Haltungen und Einstellungen, die sich in seinem Handeln zeigen können ( Kap. 6.3).
Aristoteles führt den Zusammenhang von Ethos, Moral und Handlung (pragma) in seiner Rhetorik genauer aus (vgl. Aristoteles 1999). Ethos bezeichnet in diesem Zusammenhang die Glaubwürdigkeit einer Person, die Übereinstimmung von Worten und Charakter (sog. Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, vgl. Habel 2006, S. 75). Aristoteles stellt ethos in den Zusammenhang mit pathos und logos. Logos bezieht sich auf das vernünftige Argument, auf die Sach- und Problemebene. Pathos bezieht sich auf die zu erreichende produktive Einstimmung der Adressaten, auf ihre Emotionen und ihre Aufmerksamkeit, d. h. auf die Teilnehmerinnen- und Teilnehmer-Orientierung, welche auf Responsivität, Achtsamkeit und Pathos (Ergriffensein) basiert. Ethos ist das vermittelnde Dritte im Sinne einer stellungnehmenden, positionierenden Entscheidungs- oder Verständigungsfähigkeit (vgl. Hügli 2006). Diese moralische Entscheidungs- und Verständigungsfähigkeit bezeichnet Aristoteles als phronesis, eine verständige bzw. praktische Klugheit, die als Mit-Anderen-zu-Rate-gehen, als Hin-und-herüberlegen und als gemeinschaftliches, soziales und politisches Urteilen und Beraten bestimmt wird (vgl. Fink 1970b, S. 206 ff.; Kap. 8.4). Phronesis ist weder nur angeboren (physis) noch nur reines Wissen (mathesis), sondern beruht auf Erfahrung (empeireia) und Handeln (praxis). Phronesis ist gekonnt und wird geübt. Phronesis kann als ein gemeinschaftliches Urteilen bestimmt werden, das auf eine praktische Lebensklugheit zielt. Sie vermittelt Theorie und Praxis, Wissen und Können ( Kap. 8.5).
Der Grundsatz der Lebenskunst und der Selbstsorge, dass das gelingende Leben der praktischen Übung bedarf, behält in der römischen Kaiserzeit, aber auch im Mittelalter Geltung. Nietzsche, Rabbow, Foucault und Hadot betonen die Kontinuität der Selbstpraktiken. Diese erhalten allerdings im Christentum einen anderen Schwerpunkt. Der Hauptwandel liegt darin, dass das Ziel der Selbstsorge nunmehr in einer jenseitigen Transzendenz statt in diesseitiger Selbstbeherrschung der Sinnlichkeit liegt. Die christliche Subjektivierung der oder des Übenden im Zeichen einer Askese der Keuschheit, die Foucault exemplarisch bei Cassian und Augustinus untersucht, nimmt die Form eines »geistigen Kampfes« mit der »Macht des Anderen, dem Widersacher« an (Foucault 1990a, S. 32). Dieser ist gebunden an die »Verpflichtung, die Wahrheit über sich selbst zu suchen und zu sagen«, was »zu einer unendlichen Objektivierung seiner selbst durch sich selbst führt« (ebd., S. 37).7
Schon im römischen Hellenismus rücken als Ziel der übenden Selbstsorge Selbsterkenntnis und Wahrheit an die Stelle von Erfahrung und Handeln. Das Christentum treibt die Tendenz der Verinnerlichung und Individualisierung im Zeichen der Keuschheit, des versprochenen Heils und des kirchlichen Gehorsams weiter voran. Praktische Übungen werden in den Mönchsorden und in den kirchlichen Institutionen an ein persönliches Abhängigkeits- und Gehorsamsverhältnis sowie an das Beichtritual gekoppelt. Sie sind nun Praktiken der Entzifferung des geheimen und verborgenen, »sündigen« Ich. Religiöse Übungen (Exerzitien) haben das Ziel, dass der Übende in ein Verhältnis zu Gott treten soll. Sie sollen Selbstüberwindung und Selbstordnung ermöglichen. Zugleich zeigt sich in der »pastoralen Machtform« (Foucault) eine Ambivalenz zwischen Freiheit und Unterwerfung bzw. zwischen Selbstsorge und Fürsorge, die die eigentümliche Produktivität der Exerzitien ausmacht ( Kap. 5.3). Ich werde anhand der »Geistlichen Übungen« von Ignatius von Loyola zeigen, dass das nach innen gerichtete Ziel der Selbstsorge als Selbstüberwindung didaktisch auf eine ganze Reihe von »äußerlichen« Einzelzielen heruntergebrochen und durch ein System von Veranschaulichungen, Inszenierungen und Hilfen unterstützt wird, die eine stufenweise Progression ermöglichen sollen. Bei Ignatius findet sich über die antike Tradition der praktischen Übung und der Rhetorik hinaus eine Fülle von ästhetischen Übungsformen, die auf die »Anwendung der Sinne« (von Loyola 2006) zielen. Sie geben auch für heutige Leser sehr interessante und produktive Hinweise für eine Übung der Imagination bzw. Phantasie ( Kap 8.2; vgl. Brinkmann 2014c).
Sowohl die ästhetisch-sinnliche als auch die praktisch-ethische Dimension der Übung geht in der Neuzeit weitgehend verloren. Der harmonische und kosmologische Zusammenhang zwischen Denken bzw. Wissen, Handeln und Wollen, der die Antike und das Mittelalter bestimmte, ist in der Neuzeit zerbrochen. Für die neuzeitliche Pädagogik stellt das eine Chance dar, weil nun weniger autoritative Vorgaben Üben, Lernen und Erziehung leiten. Im öffentlichen Bildungssystem können familiäre Sozialisation, althergebrachte Tradition und gesellschaftliche Konvention überwunden und erweitert werden. Kritik wird zum wichtigen Organ moderner und wissenschaftlicher Diskurse – eine Praxis, die ebenfalls geübt werden muss ( Kap. 8.4). Säkularisierung und Verwissenschaftlichung stellen für die moderne Pädagogik aber auch eine große Herausforderung dar. Neuzeitliche Pädagogik ist nun mit einer doppelten Kontingenz konfrontiert. Sowohl die individuelle Biographie als auch der künftige Beruf der Kinder ist unbestimmt und offen. Das öffentliche Bildungssystem hat nun die Aufgabe, jedem Einzelnen Möglichkeiten zu bieten, um seine individuellen Anlagen, Perspektiven und Schwerpunktsetzungen verwirklichen zu können. Es versucht mit dem Anspruch auf Allgemeinbildung und Bildungsgerechtigkeit gesellschaftliche Ungleichheit abzubauen und zu kompensieren. Es erzeugt aber zwangsläufig auch neue Ungleichheiten. Weil es nun keine allgemeinverbindlichen Werte mehr gibt, sondern nur noch Orientierungspunkte, die gesellschaftlich und wissenschaftlich strittig sind, werden ethische und moralische Fragen auch zum Streitfall in der Pädagogik. Unsicher werden daher auch die Ziele, Normen und Praxen der Erziehung. An die Stelle von Harmonie und Eindeutigkeit treten Differenz, Unterschied, Pluralität und Kontingenz ( Kap. 4). Das Vermittlungshandeln der Pädagoginnen und Pädagogen kann sich nicht mehr auf die Vermittlung von vermeintlich eindeutigen und allgemeingültigen Werten beziehen, sondern muss in einer reflexiven Wendung die Wertbildung bzw. Ethosbildung unter Bedingungen von Pluralität und Differenz zum Thema machen. Alle Versuche, im Sinne einer Werteerziehung auf vermeintlich vorgegebene Identitäten zurückzugreifen (heißen sie »Volk«, »Heimat«, »Gott«, »Allah« oder »Sozialismus«), führen in plurale Bestimmungen. Die Pädagogik als Vermittlungshandlung hat damit die Aufgabe, auch plurale und differente Begründungslogiken von Werten in ihren Unterschieden zu thematisieren. Sie hat in die Pluralisierung von Wissens- und Begründungsformen einzuführen, was nur auf dem Weg der Übung von Urteilen geht (vgl. Benner 2012, 2019).
In der Moderne verliert das Üben als Selbstsorge seine ehemals bedeutsame Stellung im pädagogischen Ternar. Üben wird auf methodische, technische und mechanische Funktionen reduziert. Der neuzeitliche Dualismus von Geist (res cogitans) und Körper (res extensa) manifestiert sich in der Trennung von geistigen Übungen (der Urteilskraft, Vernunft) einerseits und leiblichen, motorischen Übungen andererseits, die nun weitgehend getrennt ausgeführt und behandelt werden. Pädagogisch und didaktisch manifestiert sich der neuzeitliche Dualismus in der Unterrichtslehre der Philanthropisten im 18. Jahrhundert über den Herbartianismus des 19. Jahrhunderts bis heute. Übung wird als sekundäre Lernform der Verarbeitung bzw. der Festigung bestimmt, die der Einsicht, dem Verstehen und Erklären nachgeordnet ist. So findet sich bis heute die Übung am Ende der meisten Lehr- und Unterrichtsstunden, nach Einstieg, Erarbeitung und Anwendung ( Kap. 7).
Die Übungstechnologien der »Schwarzen Pädagogik« im 19. Jahrhundert sollen durch Drill, mechanisches Pauken und stumpfes Automatisieren disziplinieren und normieren (vgl. Rutschky 1984). Reformpädagogische Methodik lockert die Übungsmethoden auf und differenziert sie erheblich, kann aber nicht verhindern, dass Übungen in der Schule im Abseits stehen, meist als Nachbeschäftigung zuhause in Form von Hausaufgaben. Reformpädagogik hat entgegen der landläufigen Meinung, hier handele es sich um eine natürliche, kindgerechte Pädagogik (Oelkers 2005), einen machtförmigen, normalisierenden Einschlag. Ich werde auf diese romantisch-religiösen und zugleich rassistischen und positivistischen Tendenzen am Beispiel der Pädagogik Montessoris in Kapitel 8.1.1 eingehen (vgl. Brinkmann 2013a). Allen Reformbemühungen zum Trotz gilt auch heute noch die Reduktion des Übens auf eine Disziplinartechnik: Übungen zielen auf den Leib, ob durch Automatisierung und Stillsitzen oder in der sozialpädagogischen, »indirekten« und reflektierenden Disziplinierung im »Trainingsraum« (vgl. Bröcher 2005, Jornitz 2005). Übungen sind probate Mittel, über den »Körper«, über den »Geist« oder über die vernünftige Selbstbeherrschung, die gesellschaftliche Ordnung und die sozialen Normen »einzuleiben« ( Kap. 5.3).
Geistige Übungen findet man in der neuzeitlichen Philosophie. Die philosophische Meditation als geistige Übung wird die bestimmende Form. Meditieren als philosophische Praxis äußert sich nicht nur in Texten, etwa in den »Meditationen« von Descartes (1985) oder Husserl (1992). Husserls Phänomenologie kann beispielsweise als eine »einzige, unablässige Meditation« (Fink 2004b, S. 207) über Tage, Wochen und Jahre gelesen werden, die sich in Tausenden von stenographischen Forschungsmanuskripten niederschlägt (vgl. ebd., S. 220). Meditieren zeigt sich hier als ein radikales »Sich-auf-sich-selbst-stellen«, als eine existenzielle Lebensform, die sich in einer Denkleidenschaft und einem habituellen Stil äußert (vgl. Fink 2004a, S. 81). Philosophische Meditationen nehmen das alte Thema der prosoché, der Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber, auf und treiben es bis an die Grenzen der Reflexion und des Ich voran ( Kap. 6).8
In den Meditationen von René Descartes und in der »ethischen Asketik« Kants wird Übung als eine Operation der Urteilskraft (Kant 1977a, KrV B 172) gesehen, mit der die Regeln und Gesetze der Vernunft in Können umgesetzt werden. Nietzsche versucht mit dem Projekt der Stil- und Formgebung durch leiblich-geistige Askesen den Dualismus von Körper und Geist zu überwinden. Die kulturellen Praktiken der körperlichen Übungen (sportliche Athletik), der musikalischen Übungen (Instrumentalisten, Virtuosen), der gezielten Übungen in spezifischen Leistungsdomänen (z. B. Schach), der geistigen Übungen der intellektuellen Disziplinen sowie geistige und geistliche Meditationsformen (Zazen) bilden heute spezialisierte und differenzierte Formen beachtlicher Expertenschaft aus.
Diese Expertisierung in Sachen Übung lässt sich exemplarisch am Violinisten, Artisten und Kunstschwimmer Carl Hermann Unthan zeigen. Unthan, armlos geboren, hatte durch Übung erreicht, dass er ohne fremde Hilfe selbstständig für sich sorgen konnte. Er konnte zudem virtuos Violine spielen und erlangte Ende des 19. Jahrhunderts einige Berühmtheit. Unthan war einer jener Artisten, die der Philosoph Peter Sloterdijk exemplarisch als »homo repetivivus« und »homo artista« anführt (vgl. Sloterdijk 2009, S. 24).
Abb. 7: Carl Hermann Unthan – Fußkünstler (Lobe, 1868, S. 438).
Nach Sloterdijk zeigt sich an und mit Unthan eine kulturgeschichtliche Tendenz, mit der sich eine »Renaissance« (ebd., S. 264) der Übung und eine Säkularisierung und »Entspiritualisierung der Askesen« (ebd., S. 150) verbindet. Diese verkörpern »Akrobaten des Körpers und Geistes« wie Rilke, Kafka, Cioran, aber auch der neoklassische Athletismus der olympischen Bewegung Coubertins und nicht zuletzt die aufkommende »Krüppelbewegung«, mit der Unthan verbunden war. Diese profanen Praktiken belegen einerseits die ganze Produktivität und Effektivität des Übens. Andererseits wird die »Wiederkehr des Übens« zu einem Kennzeichen der säkularen, westlichen Moderne, in der der Perfektionsgedanke des Einübens, Ausübens und Sich-Übens mit einem ökonomischen, politischen und biopolitischen Paradigma der Optimierung zusammengeschaltet wird (vgl. Brinkmann 2010). Ich werde später zeigen, wie im Üben einerseits eine Selbstbekräftigung und Individualisierung stattfindet, die andererseits auch eine Subjektivierung und Unterwerfung unter äußere Normen zur Folge hat. Im Modus eines »freiwilligen Gehorsams« (Foucault) verschränken sich im Üben Macht, Wissen und Selbst ( Kap. 5.3), sodass das übende Subjekt normalisiert wird und sich gerade darin Freiheits- und Spielräume eröffnen, die Leistungen wie jene von Unthan möglich machen.