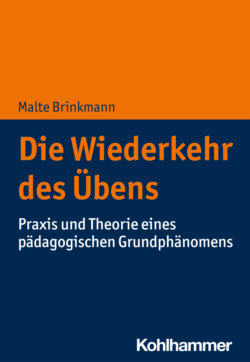Читать книгу Die Wiederkehr des Übens - Malte Brinkmann - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 Üben ist eine Praxis des Könnens
ОглавлениеEine Person, die eine Mathematikaufgabe lösen, mit dem Fahrrad fahren oder Tennis spielen, Vokabeln lernen, meditieren, verstehen oder soziale Regeln im Gesprächskreis einhalten will oder soll, kennt vielleicht jeweils die formalen Regeln dafür. Sie weiß, wie gefahren, gerechnet, meditiert, zugehört oder diskutiert wird, und sie weiß auch, dass dafür Konzentration, Geduld und Aufmerksamkeit wichtig sind. Aber sie kann diese Fertigkeiten und Fähigkeiten nicht so ohne weiteres ausführen. Bevor sie sie ausführt, muss sie üben. Das gleiche gilt für Blitzschachspielerinnen und Blitzschachspieler, für Ärztinnen und Ärzte oder Lehrpersonen. Könnerinnen und Könner handeln zunächst intuitiv und eingebunden in eine Situation. Die Situation wird gestalthaft wahrgenommen (Polanyi 1985). Wir nehmen also nicht zuerst isolierte Tatsachen wahr und geben ihnen dann einen Sinn, sondern umgekehrt: Zuerst kommt das sinnhafte Erlebnis des Ganzen der Situation, aus der heraus dann einzelne Teile isoliert werden können (vgl. Merleau-Ponty 1976, Buck 2019). Das wiederum ist die Bedingung dafür, dass Könnerinnen und Könner hochflexibel und mit »konzentrierter Leichtigkeit« agieren (vgl. Neuweg 2006, S. 12).
Um grammatikalische, mathematische, motorische oder soziale Fertigkeiten und Fähigkeiten oder individuelle Haltungen zu erwerben, bedarf es mehr als eines Willens, einer Motivation und mehr als Wissen. Wissen, Motivation, Erkenntnis oder Kognition reichen nicht aus, um etwas zu können. Denn über Motivation und Wissen verfügen die in den o. g. Beispielen erwähnten Personen. Aber sie können es nicht direkt und unmittelbar in die Praxis umsetzen. Können entsteht aus der Praxis in einem wiederholenden und intentionalen Tun, d. h. im Üben. Die Personen im Volkshochschulkurs oder die Kinder der 3a wissen und kennen schon etwas – in diesen Beispielen die Regeln für verständiges Zuhören. Um die eigene Perspektive argumentativ begründen zu können, müssen sie sich im Urteilen üben. Hier wie im Bereich des sozialen Miteinanders oder im Bereich motorischer oder meditativer Praxis reichen Vorsatz, Motivation, Wissen oder Willen nicht aus. Denn um sich gegenseitig achtsam zuhören zu können, müssen sie wiederholend das Verstehen Anderer sowie Aufmerksamkeit und Achtsamkeit einüben. Üben geschieht dadurch, dass man Entsprechendes tut. Dazu müssen sie diese Praxis ausführen. Diese einfache Einsicht, dass Einüben nur im Ausüben wirksam wird, dass Können nur in der Praxis erworben wird, kannten schon die Griechen: »So wird man durch Bauen ein Baumeister, durch Kithara spielen ein Kitharaspieler« – das bemerkt Aristoteles in der »Nikomachischen Ethik« (Aristoteles 1985, S. 27, 1103a; übers. u. modifiziert M. B.). Üben ist daher eine Praxis, die zunächst körperlich bzw. leiblich strukturiert ist. Sie ist aber keineswegs nur auf motorische Fertigkeiten beschränkt. Im Üben werden auch geistige, mentale Fähigkeit ausgeprägt. Im Üben verbinden sich Wissen und Können, Leibliches und Geistiges. Die wiederholende Übung führt zur Ausbildung von Gewohnheit (hexis), Können und Haltung (ethos). Es geht also nicht um Wissen, sondern um Praxis – und, wie ich zeigen werde, um Erfahrung ( Kap. 4.1). Im Üben ist implizites Wissen, das nicht vollständig auf den Begriff gebracht werden kann, als praktisches Können primär, verbal explizites und formalisiertes Wissen hingegen sekundär (vgl. Neuweg 1999). Nur im leiblichen Tun können mentale, ästhetische und ethische Fähigkeiten, praktische Fertigkeiten, Haltungen und Einstellungen wiederholend erlernt und kultiviert werden. Der Weg dahin ist die wiederholende Übung.
Mit dem Leib beginnt und endet das Üben ( Kap. 5.1). Üben hat etwas mit der »Einverleibung von Strukturen« (Waldenfels 2001b, S. 166, S. 183) zu tun. Strukturen werden im Folgenden in leibphänomenologischer Bedeutung als »Struktur des Verhaltens« (Merleau-Ponty 1976) verstanden. In einer Struktur- bzw. Gestaltwahrnehmung stehen Teil und Ganzes in einem Entsprechungs- und Verweisungsverhältnis. Folglich ist »Übung (…) Ausbildung, im weitesten Sinne, einer Struktur, nicht die Festigung eines Bandes« (Koffka 1921; Kap. 5.1). Diese Strukturen der Bewegung, des Wahrnehmens, des Denkens bzw. Urteilens, des Verstehens und Imaginierens ( Kap. 8) sind implizit und leiblich strukturiert. Sie können kaum in explizite Regeln übersetzt werden. Gleichwohl sind diese Regeln den Praktikerinnen und Praktikern und professionellen Akteurinnen und Akteuren bekannt. In der Physik zum Beispiel kennt man die Regel, die Radfahrer intuitiv in ihrem leiblichen Tun befolgen.3 Georg Neuweg bemerkt dazu lakonisch: »Der Punkt ist nur: Obwohl die Regel beschreibt, wie es geht, kann man mit ihr nicht lernen, wie es geht« (Neuweg 2006, S. 2). Üben basiert also nicht auf Regeln, sondern auf Praxis und Erfahrung. Im Üben wird ein »Körperschema« auf dem Fundament eines »sensu-motorischen Apriori« (Merleau-Ponty 1976, S. 116) aufgebaut. In diesem Können kommt gewusstes Können (knowing how) und gekonntes Wissen (knowing that) zusammen (vgl. Ryle 1969). Im Üben als leibliche Praxis werden Fertigkeiten und Fähigkeiten ausgebildet und Haltungen kultiviert. Es sind daher weniger Formen des Wissens, der Repräsentation und des Bewusstseins, sondern vielmehr Formen »impliziten« Könnens: Üben bringt gleichsam »Könntnisse« (Prange 1979, S. 117) hervor. Die erfahrene Praktikerin und der erfahrene Praktiker kann etwas, weil sie oder er es geübt hat. Hier zeigt sich bereits der innere Zusammenhang von Erfahrung, Profession, Wiederholung und Übung ( Kap. 8.5).