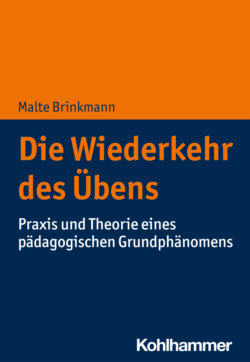Читать книгу Die Wiederkehr des Übens - Malte Brinkmann - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4 Üben ist eine Praxis der Macht – Normalisierung, Isolierung, Flow
ОглавлениеEine Schülerin oder ein Schüler, die oder der eine Konvention verletzt (»das sagt oder tut man nicht«), begeht einen Fehler, der nicht auf kognitiven Strukturen, sondern auf sozialen Regeln basiert. »Diese Fehlerform führt nicht zur Erkenntnis, sondern zur Bestrafung« (Edelstein 1999, S. 116). Gleichwohl ist es möglich, dass die Lehrerin oder der Lehrer in einer anderen Situation aus pädagogischen oder anderen Gründen genau diese Regelverletzung toleriert. Soziale Regeln lassen sich nicht so generalisieren wie technische Regeln. Hier wird die soziale Dimension der Übung als Struktur der Macht, Disziplinierung, aber auch Formierung deutlich – eine Struktur, die in den allermeisten Lern- und Übungsmodellen völlig übergangen wird. Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Volkshochschule und die Schülerinnen und Schüler der 3a diskutieren, wenn meditiert oder Fahrrad gefahren wird, wenn Rechnen, Meditieren und Verstehen geübt wird, dann finden diese Praxen in einem sozialen und meist in einem institutionellen Raum gesellschaftlicher Ordnungen statt. Hier die Übenden – dort Erzieherin oder Erzieher, Lehrerin oder Lehrer, Philosophin oder Philosoph, Handwerks-, Exerzitien- oder Zenmeisterin oder -meister. Wenn Übende »selbsttätig« ihre Praxis ausüben und damit Fertigkeiten und Fähigkeiten einüben, dann übernehmen sie »zwangsläufig« die bestehenden Ordnungen und Normen.
Übungen hatten und haben die Funktion der Disziplinierung und Normalisierung. In der Fremdführung der Erzieherin oder des Erziehers, der Lehrerin oder des Lehrers, der Exerzitienmeisterin oder des Exerzitienmeisters usw. wird die Freiheit der oder des Übenden gezielt eingeschränkt. Übungen gehörten zum Arsenal der »Schwarzen Pädagogik«, eines Unterrichts, der auf der Praxis des »Überwachens und Strafens« aufbaute (vgl. Keck 2000, Rutschky 1984, Foucault 1994a, Brinkmann 2011b). Die Geschichte der Pädagogik zeigt, dass Übungen, wissenschaftlich sanktioniert und produziert, als eine »Kunst des Beybringens« (Rutschky 1984, S. 224) eingesetzt wurden, um den Kindern Gehorchen, Stillsitzen, Schönschreiben usw. und damit die sog. Sekundärtugenden wie Ordnung, Fleiß, Pünktlichkeit, Konzentration und Disziplin »einzuleiben«. Der schlechte Ruf der Übung stammt auch aus dieser Zeit, in der Drill, Pauken und stumpfe Automatisierung in den Schulen an der Tagesordnung war ( Kap. 2).
Die sozialwissenschaftliche Forschung kann überzeugend deutlich machen, dass Übungen die Funktionen der Normalisierung übernehmen, indem die äußeren Normen »praktisch« verinnerlicht werden. Dennoch bieten normalisierende Prozesse auch Möglichkeiten, mit den bestehenden Regeln und Normen kreativ oder reflexiv umzugehen. Für diesen zugleich aktiven und passiven Vorgang werden die Begriffe der Normalisierung und der Subjektivierung verwendet (vgl. Foucault 1994a; Kap. 5.3). Sie sind keine Einbahnstraße, in der »das« System oder »die« Macht ausschließlich repressiv wirkt. Normalisierung und Subjektivierung sind vielmehr durchaus als aktive Prozesse zu verstehen ( Kap. 5.3). Denn Übende sind unter den bestehenden Verhältnissen und in dem gegebenen Rahmen aktiv. Sie machen die »Sache« des Übens zu ihrer eigenen. Die Sache, die geübt wird, kann so abgewandelt zu einem Teil des übenden Subjekts werden.
In der erziehungswissenschaftlichen Diskussion werden solche Prozesse der Normalisierung im Anschluss an Foucault nicht mehr als autonome Handlungen und auch nicht als disziplinierende Unterdrückung durch das »System« oder durch die »Institution« verstanden. Machtprozesse der Normalisierung werden vielmehr als produktive, aber gleichwohl ambivalente Prozesse im Lehr-Lerngeschehen untersucht. Übungen sind Praktiken und Praktiken sind Übungen (frz.: pratiques), mit denen sich eine leiblich fundierte Positionierung des Selbst im Zwischenraum von Macht und Freiheit beschreiben lässt. Übung ist nach Foucault nicht nur die zentrale Praktik der Disziplinierung, sondern auch jene der asketischen Selbstsorge, in der zugleich unterwerfende und befreiende Momente zwischen Freiheit und Macht zusammenkommen (Foucault 1989, 1993a, 2004a). In Kapitel 5.3 werde ich die machtförmige Struktur des Übens genauer darstellen.
Der Übung als kultureller und gesellschaftlicher Praxis zwischen fremdbestimmter Disziplinierung und Normalisierung einerseits und selbstbestimmtem und aktivem Tun andererseits ist ein grundsätzlich ambivalenter Charakter zu eigen. Die Spielräume der Übung zwischen Fremd- und Selbstführung, die Möglichkeiten von Variation, Polarisation und Flow stehen nicht im Gegensatz zur Macht (zur Unterscheidung zwischen Üben und Spielen Kap. 1.6). Vielmehr werden in der Macht der Übung Disziplin und Freiheit zusammengeschaltet und die oder der Übende in ein produktives Verhältnis von Ermächtigung und Unterwerfung eingespannt. Das Verhältnis des oder der Übenden zu sich selbst kann sich in diesem Prozess als solches konstituieren (vgl. Foucault 2004a, Brinkmann 2008b). Diese Perspektive führt schließlich auf die Spur der Praxis und Technik der Konzentration, der Erleichterung, der Entspannung und der Erinnerung, wie sie seit der Antike und in meditativen Praktiken gepflegt wurde und wird (vgl. Mortari 2016, S. 116). In der antiken Terminologie heißt dieses Selbstverhältnis und Selbstkönnen Selbstsorge ( Kap. 5.3.3). Übungen der Selbstsorge gehen mit einer Aufmerksamkeit und Achtsamkeit (mindfulness) für sich selbst und für Andere einher (vgl. Foucault 1990a, S. 97) ( Kap. 6). Judith Butler zeigt, an Foucault anschließend, dass Haltungen als Positionierungen immer auch soziale und politische Praxen sind, die leibliche Verletzlichkeit voraussetzen und diese exponieren (Butler 2018; Kap. 8.4).
Wenn Übungen in Lehre und Unterricht eingesetzt werden, dann werden häufig äußere Einflüsse, Störungen und Ablenkungen gezielt ausgeschlossen. Übungen isolieren – meist nicht nur die Übenden von der Außenwelt, sondern auch einzelne Sinne und Operationen, etwa Bewegungen, Methoden, Handgriffe, Perspektiven, die dann gezielt geübt werden können. Das geschieht, wenn Kinder sich wiederholend auf eine Bewegungsfolge mit Dingen konzentrieren, wenn Musikerinnen und Musiker einige Takte eines Musikstücks herausnehmen, wenn Sportlerinnen und Sportler aus einer komplexen taktischen Situation oder einer komplexen Bewegungsabfolge Details isolieren, wenn in Denk- und Memorierübungen Elemente dekontextualisiert und wiederholt werden oder eben, wenn im Unterricht Vokabeln, Regeln oder Fertigkeiten geübt werden. Begrenzung und Isolierung sind auch Techniken der Macht. Sie schließen ein und schließen aus. Aber neben den normalisierenden und subjektivierenden Aspekten sind für Übungen immer auch freiheitliche und individuelle Momente konstitutiv. Mit ihnen kann ermöglicht werden, dass Übende sich auf eine Sache, ein Thema oder eine Aufgabe fokussieren und sich damit polarisieren (vgl. Brinkmann 2012).
Die Isolierung allein garantiert noch keine sinnvolle Übung. Es muss zusätzlich der Gestalt- und Situationsbezug der Übung gesehen und einbezogen werden. Das isolierte Detail muss in den Zusammenhang des Ganzen gebracht werden, sonst läuft die Übung Gefahr, zum stupiden Drill oder zur stumpfen Automatisierung zu verkommen. Eine Schülerin oder ein Schüler kann versuchen, die Bedeutung eines Wortes oder eines Satzes sinnentnehmend zu lesen. Ein sinnvolles Verständnis und damit ein sinnvoller Gebrauch sozialer Regeln gelingt aber erst dann, wenn die Elemente wieder in die Gesamtsituation integriert werden, wenn also im Rechnen-, Verstehen-, Diskutieren-, Tennis- und Fahrradfahren-üben nicht nur ein Wort, eine Information oder Bewegungsabfolge isoliert wird, sondern wenn diese wieder in den Sinnzusammenhang des Textes, der Aufgabe, der Bewegung, der Situation einfügt werden. Sinnvoll geübt wird also erst dann, wenn zusammen mit der Isolation die Komposition stattfinden kann. Die Wiederzusammensetzung ist weder eine Prozeduralisierung von Gedächtnisinformationen nach kausalen Regeln noch eine simple Addition der Teile oder eine ganzheitliche Zusammenschau ( Kap. 4). Sie ist vielmehr die Rekomposition der Elemente zu einem Ganzen unter neuen Bedingungen und mit einer neuen Perspektive auf das Gekonnte und Gewusste auf der Grundlage des Vorwissens und Vorkönnens der oder des Übenden. So kann in der Wiederholung eine Veränderung der Gestalt, Struktur und Situation möglich werden. Die Übung wird variiert und verändert. Die Aspekte der Isolation und Komposition sind wichtige Kriterien für die erfolgreiche didaktische Gestaltung von Übungen ( Kap. 7).
Die Macht der Übung ist ambivalent: Sie changiert zwischen Normalisierung und Freiheit, zwischen Rezeptivität und Aktivität (vgl. Brinkmann 2012, 2013a). Deshalb sind Beschränkung und Isolierung die Voraussetzungen für die Erfahrung von Selbstvergessenheit, von Polarisation (Montessori) und Flow (Csíkszentmihályi). Die psychologische Kreativitätstheorie von Mihály Csíkszentmihályi bestimmt Flow als »außergewöhnliche Erfahrung«, die auftritt, wenn es in Handlungen zu einer Passung zwischen Können und Herausforderung bzw. zwischen Überforderung und Unterforderung kommt. Wenn Können und Anforderungen im »oberen Bereich« und im Gleichgewicht liegen, stellt sich das Gefühl des »Fließens« ein, das aus dem Vollzug der Sache selbst und dem Genuss am eigenen Können entspringt – ein Gefühl, das jeder kennt: Selbstvergessenheit und euphorische Stimmung in der Zentrierung der Aufmerksamkeit (vgl. Csíkszentmihályi 1991, S. 285; Kap. 4 und 6).
Ich werde diesen Aspekt der Erfahrung im Üben in unterschiedlichen Zusammenhängen und Feldern aufspüren. Er ist auch für das frühkindliche Üben bedeutsam, wenn Kinder z. B. mit hoher ›Fehler- und Frustrationstoleranz‹ etwas wiederholend bzw. polarisierend üben (das sog. »Montessoriphänomen«; kritisch zu Montessori Kap. 8.1). Die Intention des Kindes wird dabei nicht gebremst, obwohl das Ziel (zunächst) nicht erreicht wird. Ich werde in diesem Zusammenhang zeigen, dass die Auge-Hand-Koordination für das leiblich-geistige Greifen und Begreifen eine entscheidende Voraussetzung ist ( Kap. 8.1.1).
Abb. 5: Konzentration, Auge-Hand-Koordination im frühkindlichen Üben (M. Brinkmann, eigene Aufnahme).
Flow, Polarisation, Aufgehen im Augenblick resultieren aus einer angestrengten Entspannung. Ich werde am Beispiel des meditativen Übens verdeutlichen, dass dieser scheinbar paradoxe Zustand der Entspannung und des Loslassens bei gleichzeitiger Anspannung und Überwindung zu einer existenziellen Erfahrung führen kann, in der die Wiederholung sich gleichsam in einen gegenwärtigen Augenblick zusammenzieht. Wird dieser Zustand dauerhaft eingeübt ausgeübt, werden Haltungen wie Konzentration, Gelassenheit und Achtsamkeit (mindfulness) erreicht. Diese Haltungen sind Folge eines Sich-selbst-übens und einer Selbstsorge und haben eine lange Tradition in den antiken und östlichen Übungs- und Meditationspraxen ( Kap. 6).