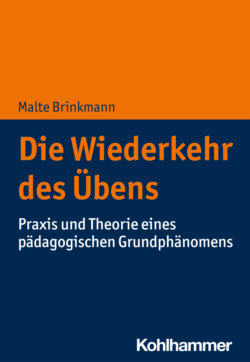Читать книгу Die Wiederkehr des Übens - Malte Brinkmann - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеDieses Buch nimmt sich vor, Üben als lebensweltliche, kulturelle und pädagogische Praxis in seinen produktiven Potenzialen in pädagogischen Feldern zu beschreiben und zu bestimmen. Leider hat die Übung in unserem Kulturraum einen schlechten Ruf. Mit Automation, Einschleifen, Pauken und Stumpfsinn in Verbindung gebracht, wird sie häufig als reproduktive, sekundäre Lernform verkannt und erinnert viele an Disziplinarpraktiken der »schwarzen Pädagogik«. Üben wird kaum als primäre pädagogische Praxis gewürdigt. Ihre kreativen und produktiven Potenziale werden selten gesehen. Eine »Wiederkehr des Übens« steht noch aus. Erste Schritte in diese Richtung sollen mit diesem Buch unternommen werden. Üben wird als eine besondere Praxis und Lernform anhand vieler Beispiele in seinen wichtigsten Strukturen vorgestellt.1
Es gibt kaum eine Praxis – wie Bewegen, Gehen, Rechnen, Schreiben, Verstehen oder Imaginieren –, in der nicht in Form von Rückbezügen, Anschlüssen, Anknüpfungen oder Wiederholungen agiert, d. h. geübt wird. Üben ist aber nicht nur für die Bewegungsbildung, die Sportpädagogik oder Pädagogik der frühen Kindheit im Kindergarten bedeutsam. Üben ist die Praxis, die einen kreativen, verstehenden und kritischen Zugang zu unserer Kultur, Gesellschaft und Gemeinschaft ermöglicht. Geübt werden neben Bewegen, Gehen, Sehen und Sprechen auch Verstehen, Begreifen, Kritisieren und Urteilen. Zudem werden nur durch Üben Einstellungen und Haltungen wie Aufmerksamkeit, Achtsamkeit oder Gelassenheit erworben. Es gibt leibliche und motorische Übungen, geistige und spirituelle Übungen, Meditationsübungen buddhistischer und philosophischer Ausprägung, geistliche Exerzitien, militärisches Exerzieren, sportliches Training und schulische Übungen sowie didaktische Übungsformate. Sie werden alle in diesem Buch thematisiert, systematisch unterschieden und in ihren unterschiedlichen Feldern sach- und fachbezogen analysiert.
Die fehlende Reputation der Übung ist darauf zurückzuführen, dass wiederholendes Lernen in der westlichen Welt als nicht kreativ und nicht entwicklungs- und fortschrittsorientiert gilt. Im asiatischen Kulturkreis dominiert hingegen das wiederholende Üben die Praxis des Lernens weitgehend. Hier existiert der eurozentrische Dualismus zwischen Repetition und Reflexion, Tradition und Innovation, Transpiration und Inspiration nicht. Lernen gilt hier gleichermaßen als Wiederholung von Altem und Erwerb von Neuem.
Diese Einsicht möchte dieses Buch aufnehmen und eine erfahrungs- und bildungstheoretische Perspektive auf das Üben präsentieren. Es geht um eine Rehabilitierung des Übens als sowohl leibliche als auch geistige, produktive Praxis, mit der ein elementarer Bezug zu sich, zu Anderen und zur Welt konstituiert wird. Entgegen dem europäischen Dualismus von Körper und Geist, Vernunft und Gefühl bzw. Freiheit und Unterdrückung, Wiederholung und Kreativität werden die Potenziale des Übens in praktischen, motorischen und mentalen, habitualisierenden und transformierenden, sorgenden und fürsorgenden Strukturen herausgearbeitet. Dazu werden unterschiedliche Praktiken des Übens wie Meditation, Training, Askese, Lianxi aus unterschiedlichen Kulturen und Feldern vorgestellt und untersucht. Auf der Grundlage einer Theorie der Erfahrung, der Bildung und der Sozialität wird Üben als repetitive und zugleich reflexive Praxis dargestellt, mit der man »aus Erfahrung klug« werden kann.
Üben ist eine Praxis, die auf Können bzw. besseres Können gerichtet ist. Geübt werden Praxen, die man nicht mittelbar durch Willen und Entschluss ausführen kann. Anlass und Prozess des Übens wird durch die Erfahrung bestimmt, dass man etwas nicht kann. Nicht-Können, Nicht-Wissen, Missverstehen, Nicht-Verstehen, Fehler und Scheitern gehören elementar zur Erfahrung im Üben hinzu. Diese »negativen Erfahrungen« werden in diesem Buch in unterschiedlichen Praktiken und Feldern des Übens aufgesucht, bestimmt und in ihrer bildenden Funktion ausgewiesen.
Es geht also nicht ausschließlich um den Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein- und ausgeübt werden. Im Einüben und Ausüben übt man immer auch sich selbst, indem man sich »in Form« bringt, sich formiert und ausbildet. Die übende formatio betrifft das Verhältnis der Übenden zu sich, zu Anderen und zur Welt. Diese Bildung als cura (Sorge) und cultura (Kultivierung) hat eine lange Tradition, die in diesem Buch wieder aufgegriffen wird. Üben hat also das Ziel der Kultivierung der Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie der Formierung des Selbst. Diese Ziele werden abgegrenzt von modernen Zielvorgaben unter Bedingungen der Leistungsgesellschaft. Hier wird Üben vor allem als disziplinierende Praxis der Perfektionierung und der Optimierung eingesetzt. In einer erfahrungs- und bildungstheoretischen Perspektive hat Üben hingegen das Ziel, ein gutes Leben führen zu können. Es geht also um Selbstsorge und Selbstführung. Üben ist damit auch eine ethische Praxis der Lebenskunst. In vielen Kulturen finden sich Praxen asketischen, geistigen und spirituellen Übens, die diesem Ziel verpflichtet sind. Auch sie werden in diesem Buch zur Sprache kommen.
Der Anspruch des Buches geht damit über eine bereichs- oder fachdidaktische Bestimmung des Übens ebenso hinaus wie über die »älteren« Untersuchungen des Übens (vgl. Weise 1932, Rabbow 1954, Bollnow 1978, Loser 1976). Ohne Übung ist weder Bildung noch Lernen möglich – ja, ohne Üben ist ein lebendiges, weltbezogenes und weltoffenes Leben in demokratischen Gemeinschaften nicht möglich. Es geht also um eine Rehabilitierung des Übens als sowohl leibliche als auch geistige, produktive Praxis, mit der ein fundamentales Verhältnis zu sich, zu Anderen und zur Welt konstituiert wird.
Üben wird, so die hier vertretene Perspektive, als ein Relationsphänomen bestimmt. Diese Relationen werden zum einen in Selbstverhältnissen manifest, die in geistigen, meditierenden, philosophierenden oder imaginierenden Übungen im Mittelpunkt stehen. Die Relationen zu Anderen werden im Verhältnis zu Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern oder Exerzitienleiterinnen und Exerzitienleitern sinnfällig. Davon werden gegenstands- und fachbezogene Relationen unterschieden, wie sie im letzten Teil dieses Buches exemplarisch beschrieben werden. Eine Bewegungsübung ( Kap. 8.1) wird ganz anders erfahren als eine Imaginationsübung ( Kap. 8.2) oder eine Übung im Schulunterricht ( Kap. 8.5). Daher wird der Gegenstandsbezug in (fach-)spezifischen Feldern als eine wichtige Dimension herausgearbeitet. In der gegenstandsspezifischen und relationalen Perspektive wird Üben als ein pädagogisches Phänomen und eine pädagogische Praxis bestimmbar. Als solche ist Üben in soziale, gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge eingebettet. Diese sozialen Verhältnisse werden in Bezug auf das Üben als leibliche bzw. zwischenleibliche Relationen ( Kap. 5.1) sowie als sozialtheoretische, responsive und antwortende Relationen ( Kap. 4.4) ausgewiesen und in unterschiedlichen Praktiken wie dem Verstehen ( Kap. 8.3.5) oder dem Urteilen ( Kap. 8.4.3) genauer bestimmt.
Die hier vorgestellte pädagogische Perspektive auf Üben grenzt sich von psychologischen und kompetenztheoretischen Theorien deutlich ab. Lernen und Üben werden hier nicht als stetiger und stufenweiser Zuwachs von kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden. Mit der Fokussierung auf kognitive Prozesse (entweder die Informationsverarbeitung oder die Vernetzung) und ihre Kontinuität können psychologische und kompetenztheoretische Lerntheorien weder implizites Wissen noch emotionale, ästhetische, leibliche und ethische Dimensionen angemessen erfassen. Vor allem aber werden so negative Erfahrungen, d. h. Erfahrungen der Irritation, der Enttäuschung und des Scheiterns, die eben zur Erfahrung des Übens dazugehören, nicht in ihrem produktiven Potenzial erkannt. Sie gelten in diesen Theorien stattdessen als Betriebsunfälle erfolgreichen Lernens und Übens, welche weiter optimiert werden müssten ( Kap. 4.3).
Der Blick wird daher auf die Praxis des Übens gelenkt und damit erstens auf die Erfahrung im Üben, zweitens auf die bildenden Aspekte, drittens auf die sozialen und viertens auf die edukativen Zusammenhänge. Üben wird also erfahrungs-, bildungs-, sozial- und erziehungstheoretisch beschrieben und untersucht.
Die Erfahrungstheorie versucht die leiblichen, kinästhetischen Strukturen im Üben genauer zu betrachten. Aus phänomenologischer Perspektive werden Leiblichkeit und Verkörperung im Üben genauer analysiert. Die erfahrungstheoretische Betrachtungsweise verschiebt dabei die Perspektive weg von den Ergebnissen, den Kompetenzen oder den Leistungen, die im Üben perfektioniert oder optimiert werden könnten, hin zu den Prozessen und Erfahrungen im Üben selbst. Diese werden in drei Strukturen untersucht: Leiblichkeit, Zeitlichkeit und Machtförmigkeit. Die erfahrungstheoretische Betrachtungsweise ermöglicht es zudem, im Prozess des Übens die »schwierigen« Momente, die Erfahrungen der Enttäuschung, des Scheiterns, der »Unzuhandenheit« (Heidegger), des Nicht-Könnens und der Fehler in den Blick zu nehmen – also jene Erfahrungen, die für den Prozess und die Erfahrung des Übens konstitutiv sind. Sie gelten in bildungstheoretischer Perspektive als Grundmomente von Lern- und Übungsprozessen insofern, als mit ihnen und durch sie eine Umwendung, ein Umüben und Umlernen möglich wird: In der formatio der Übung kann sich eine transformatio ereignen; die Wiederholung der Tätigkeiten kann zu einem Ereignis und zu einer existenziellen Erfahrung führen, die Anstrengung und Überwindung im Üben führt zur Erfahrung von Flow, Gelassenheit und Achtsamkeit. Im scheinbaren Paradox der angestrengten Entspannung bzw. des fokussierten Loslassens verbirgt sich die Produktivität und Kreativität des Übens, die auch zur Erfahrung der Fülle des Augenblicks, zum Anhalten des Bewusstseinsstroms und zum Innehalten und Verzögern alltäglicher Verrichtungen führen kann. Deshalb werden im letzten Teil didaktische Praktiken des Übens als Praktiken der Verzögerung bestimmt. Üben changiert also zwischen Kontinuität und Diskontinuität, zwischen Fokussierung und Gelassenheit, zwischen Habitus und Transformation bzw. Selbstführung und Fremdführung.
Die Praktiken des asketischen, meditierenden, geistigen oder spirituellen Übens sind nie nur auf das Individuum bezogen. Sie finden in einem sozialen, gesellschaftlichen und machtförmigen Raum statt, der – das ist die dritte oben angesprochene Struktur in diesem Buch – in sozialtheoretischer Perspektive eingeholt wird. Üben findet auch durch Andere angeleitet und vor Anderen statt. Damit ist Üben auch eine Praxis der Macht, die aber, wie oben dargestellt, nicht nur unterwerfend und disziplinierend bzw. normalisierend ist. Die Erfahrung im Üben impliziert auch – das werde ich mit Foucault verdeutlichen – widerständige Momente und Freiheitsspielräume. Das Ziel der performativen Übung wird damit als ein Selbstkönnen bestimmt, in dem neben disziplinierenden, normalisierenden immer auch ereignishafte und singuläre Momente konstitutiv sind.
Diese Einsichten werden schließlich in edukativer Perspektive für eine Didaktik der Übung fruchtbar gemacht. Übung als intersubjektive und edukative Praxis in der Lehre, im Unterricht oder in pädagogischen Settings soll Üben als individuelle Praxis anleiten, unterstützen und ermöglichen. Übungen funktionieren ein- und ausschließend, disziplinierend und normalisierend und zugleich ermöglichend und formierend. Im machtförmigen Spannungsgefüge zwischen Selbstsorge und Fürsorge wird die Didaktik der Übung als Kunst der Verschränkung von Aus-, Selbst- und Fremdführung bestimmt. Die Didaktik der Übung wird systematisch auf unterschiedliche Felder bezogen und sach- und fachbezogen dargestellt.
Der hier vorgestellte Zugang zum Phänomen und zur Praxis des Übens wird im bildungs- und erziehungstheoretischen Diskurs der Allgemeinen Erziehungswissenschaft verortet, einer Disziplin, die auf den produktiven Austausch mit Didaktik und Fachdidaktiken nicht verzichten kann. Neben den bildungs- und erziehungswissenschaftlichen Aspekten stehen in diesem Buch schulische und unterrichtliche im Mittelpunkt. Das ist nicht nur der Berufsbiographie des Autors geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass zwar keine Unterrichtsstunde ohne Üben auskommt, Üben aber gleichwohl und vor allem in der Schule, in der Unterrichtslehre und -forschung sowie in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung eine vergessene und verkannte Praxis ist.
Das Buch besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden systematische, theoretische, historische, interkulturelle und didaktische Aspekte des Übens und der Übung entfaltet. Der zweite Teil des Buches ist für konkrete Felder des Übens reserviert. Hier werden Bewegen, Imaginieren bzw. Phantasieren, Verstehen, Urteilen, Kritisieren sowie Unterrichten als Praxen des Übens in den domänen- und fachspezifischen Feldern und Diskursen vorgestellt.
Im ersten Kapitel werden zunächst wichtige Kennzeichen des Übens herausgearbeitet und in sieben Punkten überblickshaft und einführend dargestellt. Kapitel 2 beschreibt die europäische Geschichte des Übens von den antiken und mittelalterlichen Praktiken des Übens bis in die Neuzeit und die Reformpädagogik. Mit Rabbow, Hadot und Foucault wird askesis als gleichermaßen geistiges und körperliches Üben bestimmt und als Praxis der Selbstsorge ausgewiesen, in der Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für sich und andere eingeübt wird. Üben hat in der Antike eine ethische Dimension, die sich praktisch zu einem ethos (Haltung) verdichten kann. Im Mittelalter wird Üben auf ein überweltliches Heil ausgerichtet. Religiöse Exerzitien nehmen in ihrer praktischen Ausführung einen ästhetisch-sinnlichen Charakter an. Sowohl die ästhetisch-sinnliche als auch die praktisch-ethische Dimension des Übens gehen in der Neuzeit verloren. Hier dominiert der technisch-mechanische Aspekt in der »Schwarzen Pädagogik«, aber auch in der Reformpädagogik. Das Kapitel endet mit einem Ausblick auf eine aktuelle »Wiederkehr der Übung« ( Kap. 2.1) und auf aktuelle Probleme und Fragen der Übungstheorie und Übungsforschung ( Kap. 2.2).
Im dritten Kapitel wird ein interkultureller Blick auf das Üben in China geworfen. Dieses kann jenseits westlicher, kulturalistischer Marginalisierungen und Exotisierungen eine andere Perspektive auf diese Praxis bieten ( Kap. 3.1). Vor dem Hintergrund des Konfuzianismus ( Kap. 3.2) wird deutlich, dass Üben in China erstens mit einer positiv konnotierten Anstrengungs- und Überwindungsbereitschaft verbunden wird, zweitens eine achtsame Atmosphäre und eine konzentrierte Haltung in angespannter Entspannung bei gleichzeitiger entspannter Angespanntheit verlangt und drittens sowohl breites Wissen als auch tiefes Verstehen ermöglicht ( Kap. 3.3).
In Kapitel 4 erfolgt eine lern-, erfahrungs- und sozialtheoretische Grundlegung des Übens. Zunächst werden die lern- und erfahrungstheoretischen Hintergründe dargestellt. Auf der Grundlage einer operativen Unterscheidung von Lernen und Erziehen bzw. Üben und Übung werden dann mit Günther Buck die Grundlagen einer pädagogischen Theorie des Lernens als und aus Erfahrung verdeutlicht. Bildende Erfahrungen sind Lernerfahrungen, in denen umgelernt bzw. umgeübt wird ( Kap. 4.1). Sodann wird Üben als besondere Lernform in fünf Punkten ausgewiesen und Lernen von Üben unterschieden ( Kap. 4.2). Nach einer Kritik an kognitivistischen Lerntheorien, in denen Üben lediglich als sekundäre, unproduktive und konservative Lernform missverstanden wird ( Kap. 4.3), folgt eine sozialtheoretische Vergewisserung, mit der aktuelle Suchbewegungen der Erziehungs- und Bildungstheorie aufgenommen werden ( Kap. 4.4). Verkörperung, (Ex-)Position und Vulnerabilität als Praxen und Dimensionen des Antwortens mit und vor Anderen werden schließlich als Kategorien einer erfahrungs- und sozialtheoretisch orientierten Theorie des Übens ausgewiesen.
In Kapitel 5 werden drei Strukturen des Übens – Leiblichkeit, Temporalität und Machtförmigkeit – in einer erfahrungs-, bildungs- und sozialtheoretischen Analyse vorgestellt. Üben kann so als leibliche wiederholende, disziplinierende und gleichermaßen transformatorische Praxis beschrieben werden. Zugleich kann es vom Lernen, vom Bilden, vom Wiederholen, vom schieren Disziplinieren und Unterdrücken abgegrenzt werden.
In Kapitel 5.1 werden zunächst die leiblichen, gestaltförmigen und impliziten Strukturen des Übens dargestellt. Üben wird als leibliche und performative Praxis der Verkörperung beschrieben. Dazu werden wichtige Aspekte der Leibphänomenologie für die Erfahrung und die Praxis des Übens fruchtbar gemacht: in Untersuchungen zur Struktur- und Gestaltübung ( Kap. 5.1.1), zum impliziten Wissen des Übens ( Kap. 5.1.2), zum Aufbau eines Körperschemas im Üben ( Kap. 5.1.3) sowie zum Üben als Praxis der Verkörperung und Selbstsorge ( Kap. 5.1.4).
In Kapitel 5.2 wird Wiederholung als Kern des Übens ausgewiesen. In einer zeitphänomenologischen und zeittheoretischen Perspektive wird zunächst Üben von Wiederholen abgegrenzt ( Kap. 5.2.1), die Wiederholungsstruktur zeitphänomenologisch, diskurstheoretisch und dekonstruktiv bestimmt ( Kap. 5.2.3). Schließlich wird mit der Perspektive auf die temporale Differenz seine existenzielle Performativität ( Kap. 5.2.4) kenntlich gemacht. Die Performativität des Übens wird im Kontext einer existenziellen Dimension der Zeiterfahrung manifest, in der Flow, Gelassenheit oder Achtsamkeit bzw. mindfulness erfahrbar werden.
Kapitel 5.3 beschreibt und analysiert die Macht des Übens. Üben als Praxis der Macht zu betrachten ermöglicht, sowohl seine normalisierenden und unterwerfenden Effekte als auch die produktiven und kreativen Potenziale zu erfassen. Mit Foucault werden drei Formen der Übung vorgestellt, die disziplinierende, die asketische und die pastorale Übung. Auf Grundlage der europäischen Geringschätzung des Leibes und des Übens wird Üben in der Neuzeit zur Disziplinarübung. Mit Foucault werden Kennzeichen dieser Praxis des Machtwissens, der Subjektivation und der Normalisierung genauer dargestellt ( Kap. 5.3.1). Danach werden knapp die antiken Übungspraktiken der Selbstsorge ( Kap. 5.3.2) und dann – ausführlicher – jene des Christentums, d. h. der christlichen Exerzitien ( Kap. 5.3.3), vorgestellt. Diese sind im Kontext einer pastoralen Macht zu verorten, in welcher die machtvolle Fürsorge des Exerzitienmeisters mit der abhängigen Selbstsorge der Übenden zusammenfällt.
Das sechste Kapitel widmet sich den mentalen Übungspraktiken. Als Bewusstseinsübungen findet man sie in der europäischen Antike (askesis), im fernöstlichen Buddhismus und in den philosophischen Meditationen. Geistiges Üben hat eine ethische Ausrichtung. Als Übungen der Selbstsorge ( Kap. 6.1) zielen sie darauf, ein gutes Leben führen zu können, und streben Wachheit, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit an. Sie sind immer leiblich fundiert und beziehen sich auf eine konkrete Tätigkeit, die ein- und ausgeübt wird, wie Essen, Atmen, Sehen und Sprechen. Meditierende Übungen zielen zudem auf eine Wandlung des Selbst, die durch Loslassen und Gewahrwerden bei gleichzeitiger Anspannung und Entspannung erreicht werden soll ( Kap. 6.2). Philosophische Meditationen ( Kap. 6.3) sind reflexive Übungen, die sich auf Gedanken, Sachen oder Probleme beziehen und in einer Praxis (des Schreibens, Gehens, Dialogisierens) ausgeübt werden. Nachdem die unterschiedlichen antiken, fernöstlichen und philosophischen Praktiken der Meditation vergleichend vorgestellt und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgestellt wurden, schließt das Kapitel mit einem kritischen Ausblick auf neurophänomenologische Perspektiven auf Übungen der Achtsamkeit, die aktuell unter dem Titel Embodiment, Awareness und Mindfulness ( Kap. 6.4) Konjunktur haben.
Im siebten Kapitel wird die pädagogische Übung als edukative Praxis vorgestellt. Ich gehe davon aus, dass die individuelle Praxis des Übens von ihrer edukativen, machtförmigen Inszenierung als Übung zu unterscheiden ist. Pädagogische Übungen zielen darauf, andere zum Üben anzuregen, sie zu unterstützen, aber auch sie zu disziplinieren oder zu normalisieren. Diese Ambivalenz zwischen Freiheit und Zwang bzw. zwischen Selbstsorge und Fürsorge teilt sich die Übung mit anderen pädagogischen Praktiken. Sie macht eine Reflexion auf die Ziele der Übung sowie auf Normen und Werte notwendig ( Kap. 7.1). Erst wenn die Perspektive von den Erfolgen, Ergebnissen und zu optimierenden Leistungen auf den Prozess und die Erfahrungen im Üben verschoben wird, kann Übung als Kultivierung von Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie als Einübung von Haltungen kenntlich werden. Dazu werden in diesem Kapitel die leiblichen, wiederholenden und machtförmigen Strukturen des Übens noch einmal aufgegriffen und als Grundlage der edukativen Übung ausgewiesen ( Kap. 7.2). Danach werden Aspekte einer Didaktik der Übung entwickelt: Beschränkung, Isolation, Gestalt-, Situations- und Kontextbezug sowie Variation, Rekomposition und Polarisation werden als didaktische Mittel ausgewiesen ( Kap. 7.3). Die Übung kann so in Abgrenzung zur traditionellen und aktuellen Unterrichtslehre als Anfang und Beginn des Lernens bestimmt werden ( Kap. 7.4). Die Perspektive auf die negativen Erfahrungen wird schließlich mit Blick auf reflexive Übungsformate noch einmal geschärft ( Kap. 7.5). Deutlich wird, dass in der didaktischen Übungspraxis die unterstützende und positive Einstellung der Pädagoginnen und Pädagogen den negativen Erfahrungen im Üben gegenüber entscheidend ist. Sie können als didaktische Bewährungsprobe und zugleich als zentrale Erfahrungsmomente der Übung gelten.
Der zweite Teil des Buches stellt in Einzelstudien ausgewählte Gegenstände des Übens in ihren Feldern dar. Jede Übungspraxis hat einen Inhalt, einen Stoff bzw. einen Gegenstand. Diese Gegenstände strukturieren sowohl den Erfahrungsprozess im Üben als auch die Erfordernisse einer bereichs- und fachspezifischen Didaktik. Sie werden in Kapitel 8 in einer allgemeinpädagogischen, erfahrungs-, bildungs- und sozialtheoretischen Perspektive dargestellt, wobei sich die Auswahl auf Bereiche konzentriert, die für Bildung, Lernen und Erziehung in demokratischen Gesellschaften bedeutsam sind: Kreativität und Phantasie, Verstehen bzw. Fremd-Verstehen unter Bedingungen von Fremdheit, Pluralität und Diversität sowie Urteilen und Kritisieren. Bewegen, Imaginieren, Verstehen, Kritisieren, Urteilen sowie Unterrichten werden als exemplarische Felder und Praxen des Übens vorgestellt, gegenstandstheoretisch bestimmt sowie domänen- und fachspezifisch analysiert. Diese sind Felder der leiblich-körperlichen Bewegungsübung ( Kap. 8.1), der geistigen Übung der Imagination ( Kap. 8.2), des Verstehen-Übens von Anderen und Fremdem ( Kap. 8.3) sowie des Urteilens und Kritisierens in demokratischen Gemeinschaften ( Kap. 8.4). Das Kapitel endet mit einer Untersuchung zum Lehren üben als Form der Professionalisierung von Lehrerinnen und Lehrern ( Kap. 8.5). Hier werden Möglichkeiten und Grenzen der Übung in hochschuldidaktischen Settings dargestellt mit dem Ziel, eine professionelle Haltung im Sinne eines Ethos ein- und auszuüben.
Kapitel 8.1 widmet sich dem Bewegen üben. Hier werden zunächst an einem Beispiel aus der qualitativen phänomenologischen Bildungsforschung Perspektiven auf frühkindliches Greifen und Begreifen vorgestellt ( Kap. 8.1.1), sodann wird Üben als Desiderat und zugleich als zentrale Praxis der Sportpädagogik ausgewiesen ( Kap. 8.1.2). Dazu werden leibphänomenologische und erfahrungstheoretische Grundlagen des Übens im Sport ( Kap. 8.1.3) vorgestellt sowie kurze Überlegungen zu einer Didaktik der Übung im frühkindlichen und im sportpädagogischen Bereich angestellt.
Kapitel 8.2 widmet sich den Imaginationsübungen und damit dem Bereich der kulturellen Bildung. Entgegen landläufiger Vorurteile wird hier deutlich, dass auch Imagination und Kreativität geübt werden können. Inspiration und Transpiration sind keine Gegensätze. Das wird am Beispiel der geistlichen Übungen von Ignatius von Loyola exemplarisch vorgeführt. Die Didaktik der Imaginationsübungen ( Kap. 8.2.5) wird eingebettet in eine Darstellung der Geschichte der Imaginationsübung ( Kap. 8.2.1) und in eine Überblicksdarstellung zur Bildungstheorie und Didaktik der Imagination bzw. Kreativität ( Kap. 8.2.2). Die Anthropologie als »Anwendung der Sinne« ( Kap. 8.2.3 und 8.2.4) der Exercitia spiritualia zeigt überzeugend, dass Imaginationen, Vorstellungen, Phantasie und Kreativität geübt werden können, dass es dazu aber einer besonderen Sensibilität, eines pädagogischen Taktes bedarf, um die besondere negative Erfahrungsstruktur zwischen Einbildung und »Entbildung« (Meister Eckart) sowie zwischen Selbstführung und Fremdführung erfassen und umsetzen zu können.
Kapitel 8.3 stellt die Praxis des Verstehens als grundlegenden Zugang zur Teilhabe an einer Kultur und ihrer aktiven Gestaltung in den Mittelpunkt. Verstehen ist für das Hineinwachsen in Kultur und Gesellschaften ebenso zentral wie für die Teilhabe an gesellschaftlichen Praktiken, vom Lesen bis hin zur demokratischen Mitbestimmung. Verstehen und Verstehen üben wird auf der Grundlage erfahrungs- und bildungstheoretischer sowie phänomenologischer Zugänge als leibliche bzw. zwischenleibliche Praxis, als ein verkörpertes Antworten vorgestellt, das einerseits auf einer Verständigung beruht, die auf dem Boden eines allgemeinen Horizonts und auf der Grundlage gesellschaftlicher und normalisierender Ordnungssysteme ein Verstehen überhaupt erst ermöglicht. Andererseits beruht es auf einem »grammatischen« Verstehen kultureller Symbole und ihrer Symbolsysteme. In dieser Hinsicht ist Verstehen auf Verständlichkeit bezogen, insofern als diese kulturellen Symbolsysteme in der Schule Gegenstand des Unterrichts sind. Zunächst wird in Abgrenzung von hermeneutischen Theorien des Verstehens nach Dilthey und Gadamer das Fremd-Verstehen als Antworten mit Scheler und Waldenfels herausgearbeitet ( Kap. 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3). Danach wird die Doppelstruktur des Verstehenübens zwischen leiblich-basierter Verständigung und kulturell-grammatischem Verstehen anhand von drei Beispielen verdeutlicht ( Kap. 8.3.4). Pädagogisches Verstehen und Verstehen üben wird, so die These, in einem Zwischenraum zwischen Verstehen als Verständigung einerseits und grammatischem Verstehen kultureller Symbolsysteme andererseits verortet ( Kap. 8.3.5).
Für Demokratiebildung und -erziehung sind die Praxis des Urteilens und des Kritisierens von zentraler Bedeutung. Kapitel 8.4 widmet sich diesem Feld als einer besonderen Sache des Übens. Kritisieren und Urteilen werden als leibliche bzw. zwischenleibliche Praxen verstanden, die auf einem elementar-reflexiven Wiederholungsgeschehen basieren ( Kap. 8.4.1 und 8.4.2). Zunächst wird die interkorporale Dimension der Reflexivität und des Urteilens mit Merleau-Ponty und Heidegger am Beispiel des Händedrucks herausgearbeitet ( Kap. 8.4.3). Danach wird Kritisieren als politische Praxis der Positionierung unter vulnerablen und prekären Bedingungen im öffentlichen Raum bestimmt ( Kap. 8.4.4). Schließlich werden Möglichkeiten erwogen, Urteilen und Kritisieren zu üben. Hier werden Praktiken der Verzögerung und der Distanzierung als Modi des Urteilenübens vorgestellt ( Kap. 8.4.5). Urteilen wird als eine Praxis des Unterscheidenkönnens sowie als distanzierende und einklammernde Bewegung der Unterbrechung dargestellt ( Kap. 8.4.6). Urteilen wird damit als Voraussetzung für Kritik als »Grenzhaltung« (Foucault) im öffentlichen Raum ausgewiesen, die sich auf die Inhalte, auf Beziehungen, Ordnungen und Systeme gleichermaßen verzögernd zurückwendet. Insofern können Urteilen üben und Kritik üben als wesentliche Praxen von Demokratie und Postdemokratie gelten.
Das letzte Kapitel widmet sich dem Unterrichten üben als besonderem Feld der Professionalisierung ( Kap. 8.5). Hier werden die erfahrungstheoretischen Überlegungen wieder aufgenommen und die Differenz zwischen Theorie, Praxis und Erfahrung in Bezug auf Unterricht, Unterrichten üben und Unterrichtsforschung fruchtbar gemacht ( Kap. 8.5.1 und Kap. 8.5.2). Unterrichten üben wird für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung an Beispielen der Unterrichtsforschung als »Form der Professionalisierung« und als propädeutisches Unterrichten üben ausgewiesen ( Kap. 8.5.3). Dazu wird Fallarbeit als Beispielverstehen hochschuldidaktisch als eine Methode des Lehrenübens dargestellt. Das Praxisbeispiel wird dann in seinen didaktischen und bildenden Funktionen bestimmt und schließlich werden Haltung und Ethos in professionellen Kontexten übungstheoretisch genauer dargestellt ( Kap. 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6). Mit dem Unterrichten üben kann also eine Verbindung von theoretischem und reflexivem Wissen für die pädagogische Praxis erfolgen. Es wird möglich, bildende Erfahrung hochschuldidaktisch zu inszenieren und damit Voraussetzungen für eine urteilskräftige, reflektierende und forschende Haltung zu schaffen ( Kap. 8.5.7).
Mit den in diesem Buch dargestellten Aspekten einer Geschichte und Theorie des Übens verbindet sich die Hoffnung, dass diese als Anlässe einer weiteren Übungsforschung dienen, die sich jeweils feldspezifisch verortet und die fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Diskurse aufnimmt mit dem Ziel, Üben als kreative und produktive Praxis zu rehabilitieren.
1 Ich danke Elisabeth Münder und Samira Trummer für die aufmerksame Korrektur und Formatierung des Textes sowie für wertvolle Hinweise. Daniel Pastenaci danke ich für die Suche nach geeigneten Bildern sowie für die Erstellung des Abbildungsverzeichnisses.