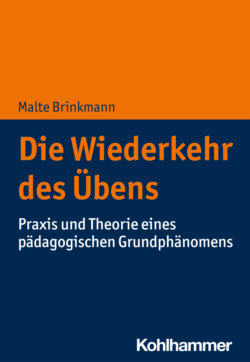Читать книгу Die Wiederkehr des Übens - Malte Brinkmann - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.1 Westliche Vorurteile
ОглавлениеDas Bild des Westens von Asien, von China, Indien, Japan, Korea und Vietnam ist doppelgesichtig. Zum einen herrschte lange und bis heute ein kolonialistisch geprägtes Bild von »den« Asiaten vor. Stereotype wurden und werden nach wie vor transportiert: Asiaten treten in Gruppen auf, legen wenig Wert auf Individualität, ihre Emotionen sind nicht lesbar, ihre Konventionen sind fremd und vor allem ist das Üben und Lernen nachahmend, kopierend und repetitiv, d. h. ohne Kreativität, Originalität, Reflexivität und Kritik. Dieses Bild erhielt in den letzten Jahrzehnten Risse, die nicht nur auf eine postkolonialistische Perspektive auf Differenz und Fremdheit zurückgehen (vgl. Jullien/Köller 2002), sondern auch dem Wiedererstarken Chinas als ökonomische, militärische und wissenschaftliche Weltmacht geschuldet sind. Der westliche Blick nach Osten ist auf der anderen Seite von einer unkritischen Romantisierung und Faszination geprägt. Asiatisches Leben und Lebensformen werden in ihrem Exotismus verklärt, oftmals ohne die kulturellen und historischen Differenzen zu beachten.10 Gerade in der verklärenden Betonung dieser Andersheit und in der Klassifizierung und Ausgrenzung der Asiaten als Andere und Fremde (othering) werden wiederum eurozentrische Vorurteile und Perspektiven verstärkt.
Mit der PISA-Studie, dem Erfolg der asiatischen und chinesischen Schülerinnen und Schüler und der damit ausgerufenen »Bildungskrise« in Deutschland setzt ein Blickwechsel auch in den Erziehungswissenschaften nach China ein, der bis heute andauert. Der Erfolg der chinesischen Schülerinnen und Schüler verführt viele dazu, ungeachtet aller historischen, kulturellen und politischen Differenzen China als Vorbild anzupreisen. Populärwissenschaftliche Bücher zum chinesischen Bildungssystem wurden zu Bestsellern (vgl. Chu 2017). Die chinesischen Schülerinnen und Schüler sowie die chinesische Mentalität gelten hier als Vorbild. Westliche kapitalistische Vorstellungen von Erfolg, Optimierung und Wettbewerb werden mit traditionellen chinesischen Werten wie Anstrengungsbereitschaft, Ausdauer und Härte gegen sich selbst und andere zu einer autoritativen Vorstellung von Übung und Erziehung kompiliert (vgl. Chua 2011).
In Abgrenzung zu diesen disziplinatorischen und autoritativen Rezeptionen des chinesischen Übens ( Kap. 5.3 zur Macht der Übung) sollen im Folgenden seine Ambivalenzen herausgearbeitet werden – auch für die chinesische Praxis des Übens. Es wird versucht, zwischen Exotisierung und Marginalisierung einen anderen, nüchterneren Weg einzuschlagen, auch wenn kulturalisierende Deutungen und Zuschreibungen in Anbetracht kultureller Fremdheit und Andersheit letztlich nicht ganz ausgeschlossen werden können.
In der international-vergleichenden Forschung setzte schon mit den 1990er Jahren ein starkes Interesse am Chinese Learner ein, das sich dann mit den PISA-Erfolgen der asiatischen Staaten noch verstärkte. Es wurde schnell klar, dass erstens westliche Fehlkonzeptionen und Vorurteile den Blick auf die Praxis des Übens und Lernens verstellen (Biggs 1996) und zweitens der kulturelle und historische, insbesondere konfuzianistische Hintergrund in die Analysen einbezogen werden muss (Lee 1996). Mittlerweile hat sich dieser Forschungszweig fest etabliert (vgl. Trumpa et al. 2017). Der anfangs erwähnte elementare Zusammenhang zwischen Üben und Lernen, von Wiederholung und Innovation bzw. von Konzentration und Kreation wurde, wie ich zeigen möchte, in diesen Forschungen mehrfach bestätigt. Zunächst ist es für westlich geprägte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schwierig, einen Zugang zum traditionell orientierten Denken und zur chinesischen Praxis zu erhalten. Diese wird in Erzählungen, Gleichnissen und Geschichten weitergegeben. Lebensweisheiten werden in Form von Sentenzen und Sprüchen, beispielsweise von Konfuzius oder Mencius, weitergegeben und müssen dann jeweils neu interpretiert werden. Dieser nicht-begriffliche, metaphorische Zugang prägt auch die chinesische Kultur der Prüfungen und das chinesische Bildungswesen seit 1.000 Jahren (vgl. Xu 2007). Es erschwert zusätzlich den Zugang. Einige Forscherinnen und Forscher haben daher Wortfelduntersuchungen angestellt, um bestimmte Begriffe zu kontextualisieren und ihre praktische Relevanz zu erschließen (vgl. Li 2012). Wie die griechische Philosophie ist auch die chinesische Philosophie und Kultur auf Praxis als praktische und ethische Lebenskunst gerichtet.