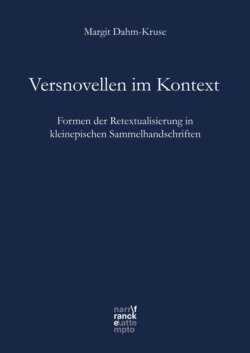Читать книгу Versnovellen im Kontext - Margit Dahm-Kruse - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Die variable Form des Textes 3.1 Manuskriptkultur
ОглавлениеEine Untersuchung, die nach Verfahren literarischer Formgebung in der mittelalterlichen Literatur fragt, richtet zwangsläufig besonderen Fokus auf die handschriftliche Überlieferung. Die Manuskriptkultur stellt per se die konkrete und spezifische Form mittelalterlicher Textualität dar; ungeachtet aller Überlegungen zu Mündlichkeit und Performanzkultur sind es die Handschriften, in denen die Literatur des Mittelalters überliefert und der Rezeption zugänglich ist. In den Handschriften hat die Alterität des Mittelalters ihre unbestreitbare Ausformung, denn die Manuskriptkultur markiert einen oder sogar den zentralen Unterschied zur modernen Literarizität.1 Der Codex stellt, indem er den Wortlaut des Textes sichert, erschließt und präsentiert, die faktische Überlieferung des Textes dar. Dabei sind die materiellen Aspekte nicht als isolierte Variablen zu betrachten, die äußere Form der Handschrift hat auch bedeutungstragende Dimensionen:
Was für das Erkenntnis- oder Erinnerungsangebot gilt, das von Bildern ausgeht, gilt, mutatis mutandis, ebenso für die Gestalt des Textes auf der Seite selbst: Ihm eignet eine kognitive Komponente. Diese Aussage ist grundsätzlich für das Manuskript wie für den Druck gültig. Eine Seite ist immer zugleich ein „Bild“, das heißt, das Layout hat seine spezifische kognitive Funktion, die die Lektüre, das Verinnerlichen und Verstehen des Textes steuert.2
Dabei ist jede Handschrift ein Unikat, das einen ganz anderen Zugang zum literarischen Text bedingt als das universale und reproduzierbare gedruckte Buch der Neuzeit.3 Zwar sind auch die mittelalterlichen Handschriften „immer an einen Typus gebunden und formal konservativ“,4 aber sie kennen nicht die Einförmigkeit der seriellen Erzeugung. Eine literaturwissenschaftliche Analyse auf Basis des Manuskripts umfasst nicht (nur) eine isolierte kodikologische Betrachtung der materiellen und paläographischen Eigenschaften der Handschrift, sondern stellt diese in enge Wechselwirkung mit der Produktion und Rezeption von Literatur. Die handschriftliche Texterstellung als Teil des literarischen Prozesses zu verstehen, heißt „die Materialität der Manuskripte als eine komplexe Symptomatologie zu nutzen, welche uns die historisch spezifischen Formen im Umgang mit der Text- und der Sinndimension erschließt.“5
Dass das literarische ‚Werk‘ des Mittelalters nicht allein über seinen Text- oder Wortbestand erfassbar ist, sondern seine Sinnstiftungen sich auch über die konkrete Gestaltung im Codex entfalten, dass die Handschrift die Grundlage jeder Texterschließung darstellt,6 gehört längst zu den grundlegenden Prämissen der mediävistischen Literaturwissenschaft. Gegenüber der in der älteren Forschung dominierenden Haltung, Textzeugen nur als Material für die Rekonstruktion der dichterischen ‚Werke‘ zu betrachten, ohne diesen eine eigene Bedeutung beizumessen, hat sich eine Perspektivierung etabliert, die jede einzelne Handschrift auch als einen „konkreten Anhaltspunkt für den Umgang mit Literatur und das Interesse daran“7 zur Kenntnis nimmt und die Codices in ihrer Materialität als „wichtige literatur- und kulturhistorisch relevante Informationsträger“ anerkennt.8
Die New oder Material Philology hat dabei nicht den entscheidenden Paradigmenwechsel herbeigeführt, den sie für sich beansprucht, aber sie hat die Neuakzentuierung im Umgang mit den Handschriften nachhaltig und pointiert in den Fokus der germanistischen Diskussion gestellt, indem sie die Materialität der Codices nicht mehr nur in ihrer Relevanz für die editorische Praxis in den Blick nahm,9 sondern „eine neue Konzentration auf die materiale Phänomenologie der mittelalterlichen Manuskripte“ forderte, die die mittelalterliche Handschriftenkultur in ihrem historisch spezifischen Umgang mit dem Text und dessen Sinndimensionen betrachtet.10
Entscheidungen über das Layout und die Präsentation des Textes werden auch für das gedruckte Buch getroffen, die Handschrift ist durch ihre Individualität und Unikalität aber ein historisches Dokument, das in besonderem Maße seinem kulturellen Kontext Rechnung trägt.11 Die Handschrift hat schon eine wichtige performative Funktion, indem die ästhetische Gestaltung auch ihren Repräsentationsanspruch widerspiegelt. Die Gestaltung des Codex korreliert häufig mit dem enthaltenen Texttyp, so erfahren bestimmte Textsorten, insbesondere geistliche Texte, in der Regel besondere gestalterische Wertschätzung.12 Der Codex erlaubt auch Rückschlüsse auf seinen Gebrauchszusammenhang, indem verschiedene Gebrauchstypen in der Regel auch nach unterschiedlichen Parametern gestaltet sind.13
Die Handschrift konstituiert Bedeutung auch jenseits des eigentlichen Textes. Bunia hält in Rekurrenz auf Luhmanns Medien-Begriff sowohl für den handschriftlichen Codex wie auch für das gedruckte Buch der Neuzeit fest,14 dass „das Buch ein Medium [ist], in dem Zeichen, Bilder und Anordnungen die möglichen Formen bilden.“15 Dabei hat das Buch nicht nur die Funktion, Schrift zu fixieren, sondern es besitzt darüber hinaus auch „die Fähigkeit zu einer eigenständigen, von Sprache sehr unabhängigen Formenbildung“.16
In der Handschrift amalgamieren verschiedene Ebenen der Formgebung, indem neben der eigentlichen Verschriftlichung des Textes auch über dessen räumliche Gestaltung auf der Seite entschieden wird. An der Erstellung des Codex als „polyphonem Sinnzusammenhang“ sind verschiedene Instanzen beteiligt,17 außer den Schreibern bzw. Kompilatoren sind gegebenenfalls auch Rubrikatoren, Illuminatoren und Kommentatoren in den Entstehungsprozess eingebunden. Das mise en page ist von erheblicher Relevanz für den literarischen Text, indem die handschriftlichen Zeichensysteme aus Schriftform, Einrichtung der Seite und räumlicher Organisation der Texte sowie Initialen, Schmuck und Bilder auf ihren strukturierenden und sinngebenden Funktionszusammenhang untersucht werden können.18 Die seit dem 13. Jahrhundert zunehmend in volkssprachigen Handschriften fassbaren Gliederungssysteme werden verschiedentlich als Indizien einer lesenden Rezeption gesehen:19
Ein mit Initialen, Majuskeln und Rubrizierungen gegliedertes, vielleicht sogar noch mit einem Register versehenes Exemplar läßt sich unschwer als Lesebuch bzw. als Nachschlagewerk identifizieren. Bei den fortlaufend geschriebenen, nur mit spärlichen Gliederungsattributen versehenen frühen Epen-Handschriften spricht demgegenüber vieles für eine Verwendung als Vorlesebuch.20
Für die Untersuchung von Text-Kontext-Relationen in den kleinepischen Sammelhandschriften ist insbesondere das mise en page unverzichtbarer Bestandteil der Analyse. Die Handschrift bildet nicht nur die individuelle Gestaltung des Einzeltextes ab, sondern auch dessen Einpassung in den Kontext der Sammlung. Indem Texte entweder im Verbund gestaltet oder klar voneinander abgegrenzt erscheinen, indem die im Codex inserierten Texte entweder ähnlich gestaltet oder einzelne Texte/Textverbünde besonders hervorgehoben werden, kann das Manuskript Aufschluss über intendierte Sinnzusammenhänge zwischen den aufgeführten Dichtungen geben: „Im Zusammenstellen und Präsentieren von Texten in Sammelhandschriften erfolgt eine Interpretation dieser Texte.“21