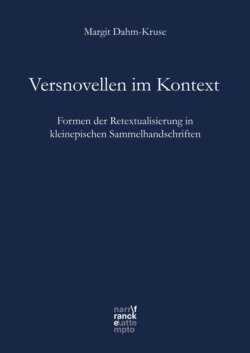Читать книгу Versnovellen im Kontext - Margit Dahm-Kruse - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Versnovellistisches Erzählen 2.2.1 Tradition und Transgression
ОглавлениеNachdem die Diskussion über eine exakte Definition und Systematik der Versnovellen andere Fragestellungen lange überlagert hatte,1 erschienen in den letzten Jahren vermehrt Forschungsarbeiten, die sich der Poetik versnovellistischen Erzählens und seinem spezifischen Zugriff auf die verhandelten Themen und Motive widmeten und die die Texte auch im Kontext ihrer literarischen Traditionszusammenhänge analysierten.2 Das spannungsvolle Verhältnis zur lateinischen Tradition, das kennzeichnend für das volkssprachige Literatursystem an sich ist und das sowohl auf einer Adaptation der lateinischen Bildungswelt als auch auf einer Emanzipation und Loslösung von deren Paradigmen basiert,3 ist auch konstitutiv für die Genese der Versnovellen. Die versnovellistischen Texte sind in der Tradition des lateinischen Exemplums verwurzelt.4 Insbesondere die Kleindichtung des StrickersStricker, der als erster und traditionsstiftender Repräsentant der versnovellistischen Dichtung gilt,5 verweist auf die vielfältige Tradition mittellateinischer Lehrdichtung:
die Untersuchung der Relation zwischen den mittelhochdeutschen kleinepischen Formen und der zeitgenössischen mittellateinischen Literatur [zeigt] mit erstaunlicher Eindeutigkeit, dass die Suche nach Vorläufern, Modellen und Verwandten der Strickerschen Erzählungen in den Bereich des mittellateinischen exemplum führt.6
Zumeist sind dabei keine unmittelbaren Vorlagenbeziehungen,7 aber eine intensive inhaltliche als auch erzähltechnische Prägung erkennbar.
Das Argumentieren mit Beispielerzählungen ist seit der Antike ein präsentes Mittel der Plausibilisierung und der Wissensproduktion,8 wobei von Moos zwei Typen unterscheidet. Das historische Exemplum zielt auf einen beweisenden Vergleich, indem eine historische Figur oder ein historisches Ereignis aufgerufen werden, um mit Hilfe des Geschichtsvergleichs die eigene Argumentation zu stützen. In dieser Form ist das Exemplum in das christliche Schrifttum eingegangen und spielt seit den Kirchenvätern eine wichtige Rolle. Mit der Erinnerung an denkwürdige Ereignisse aus der Geschichte oder der Biographie besonderer Personen wird zur Reflexion aufgefordert und christliche Lehre bewiesen.9 Daneben wurde der Typus des narrativen Exemplums geprägt, das durch eine kurze narrative Einlage einen übergeordneten moralischen Sachverhalt veranschaulichen soll. Das Exemplum ist dabei weniger als eigenständige Gattung zu verstehen denn als rhetorischer Funktionsbegriff oder argumentative Methode, die von verschiedenen, auch volkssprachigen Erzähltypen oder Gattungen aufgenommen werden kann:
Allerdings ist das mittelalterliche exemplum, der antiken Definition entsprechend, ein rein argumentatives Element, das nur ‚funktionieren‘ muß und gattungsmäßig in keiner Weise gebunden ist, so daß seine Autoren in der Realisierung der exemplarischen Prinzipien eine relative Freiheit genießen.10
In der Mediävistik ist eine engere Begriffsverwendung etabliert, die das Exemplum synonym zum volksprachigen ‚Predigtmärlein‘ als Begriff für die Tradition der illustrativen Kurzerzählungen verwendet, die seit dem 13. Jahrhundert zunehmend in Predigten zur Veranschaulichung ihres Lehrgehalts Verwendung fand.11 Als eingefügte, unterhaltsame Narration mit der Funktion, ein Anliegen – etwa die heilsame Lehre der Predigt – zu veranschaulichen, ist das Exemplum vor allem ein Mittel der Persuasion. Sein Zweck besteht nicht (allein) in dem narrativen Gehalt der erzählten Geschichte, sondern vor allem in seiner argumentativen Funktion für ein übergeordnetes Anliegen, es ist
niemals eine autonome, kontextfreie Erzählung, sondern bleibt stets dem erbaulichen Ziel untergeordnet […]. Es ist vor allem eine argumentative Methode, ein Persuasionsverfahren, das einen Beleg für ein Argument (oder eine „Wahrheit“) beibringt.12
Der Typus der exemplarischen Erzählung etabliert sich auch außerhalb der homiletischen Verwendung oder anderen rahmenden paränetischen Diskursen als Erzählform,13 deren konstituierendes Merkmal eine dezidiert lehrhafte Erzählabsicht ist; das Erzählen im Exemplum ist Anlass für eine daraus folgende moralische Belehrung.14 Das 13. Jahrhundert als Entstehungszeitraum des versnovellistischen Erzählens markiert zugleich die beginnende Hochphase der Exempeldichtung, ein großer Teil der bekannten Exempelsammlungen ist im 13. und 14. Jahrhundert entstanden: „Das dreizehnte Jahrhundert ist das goldene Zeitalter der illustrativen moralischen Erzählung, des Exemplums.“15
Der moralisierende und belehrende Impetus, der der versnovellistischen Dichtung oft inhärent ist und verschiedentlich als eine wichtige Funktion der Texte profiliert wurde, wird als Bestandteil dieses Traditionszusammenhangs verstehbar. Die Versnovellen lassen in Themen, Motiven und ihrer narrativen Struktur einen deutlichen Bezug zur Exempel-Tradition erkennen, gleichzeitig kennzeichnet sie aber auch eine Transgression der damit verbundenen inhaltlichen Konventionen, indem sie sich von den Paradigmen einer strikten Lehrhaftigkeit abkehren.
Willer/Ruchatz/Pethes unterscheiden verschiedene Funktionsweisen des exemplarischen Erzählens. So kann ein Exempel oder Beispiel eine Belegfunktion haben, indem etwas Allgemeines, etwa eine gültige Regel oder Lebensweisheit, belegt und konkretisiert wird. Solche Beispiele haben vor allem eine deskriptive, veranschaulichende Funktion. Das Beispiel kann aber auch eine dezidiert normative Funktion haben, die auf ethische und andere Normen rekurriert und damit letztlich auf eine Modifikation des Handelns abzielt.16 Faktisch sind diese beiden Prinzipien in exemplarischen Erzählformen oftmals miteinander verknüpft, aber die Frage nach der tatsächlichen normativen Reichweite, nach einer plausiblen normativen Intention ist von großer Relevanz für die Profilierung der versnovellistischen Texte. Während das Erzählte in den lateinischen und volkssprachigen Exempla zumeist als Beleg für gültige ethische und moraltheologische Normativitäten erscheint, werden versnovellistische Texte zumeist in ambiger Perspektivierung der verhandelten Themen gestaltet, so dass sie gar keine plausible normative Gültigkeit vermitteln.17
Neben der Rekurrenz auf die lateinische und volkssprachige Lehrdichtung kennzeichnet die versnovellistischen Texte auch eine intensive Bezugnahme auf andere literarische Bereiche. Prägend ist die Tradition der höfischen Literatur,18 die auch in den schwankhaften Texten, die den größten Anteil am versnovellistischen Textkorpus haben, eine wesentliche Rolle spielt. Die Normativität des Höfischen wird als Referenzsystem für das schwankhafte Erzählen genutzt, indem Stoff- und Strukturschemata der höfischen Erzähltradition durch schwankhaftes Personal imitiert und mit typischen Schwankmotiven kombiniert werden. Die Thematisierung von Amoral, Obszönität und Hässlichkeit ist der Idealität des höfischen Romans diametral entgegen gesetzt, aus dieser Provokation der Normativität des Höfischen resultiert wesentlich die Komik und das subversive Potential vieler Schwankerzählungen.19
So zum Beispiel in der ob der Verfasserschaft Konrads von Würzburg umstrittenen Versnovelle ‚Die halbe BirneKonrad von Würzburg›Die halbe Birne‹ [?]‘,20 die parodierend den verabsolutierten Normanspruch des Höfischen verhandelt. Dabei werden typische Erzählschemata wie die Brautwerbung sowie Strukturprinzipien des Artusromans von Aufstieg, Krise und Reintegration des Helden mit Schwankmotiven verknüpft. Der Ritter Arnolt wirbt um die Tochter eines Königs, die in topischer Referenz auf höfische Darstellungsmodi als vollkommene und rühmenswerte Frau eingeführt wird, welche nur der gewinnen kann, der als Bester aus einem Turnierwettstreit hervorgeht. Arnolt bewährt sich zwar im Kampf, beim abendlichen Festmahl jedoch halbiert er unter Missachtung der Speiseetikette die als Nachspeise gereichte Birne nâch gebiureschlîcher art (V. 86) und verschlingt seine Hälfte, ohne sie zu schälen und weiter zu zerteilen. Am folgenden Turniertag stellt ihn die Prinzessin öffentlich wegen seiner fehlenden hovezühte bloß, so dass sich Arnolt gedemütigt aus der höfischen Gesellschaft zurückziehen muss.
Seine Restitution erlangt er durch eine listreiche Episode, mit der die Erzählung die Register des Schwankhaften intensiv ausspielt: Verkleidet als Tor und angeblich stumm, begibt er sich wieder ins Schloss, wo er nicht nur zur Belustigung und Unterhaltung der Hofgesellschaft beiträgt, sondern durch sein entblößtes Geschlechtsteil auch die Begehrlichkeit der Prinzessin weckt. Sie lässt ihn heimlich in ihre Gemächer führen; als der vermeintliche Tor sich dort in Liebesdingen desinteressiert und unbeholfen gibt, treibt ihn die Zofe unter Zurufen der Prinzessin mit Hilfe einer Gerte an, bis er endlich den erwünschten Beischlaf vollzieht. Am Folgetag tritt Arnolt wieder zum Turnierkampf an und wiederholt dort öffentlich die nächtlichen Zurufe der Prinzessin. Um ihrer eigenen öffentlichen Entehrung zu entgehen, willigt sie in die Ehe mit Arnold ein und unterstellt ihm Herrschaft und Besitz.
Durch die Wiederholungsstruktur und das Schema Ehrverlust und Restitution werden zwar typische Elemente des Artusromans zitiert, aber mit verschiedenen signifikanten Abweichungen gestaltet. Statt einen mühsamen aventiure-Weg zu durchlaufen und die verlorene êre durch ritterliche Bewährung wiederzugewinnen, legt Arnolt in der Rolle des Narren die destruktiven Kräfte des Hofes frei.21 ‚Die halbe Birne‘ spielt prononciert die Opposition heraus zwischen dem Hof als öffentlichem Raum, der Zentrum aller Wertorientierung ist und êre als leitende Handlungsmaxime vorstellt, und der nicht-öffentlichen Sphäre, in der diese Normativität als eine nur vordergründige entlarvt wird. Die Rolle des Toren – durchaus angemessener Ausdruck für den Ausschluss aus der Gesellschaft – ist von Arnolt freiwillig gewählt. Als stummer, gewalttätiger und schmutziger Narr repräsentiert er alles, was die courtoise Fassade des Königshofes auszugrenzen vorgibt und erlangt gerade in dieser Rolle Genugtuung. Indem die Prinzessin konterkarierend zu ihrer äußerlichen Rolle als Vertreterin des Hofes nach dem Schwankschema des übelen wîp gestaltet und in ihrer ethischen Fragwürdigkeit und Triebhaftigkeit überdeutlich herausgestellt wird, erscheint die Degradierung des Ritters und damit der normative Anspruch des Hofes in einem anderen Licht. Arnolt und sein Ratgeber wissen offenbar um die Diskrepanz zwischen dem zur Schau gestellten Normanspruch und der tatsächlichen Verfasstheit seiner Vertreterin und nutzen diese für die Replik.22 Mit der Rache als wesentlichem Handlungsmovens und der Bloßstellung der künftigen Ehefrau bricht ‚Die halbe Birne‘ mit einem weiteren wichtigen Prinzip des arthurischen Schemas, indem keine Harmonie der Eheleute erreicht wird; Arnolt bleibt seiner Frau gegenüber arcwaenic (V. 480). Das zentrale Motiv der Birne, die als Symbol für Sexualität nicht nur Arnolds Verfehlung provoziert, sondern auch auf die verdeckte Kreatürlichkeit der Prinzessin verweist, wird in der Erzählung so zum Sinnbild der Brüchigkeit einer höfischen Selbstinszenierung.23
Die Versnovellen arbeiten mit einem festen narrativen Inventar von typisierten Figurengestaltungen, etwa der bösen Frau oder dem buhlerischen Pfaffen, sowie mit stereotypen Lasterbeschreibungen und Handlungen und verweisen damit auf etablierte literarische Muster und Diskursstrukturen.24 Die sprachlich und im Handlungsverlauf meist einfach gehaltenen Texte bedienen sich einer komplexen „technisch-rhetorische[n] Kombinatorik, die typisierte Rollen- und Handlungsmuster, Situationstypen und kulturelle Kontexte kombiniert und spielerisch variiert“.25 Verschiedene Handlungs- und Ordnungsmuster werden miteinander verwoben und gleiche Strukturen durch unterschiedliche Rollen besetzt.26 So bedingt die Gestaltung von Ehebruchhandlungen entweder mit dem Studenten, dem Ritter oder dem Pfaffen, deren Figurationen jeweils stereotyp gekennzeichnet sind und feste Implikationen transportieren, auch divergente topische Sinnsetzungen innerhalb des gleichen Erzählschemas.
Die Versnovellen wiederholen damit tradierte Erzählmotive und Schemata, aber diese werden immer wieder neu arrangiert und in andere argumentative Register überführt und dadurch in „überraschenden Sinnverlagerungen und Bedeutungsvalenzen“ gestaltet.27 Indem die Versnovellen „traditionelle Bausteine literarischer Sinnstiftung“ widersprüchlich arrangieren, widersprechen die Texte häufig konventionellen Erwartungen, auch können die eingespielten Normativitäten dabei miteinander konfligieren.28 Traditionelle Erzählmotive und Schemata werden damit nicht (nur) aufgerufen, um etablierte Deutungen zu reproduzieren, vielmehr werden sie häufig in komplexe Formen überführt, die neue, offenere Sinnpotentiale entwerfen. Versnovellistische Texte schließen damit zwar an zeitgenössische Diskurse an, aber sie verhandeln nicht einfach deren Geltung, sondern die Variabilität ihrer Lesbarkeit sowie die vielfältigen Möglichkeiten ihrer literarischen Gestaltung.29 Mit der Adaption und Transgression tradierter Erzählkonzepte prägen die Versnovellen spezifische Strategien der Ambiguisierung aus, sie markieren einen Texttyp, der auch auf „die bewusst intendierten und/oder inszenierten Akte von Zweideutigkeit, Gegensatz und (scheinbarem) Widerspruch in ihren jeweiligen kulturellen und literarischen Kontexten“ zu untersuchen ist.30 Dabei ist die Ambiguität der Versnovellen verschieden von ambigen Sinnstrukturen, wie sie sich im großepischen Erzählen zeigen. Während etwa der höfische Roman Ambiguität erzeugt, indem er eine komplexe Welt narrativiert und vielschichtige Sinnbezüge gestaltet, bedingt die Kürze der kleinepischen Erzählungen andere Verfahren der Erzeugung von ambigen Sinnstrukturen, die hier vor allem durch die relativierende Kombination von verschiedenen literarischen Mustern und Geltungskonzepten entstehen.
Die Versnovellen stehen beispielhaft für ein Verfahren imitierender Bezugnahme auf Vorgängiges als wesentlichem Konstituens mittelalterlichen Erzählens. Dieses ist nicht nur in der Adaption konkreter Dichtungen und Autoren wirksam, sondern prägt auch den Umgang mit Erzähl- und Gattungstraditionen. Die Narrativierung von bekannten Schemata und Mustern prägt die Sinnsetzungen eines Textes in zweifacher Hinsicht: Zum einen ist das Wiedererkennen des Schemas wichtiges Moment für das Verstehen, zum anderen bedingt die Kenntnis des zugrunde liegenden Musters aber auch das Erkennen der Differenz, der Abweichung vom Schema. Der Traditionsbezug ermöglicht ein imitierendes Unterlaufen der mit bestimmten Erzählformen verbundenen inhaltlichen Erwartungen. Die Adaption von Stoffen, Motiven und narrativen Verfahren kann in einer gezielten Konterkarierung und Transformation der üblichen Sinnsetzungen gestaltet werden, die literarische Texte als Kontrastimitationen ihrer Prototypen in Erscheinung treten lässt.31 Dennoch ist der Traditionsbezug der Versnovellen kein rein negierender, denn die Synthese konfligierender Muster aus unterschiedlichen Diskursbereichen stellt auch ein innovatives Moment der Bedeutungsproduktion dar, indem neue Bezugnahmen auf die eingespielten Geltungskonzepte formuliert werden. Der Traditionsbezug oder die schematische Konzeption, die ein prägendes Merkmal mittelalterlicher Textualität darstellt,32 wird in den versnovellistischen Texten in besonderem Maße zur Basis ihrer Innovation, indem diese aus den adaptierten Erzählmodellen und narrativen Mustern eigene Paradigmen der Bedeutungsproduktion generieren. Die versnovellistischen Texte sind zentriert auf eine Poetik der Transgression, indem sie nicht nur einzelne Motive und Erzählmuster in neue Zusammenhänge stellen, sondern auch das Prinzip exemplarischen Erzählens aus einer primär pragmatischen, Belehrung intendierenden Funktionalisierung in eine genuin poetische Literarizität zu überführen vermögen.