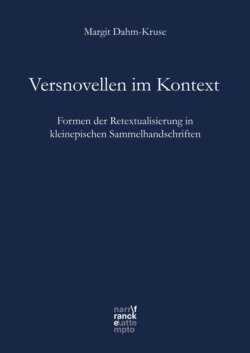Читать книгу Versnovellen im Kontext - Margit Dahm-Kruse - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5.2 Das ‚Herzmaere‘ als repräsentative Vergleichskonstellation
ОглавлениеDie Bestimmung des ‚HerzmaereKonrad von Würzburg›Das Herzmaere‹‘ zum zentralen Referenztext der Untersuchung resultiert nicht aus einer besonderen normativen Perspektive auf den Text, sondern aus einer methodisch notwendigen Fokussierung auf die Untersuchung eines Modellfalls. Verschiedene inhaltliche und überlieferungsspezifische Merkmale machen das ‚Herzmaere‘ dabei zu einem geeigneten Gegenstand für eine vergleichende Analyse der Text-Kontext-Relationen. Im ‚Herzmaere‘ werden grundlegende Prinzipien des versnovellistischen Erzählens realisiert wie die komplexe Kombinatorik verschiedener tradierter Motive und literarischer Schemata oder die spannungsvolle Verschränkung geistlicher und weltlicher Diskurse. Weiterhin ermöglicht die im Pro- und Epilog formulierte Vorbildfunktion der erzählten Geschichte eine gezielte Auseinandersetzung mit exemplarisch-normativen Sinnsetzungen, auf denen ein besonderer Fokus der Untersuchung liegt.
Daneben stellen die erheblichen Divergenzen im Textbestand der verschiedenen Redaktionen des ‚Herzmaere‘ eine besondere Möglichkeit für die Frage nach intentionalen Textgestaltungen dar.1 Gerade Pro- und Epilog, die als kommentierende Rahmung der erzählten Geschichte wesentlich die Sinnsetzungen des Textes bestimmen, sind im ‚Herzmaere‘ variant gestaltet, was den Text zu einem vielversprechenden Gegenstand für die Frage nach gezielten Anpassungen durch die reproduzierenden Instanzen macht.2 Weiterhin legen die Verfasserschaft Konrads sowie die akzentuierte Gottfried-Referenz eine besondere ‚Prominenz‘ und Wirksamkeit des ‚Herzmaere‘ nahe, die eine intensive Auseinandersetzung mit dem Text in der koproduzierenden Rezeption durch die Schreiber geprägt haben können.
Vor allem aber ist das ‚Herzmaere‘ auf Grund seiner Überlieferungsbreite ein geeignetes Beispiel, um das Verhältnis von Einzeltext und Sammelhandschrift exemplarisch auszuleuchten. Die Dichtung gehört zu den bekanntesten und auch zu den am breitesten überlieferten mittelalterlichen Versnovellen. Insgesamt 10 vollständige Handschriften und zwei Fragmente, die vom frühen 14. bis in das 16. Jahrhundert datieren und unterschiedlichsten lokalen und sozialen Entstehungsräumen zuzuordnen sind, tradieren Redaktionen des ‚Herzmaere‘, die erheblich in ihrem Umfang divergieren (480/602 Verse). Das ‚Herzmaere‘ wird in ganz unterschiedliche Typen von Sammelhandschriften eingebunden, die tradierenden Kompilationen divergieren in der Auswahl und Zusammenstellung von Texten, den thematischen und texttypologischen Schwerpunkten sowie in der kodikologischen Gestaltung. Der Vergleich der das ‚Herzmaere‘ tradierenden Codices führt damit exemplarisch die unterschiedlichen Typen oder das Spektrum der versnovellistischen Sammelhandschriften vor. Das Untersuchungskorpus, das mit dem Cpg 341Heidelberg, Universitätsbibliothek›Cpg 341‹ [H] sowie den Codices Wien 2885Wien, Österreichische Nationalbibliothek›Cod. 2885‹ [w] und Don. 104Karlsruhe, Badische Landesbibliothek›Cod. Donaueschingen 104‹ [l] (‚Liedersaalhandschrift‘) einige der Haupthandschriften der kleinen Reimpaardichtung enthält, stellt einen repräsentativen Ausschnitt aus dem kleinepischen Sammelschrifttum dar und spiegelt auch die Genese des untersuchten Sammlungstypus wider.
Die untersuchten Handschriften sind auch repräsentativ für grundlegende Parameter der spätmittelalterlichen Manuskriptkultur und Literaturproduktion. Es sind drei Pergamenthandschriften aus dem späten 13. Jahrhundert sowie der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts vertreten; bei den übrigen Überlieferungsträgern handelt es sich dagegen um Papierhandschriften, die vom ausgehenden 14. bis in das frühe 16. Jahrhundert datieren. An dem untersuchten Korpus lässt sich exemplarisch die Entwicklung vom Luxusprodukt der Pergamenthandschrift zum breiter verfügbaren Papiercodex nachvollziehen, die mit Veränderungen in den Gestaltungsmodi mittelalterlicher Handschriften, aber auch in der literarischen Produktion einhergeht.3
Zwar gibt es kein festes Standardformat für volkssprachige Codices, sondern ein Nebeneinander verschiedener Formate und Handschriftentypen, aber es sind seit dem 13. Jahrhundert einige typische Parameter fassbar, die sich in großen Teilen des handschriftlichen Korpus widerspiegeln und die auch das kleinepische Sammelschrifttum prägen. Während im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert noch einfache Gebrauchshandschriften mit kleinem Format dominierten, können die 1220/30er Jahre als „buchtechnische Zäsur“ gefasst werden, die zeitversetzt auf den literarischen Modernisierungsschub folgt und die sich neben steigenden Produktionszahlen in einer Tendenz zu aufwendigeren Codices und größeren Formaten niederschlägt.4 Typisch ist eine Anordnung des Textes in zwei Kolumnen, im Schnitt stehen 40 Verse je Spalte. Die Verse werden zumeist abgesetzt, zum Teil sind die Anfangsbuchstaben ausgerückt. Etabliert sind Majuskeln und Initialen, die neben der ästhetischen auch eine textgliedernde Funktion haben. Titulaturen sind oft in rot gehalten, häufig ist die Verwendung alternierender roter und blauer Lombarden und Initialen, vor allem am Beginn der Texte. Auch die Ausstattung aufwendigerer Handschriften mit farbigen Majuskeln, Miniaturen und Fleuronnée-Elementen, ursprünglich Bestandteile der lateinischen Tradition, wird über den ‚Umweg‘ der französischen Profanbuchgestaltung auch im Bereich deutscher volkssprachiger Codices übernommen.5
Die Papierhandschriften des ausgehenden 14. und des beginnenden 15. Jahrhunderts orientieren sich zunächst an den etablierten Gestaltungsmodi der Pergamenthandschriften, sind aber tendenziell weniger aufwendig gestaltet. Der Anteil mit geringerem Aufwand gefertigter Gebrauchshandschriften nimmt dabei kontinuierlich zu.6 Insbesondere die Schriftart verändert sich, beeinflusst durch die schneller schreibbaren Kanzleischriften, von der Buchschrift hin zu kursiven Schriftformen. Weiterhin nimmt der Umfang sowie die durchschnittliche Lagenstärke der Codices tendenziell zu; während die Pergamenthandschriften des 13. und 14. Jahrhunderts meist in Quaternionen angelegt waren, dominieren bei den Papiercodices Sexternionen.7 Gleichzeitig werden vermehrt Gliederungsprinzipien wie Register, Titulaturen und eine klare Abgrenzung von Abschnitten und Einzeltexten eingesetzt.8
Die Veränderungen in der Gestaltung sind nicht nur durch den Übergang vom Pergament zum Papier an sich,9 sondern vor allem durch die Entwicklung zu einer handschriftlichen ‚Massenproduktion‘ geprägt, die ihrerseits nicht ausschließlich auf dem billigeren Schreibstoff basiert.10 Die Genese der Manuskriptproduktion ist durch veränderte institutionelle Bedingungen der literarischen Produktion bedingt. Der Übergang vom Pergament zum Papier, vom raren Luxusprodukt zum breiter verfügbaren Gebrauchsgegenstand, verläuft analog mit soziokulturellen Veränderungen des Literatursystems, zu denen insbesondere die Entstehung der städtischen Literaturzentren gehört, die einen wichtigen Parameter für den Anstieg der Manuskriptproduktion darstellen. Zu überlegen ist, ob die veränderten Paradigmen der Manuskriptproduktion nicht nur die äußere Gestaltung der Manuskripte beeinflusst haben, sondern ob die Entwicklung der Handschrift zum breiter verfügbaren Gebrauchsgegenstand auch ein verändertes literarisches (Selbst)Verständnis der Schreiber und einen freieren Umgang mit Texten befördert hat. Zwar wird in den kleinepischen Sammelhandschriften auch im 15. Jahrhundert noch etabliertes und lang tradiertes Material aufgeführt,11 aber es ist vorstellbar, dass die späteren Sammlungen hinsichtlich der Bearbeitung tradierten Materials und der Zusammenführung von Texten durch ein größeres Maß an Selbstermächtigung seitens der Schreiber geprägt sind.
Die untersuchten kleinepischen Sammelhandschriften bilden die Veränderungen bei den Gestaltungsmodi und Produktionsbedingungen der mittelalterlichen Manuskriptkultur ab: Die Pergamentcodices des 13. und frühen 14. Jahrhunderts (Archiv Schloss Schönstein Nr. 7693Schönstein (Wissen), Archiv Schloss Schönstein (Fürsten und Grafen von Hatzfeldt-Wildenburg)›Akte Nr. 7693‹ [Ko]; Cpg 341Heidelberg, Universitätsbibliothek›Cpg 341‹ [H]) sind noch prototypisch durch die beschriebenen Gestaltungsparameter der hochmittelalterlichen Handschriften gekennzeichnet. Sie unterscheiden sich signifikant von den Codices des späten 15. Jahrhunderts, dem Cgm 714München, Bayerische Staatsbibliothek›Cgm 714‹ [m] und dem Codex Prag X A 12Prag, Nationalmuseum›Cod. X A 12‹ [p1] (‚Liederbuch der Clara Hätzlerin‘) mit seiner Parallelüberlieferung. Als einspaltig beschriebene, mit wenig Aufwand gefertigte kleinformatige Gebrauchshandschriften, die offensichtlich in einem genuin städtischen Literatur- und Produktionskontext entstanden sind, spiegeln sie die veränderten Modalitäten in der Spätphase der Handschriftenkultur wider. Dagegen markieren die Papierhandschriften des 14. und beginnenden 15. Jahrhunderts (Wien 2885Wien, Österreichische Nationalbibliothek›Cod. 2885‹ [w]; Innsbruck FB 32001Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum›FB 32001‹ [i]; Don. 104Karlsruhe, Badische Landesbibliothek›Cod. Donaueschingen 104‹ [l] (‚Liedersaalhandschrift‘)), gleichfalls typisch für die mittelalterliche Literaturentwicklung, einen Übergangsstatus, indem sie noch Gestaltungsparameter der Pergamenthandschriften wie die zweispaltige Texteinrichtung aufweisen, aber bereits weniger aufwendig gestaltet sind.
Mit dieser breiten und repräsentativen Überlieferung ist das ‚Herzmaere‘ ein geeigneter Modellfall für die Untersuchung von Text-Kontext-Relationen. Breiter überliefert ist mit 21 Textzeugen lediglich Schondochs ‚Die Königin von FrankreichSchondoch›Die Königin von Frankreich‹‘, wobei dieser Text aber nur einmal im Rahmen einer kleinepischen Sammlung tradiert ist; für eine Untersuchung, die auch den Überlieferungstyp der kleinepischen Kompilation in den Fokus stellt, bietet sich ‚Die Königin von Frankreich‘ als Referenztext nicht an. Geeignet als Vergleichskonstellation ist neben dem ‚Herzmaere‘ auch ‚Der Sperber›Der Sperber‹‘, der als schwankhafter Vertreter der Textsorte hinsichtlich der Wirkung und Funktionalisierung von schwankhaften Sinnsetzungen im Sammlungskontext befragt werden kann. Mit 11 Handschriften ist die anonym überlieferte Versnovelle aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts genauso umfangreich tradiert wie das ‚Herzmaere‘, wobei die textuellen Divergenzen zwischen den verschiedenen Redaktionen aber weit weniger ausgeprägt sind als beim ‚Herzmaere‘.
Die vergleichende Text-Kontext-Analyse des ‚Herzmaere‘ bleibt damit einerseits auf den konkreten Einzelfall bezogen, indem die Divergenzen im Textbestand und die Anpassungen an den Überlieferungskontext letztlich immer auf die spezifische Poetik dieses einzelnen Textes rekurrieren und in ihren semantischen Implikationen nicht generalisierend auf das Gesamtkorpus der versnovellistischen Dichtungen übertragen werden können. Andererseits ermöglicht die Betrachtung eines Modellfalls, der als Überlieferungskonstellation sehr wohl repräsentativ ist, nicht nur grundsätzliche Einsichten in die Konzeption kleinepischer Sammlungen, sondern auch eine Abstraktion der Befunde auf generelle Lizenzen der Textveränderung und die Formen der Einpassung von Texten in divergente Kontexte.
Die Untersuchung bleibt dabei nicht auf die singuläre Betrachtung des zentralen Referenztextes beschränkt, sondern wird perspektivisch geöffnet, indem neben der Vergleichsanalyse des ‚Herzmaere‘ immer wieder auch andere Texte der jeweils untersuchten Sammlungen in den Blick genommen werden, die mit ihrer jeweiligen Parallelüberlieferung abgeglichen und auf vergleichbare Phänomene der Anpassung an den Sammlungskontext überprüft werden.