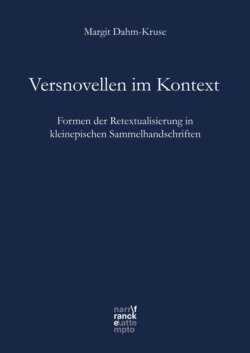Читать книгу Versnovellen im Kontext - Margit Dahm-Kruse - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Mittelhochdeutsche Versnovellen 2.1 Forschung und Gattungsdiskussion
ОглавлениеDer Beginn der neuzeitlichen Rezeption mittelhochdeutscher Kleinepik ist, wie bei einem großen Teil der mittelalterlichen Textualität, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bei den ‚Gründervätern‘ der Germanistik zu verorten und mit Namen wie Friedrich Adelung, Johann Jacob Bodmer und Friedrich Schlegel verbunden,1 die die Anfänge einer germanistischen Literaturwissenschaft markieren, die noch ganz im Kontext einer romantisierenden Adaption ‚volkspoetischer‘ Dichtung stand und in der die Texte primär im Zuge der Rekonstruierung ihres vermeintlichen Quellenwertes für die soziale und kulturelle Verfasstheit der mittelalterlichen Lebenswelt gelesen wurden.2
Sukzessive wurden zentrale kleinepische Sammelhandschriften wie der Cpg 341Heidelberg, Universitätsbibliothek›Cpg 341‹ [H], die Straßburger Handschrift A 94Straßburg, ehem. Stadtbibliothek›Cod. A 94‹ [S] oder der Wiener Codex 2885Wien, Österreichische Nationalbibliothek›Cod. 2885‹ [w] für die germanistische Erforschung entdeckt, abgeschrieben und diskutiert; es erschienen erste editorische Bearbeitungen einzelner Texte und ganzer Sammlungen wie der ‚Liedersaalhandschrift‘ Cod. Donaueschingen 104Karlsruhe, Badische Landesbibliothek›Cod. Donaueschingen 104‹ [l] (‚Liedersaalhandschrift‘).3 Den ersten Versuch einer umfassenden Kompilation der versnovellistischen Dichtung markiert das 1850 erschienene ‚Gesammtabenteuer‘ Friedrich Heinrich von der Hagens,4 das weniger eine auf Vollständigkeit abzielende Dokumentation des gattungsmäßig noch gar nicht definierten Korpus, als vielmehr eine Sammlung volkstümlichen Textgutes darstellt.5 Im 20. Jahrhundert entstanden Primär- und Neueditionen von Versnovellen und anderen kleinepischen Dichtungen, die häufig nach den Prinzipien Lachmannscher Textkritik erarbeitet wurden; viele von ihnen stellen nach wie vor die Basis der Texterschließung und -erforschung dar.6 Insbesondere die Dichtung des StrickersStricker wurde vergleichsweise umfangreich aufgearbeitet,7 weiterhin wurden zahlreiche Texte des 15. Jahrhunderts veröffentlicht, zum Teil ebenfalls in autorzentrierten Editionen.8 Große Teile des versnovellistischen Korpus aus dem 13. und 14. Jahrhundert sind dagegen nicht oder unzureichend erschlossen. Heinrich Niewöhners Vorhaben des ‚Neuen Gesamtabenteuers‘ als einer systematischen und kritischen Edition des versnovellistischen Textkorpus wurde nur in Teilen realisiert; von den 113 vorgesehenen Texten ist lediglich ein erster Band mit 37 Dichtungen erschienen.9
Der als Desiderat empfundenen grundlegenden Diskussion der Versnovellen als einer von den übrigen kleinepischen Erzählformen geschiedenen Textsorte widmete sich erstmalig die Arbeit Hanns Fischers, der eine systematische Untersuchung der konstituierenden Merkmale der von ihm als ‚Mären‘ bezeichneten Texte vornahm, die in eine viel diskutierte Definition und eine ebenfalls nicht unwidersprochene, aber dennoch weitgehend etablierte Festschreibung des Textkorpus mündete.10 Fischer nimmt dabei eine Unterscheidung in drei erzählerische Grundkategorien (schwankhaft, moralisch-exemplarisch und höfisch-galant) und eine formale Abgrenzung von anderen kleinepischen Textsorten sowie dem Roman vor.
Mit der Festschreibung auf „diesseitig-profane und unter weltlichen Aspekt betrachtete Vorgänge“ beförderte die Märendefinition Fischers eine Grenzziehung zwischen weltlicher und geistlicher Kleinepik,11 die nicht nur zu einer weitgehenden Ausklammerung von Texten mit überweltlichem Personal aus dem Märenkorpus und aus der Forschungsdiskussion führte, sondern auch eine Gattungsdebatte prägte, die die geistliche Perspektive der versnovellistischen Dichtung wenig in den Blick nahm.12 Tatsächlich wird in zahlreichen Versnovellen auf geistliche Sinngehalte referiert, auch legt bereits der enge Traditionszusammenhang mit der Exempeldichtung und die Bezugnahme auf soziale Ordo-Konzepte eine Verhandlung zentraler christlicher Denkfiguren nahe.13
Nach der Untersuchung durch Fischer stand neben der Diskussion des Märenbegriffs vor allem die Gattungsfrage im Fokus der germanistischen Forschung. Die Versnovellen sind überwiegend in Sammelhandschriften überliefert, in denen die Texte vor allem mit anderen kleinepischen Textsorten tradiert werden, wobei in der Regel keine durchgängige generisch determinierte Anordnung der Texte feststellbar ist.14 Dass die Versnovellistik „bei aller Unschärfe der Grenzen als etwas irgendwie Eigenständiges empfunden wurde, ist nicht auszuschließen, wenn auch unbeweisbar.“15 Die Frage ist daher, wieweit von einer auch im zeitgenössischen Bewusstsein verankerten gattungstypischen Verschiedenheit der Versnovellen von anderen kleinepischen Textsorten auszugehen ist und worin die distinkten Merkmale der Unterscheidung bestehen. Insbesondere der Typus des endgereimten Bîspel, das in Aufbau sowie der thematischen Fokussierung von Sozial- und Geschlechterverhältnissen der Versnovelle ähnelt, ist nicht immer klar von den Versnovellen abzugrenzen, zumal beide Textsorten in ihren Anfängen wesentlich durch die Dichtung des StrickersStricker geprägt sind.16
Die Debatte spiegelt grundsätzliche Zweifel gegenüber klassifikatorischen Gattungszuweisungen in der volkssprachigen Dichtungspraxis wider,17 wobei der häufig konstatierten gattungsmäßigen Indifferenz im Allgemeinen und in der kleinepischen Dichtung im Besonderen entgegenzuhalten ist, dass die Absenz einer normativen Poetik und ausformulierten Systematik nicht zwingend das Fehlen jedweder gattungsmäßigen Ordnung bedeutet.18 In den kleinepischen Sammlungen finden sich häufig unterschiedlich umfangreiche homogene Textreihen von Bîspeln, Versnovellen oder Minnereden, die als Indiz für das Bewusstsein einer generischen Verschiedenheit der kleinepischen Textsorten gelesen werden können:
Auch die Literatur des Mittelalters ist keine willkürliche Summe, sondern eine latente Ordnung oder Folge von Ordnungen literarischer Gattungen. Auf diese Ordnung weisen immerhin einige Zeugnisse mittelalterlicher Autoren und die in dieser Hinsicht noch nicht ausgewertete Auswahl und Anordnung von Texten und Gattungen in Sammelhandschriften.19
Die Versnovellen gelten aber auch aufgrund ihrer Heterogenität – schon der lange Überlieferungszeitraum über drei Jahrhunderte bedingt eine große Diversität der Texte – als eine Textsorte, die die Bestimmung einheitlicher Merkmale und einer gattungsmäßigen Zusammengehörigkeit erschwert.20
Ziegeler sucht in seiner Untersuchung ebenfalls eine synchrone Beschreibung der Gattung vorzunehmen, die den vor allem auf Ausschlusskriterien und weniger auf typisierbaren Gestaltungstechniken basierenden Ansatz Fischers ergänzen soll, indem sie eine Kombination von Merkmalen versnovellistischen Erzählens herausstellt, die einen Sammelbegriff rechtfertigen. Ziegeler sieht in den Versnovellen eine spezifische Form „erzählerischer Organisation“ realisiert,21 die narratologisch zwischen dem Roman und dem Bîspel angesiedelt ist und der als konstituierendes Merkmal ein Erzählen zwischen den Oppositionspaaren Fall versus Geschichte und Identifikation versus Distanz eigen ist:
In dem Bemühen, auf dem schmalen Grat zwischen bîspelhaftem, auf einen ‚Beweis‘ zielenden erzählerischen Verfahren und dem romanhaften, auf Identifikation mit dem Protagonisten gerichteten Erzählen die Balance zu wahren, sehe ich das für die Mären konstitutive Problem schlechthin.22
Heinzle argumentiert dagegen vor allem gegen die durch Fischer gesetzte formale Klassifizierung sowie die angenommene gattungsmäßige Einheitlichkeit der Versnovellen an sich: Angesichts der Heterogenität des Korpus fehlten gemeinsame Merkmale oder Merkmalsstrukturen, die prägnant genug seien, um das Textkorpus als Gattung zu erfassen.23 Der Ansatz Ziegelers stellt nach Heinzle primär eine Untersuchungsmethode und weniger eine konsistente Definition dar und trägt nicht zu einer Erfassbarkeit der Gattung bei.24 Heinzle plädiert für einen diachronen Ansatz, der die Märendichtung, ähnlich dem bei Grubmüller beschriebenen Prinzip der Textreihe,25 im Kontext von Traditionsstiftung, -erfüllung und -veränderung beschreibt.26 Die Texte bilden dabei keinen festen Kanon, sondern werden über typische Motive und Handlungsschemata klassifiziert.
Müller greift die Kritik Heinzles auf und ergänzt, dass nicht nur die Handlungsschemata an sich, sondern auch deren Funktionszusammenhänge entscheidend für eine gattungsmäßige Typisierung sind. Die gleichen Schemata können in divergente Erzählstrukturen und Deutungsmuster eingebunden werden, wodurch sich die Struktur und Funktion der Texte maßgeblich verändert.27
Haug geht über die Feststellung eines fehlenden Systemzusammenhangs des Textkorpus hinaus, indem er den Versnovellen per se einen gattungsmäßigen Status abspricht, der diese von dem übrigen Korpus mittelalterlicher Kurzerzählungen unterscheidet:
Ich nehme vielmehr jenes Negativergebnis der langen Debatte, das heute festzustehen scheint, zum Ausgangspunkt für einen neuen Zugang, nämlich, dass es eine Gattung ‚Märe‘ nicht gibt, oder allgemeiner formuliert, dass kein literarisches Regelsystem auszumachen ist, das der mittelalterlichen Kurzerzählung über die Vielfalt ihrer Erscheinungen hinweg eine gattungsmäßige Identität zu sichern vermöchte.28
Als Erzählen im ‚gattungsfreien Raum‘ stehen die Versnovellen demnach in Opposition zu anderen literarischen Formen. Nach Haug, der sowohl narratologische als auch hermeneutische Überlegungen einbezieht, entziehen sich die mittelalterlichen Kurzerzählungen nicht nur einer fassbaren Form, sondern auch einer konzisen Sinnbildung: Indem sie sich vor allem mit dem Aufzeigen von Unordnung und Kontingenz auseinandersetzen und die Erwartung auf ein sinnstiftendes Ende häufig nicht erfüllen, manifestiere sich in den Texten eine besondere „Freiheit zum Negativen“; die ausgestellte Sinnlosigkeit wird von Haug als narrativer Zweck der Texte bestimmt.29
Grubmüller dagegen geht von einer gattungsmäßigen Fassbarkeit der Versnovellen aus. Mit dem Konzept der ‚literarischen Reihe‘ entwirft er ein flexibles Ordnungsmuster, das Gattungen nicht als normatives Regelwerk, sondern als ein variables System fortschreitender Bezugnahmen auf etablierte Muster und Autoritäten fasst.30 Die mittelalterliche Textualität in ihrem ausgeprägten Traditionsbezug kann über eine historische Gattungspoetik erfasst werden, in der eine gattungsmäßige Ordnung in Form literarischer Reihen in Erscheinung tritt, denen sowohl die adaptierende Bezugnahme auf die Tradition als auch das verändernde Fortschreiben derselben implizit ist. Mit diesem Verständnis von Gattung als Variation von Mustern wird der spezifischen Verfasstheit des durch seinen ausgeprägten Traditionsbezug geprägten mittelalterlichen Literaturbetriebs Rechnung getragen. Auch für die Versnovellen zeichnet Grubmüller eine historische Gattungsentwicklung nach, die im 13. Jahrhundert mit den als dezidiert exemplarisch kategorisierten Texten des StrickersStricker als Grundmuster einsetzt, das sich durch die Adaption schwankhafter Erzählmuster zu einer primär durch Komik gekennzeichneten Gattung entwickelt, deren Kontinuität und gattungsmäßiger Zusammenhang vor allem in einer Referenz auf tradierte Ordnungsmuster gesehen wird.31