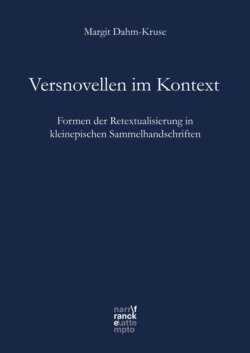Читать книгу Versnovellen im Kontext - Margit Dahm-Kruse - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2 Die variante Überlieferung mittelalterlicher Texte
ОглавлениеMit den Handschriften unmittelbar verbunden ist die textuelle Varianz als grundlegendem Paradigma mittelalterlicher Textualität. Die Hinwendung zum Original der Handschrift bedingt zwangsläufig eine Absage an die Vorstellung von einem fassbaren Originaltext.1 Die Manuskriptkultur kennt keine identischen Texte, jede mehrfach überlieferte Dichtung ist in Textzeugen präsent, die unterschiedlich stark variieren. Dabei ist die mittelalterliche volkssprachige Dichtung weit mehr von Varianz geprägt als die lateinische Schriftlichkeit, die an der Offenbarungswahrheit der Kirche oder der Autorität antiker Gelehrter orientiert und dadurch stärker an einen festen Wortbestand gebunden war.2 Entsprechend gibt es von fast allen volkssprachigen großepischen Dichtungen Parallel- und Kurzfassungen, die sich zum Teil signifikant voneinander unterscheiden,3 wobei eine klare Unterscheidung zwischen primären und sekundären Textfassungen längst nicht immer möglich ist,4 und auch bei den kleinepischen Texten gibt es zum Teil erhebliche Divergenzen zwischen den Textbeständen der einzelnen Überlieferungsträger. Das Nebeneinander verschiedener Ausformungen von Dichtungen ist damit konstitutiv für das Verständnis mittelalterlicher Textualität.
Der Oberbegriff Varianz wird für ein breites Spektrum textueller Phänomene verwendet und kann alle Unterschiede zwischen Texten bezeichnen, „die trotz Varianz gegeneinander so weitgehend übereinstimmen, daß sie unter ein gemeinsames Dach gehören“.5 Varianz reicht von der Ebene kleinteiliger Unterschiede in Morphologie, Lexik oder Syntax über sinngemäße Textreproduktionen, die die gleichen inhaltlichen Gesichtspunkte mit einem veränderten Wortlaut darstellen, bis hin zu selbstständigen Ausgestaltungen des Textes durch neue Erzählelemente.6
Bumke stellt eine am Beispiel der ‚Nibelungenklage›Nibelungenklage‹‘ ausgeführte Beschreibungssystematik für Varianz vor, in der die Textelemente nach Art und Ausmaß der Variation graduell geordnet und nach den grundlegenden Typen Textbestand, Textfolge und Textformulierung unterschieden werden. Dabei wird ein neutrales Beschreibungsvokabular verwendet, das die Begriffen wie ‚Kürzung‘ oder ‚Bearbeitung‘ inhärente Einteilung in primäre und sekundäre Textfassungen vermeidet.7 Bumke macht aufgrund der Unmöglichkeit einer klaren Trennung zwischen zufälligen und intendierten Varianten die Entstehung der Varianz ausdrücklich nicht zum Gegenstand der Beschreibung, ebenso wenig ist die Einbindung der Varianten in ihre textuellen, inhaltlichen oder funktionalen Kontexte Bestandteil des vor allem phänomenologisch orientierten Modells.8
Dagegen stellt sich bei einer nicht rein philologisch-deskriptiv orientierten Perspektivierung textueller Varianzphänomene, die deren Bedeutung und Funktion in die Betrachtung einschließt, die Frage, wann einzelnen Varianten sinnveränderndes Potential und damit eine semantische Relevanz für die Rezeption des Gesamttextes zuzusprechen ist. Damit verknüpft ist die Überlegung, wie sich eine intentionale (Um)Gestaltung des Textes von Varianten ohne besondere sinnverändernde Gestaltungsabsicht unterscheiden lässt, wie sie zum Beispiel aus der Anpassung an individuelle, regionale oder historische Schreibgewohnheiten resultieren kann.9 Dabei ist allen Überlegungen, die textuelle Varianz nach den Kriterien von Sinnveränderung, Gestaltungswille und Intentionalität zu unterscheiden suchen,10 die Problematik gemeinsam, dass diese Kategorien keinen „textanalytisch erweisbaren Sachverhalt“ darstellen und damit nicht konzise greif- und abgrenzbar sind.11
Die Frage nach dem sinnverändernden Potential textueller Varianz ist von zentraler Bedeutung, wenn es um die Unterscheidung von unterschiedlichen Fassungen geht. Als Fassung gilt eine bzw. eine Gruppe von Überlieferungen eines Textes, bei denen die Gesamtheit der Varianten ein signifikant bedeutungsveränderndes Potential aufweist, durch das sich diese maßgeblich von den anderen Redaktionen des gleichen Textes unterscheidet.12 Dabei wird zumeist auch eine Intentionalität bei der Gestaltung, ein eindeutig bestimmbarer „unterschiedlicher Formulierungs- und Gestaltungswille“ vorausgesetzt.13 Ab wann einer Variante oder dem Zusammenspiel verschiedener Varianten sinnveränderndes Potential zugesprochen wird, ab wann, vielleicht auch in einem aggregativen Prozess, die Quantität varianter Textgestaltungen auch in eine Qualität semantisch relevanter Textveränderung umschlägt, die den Status einer eigenen Fassung rechtfertigt, ist nicht verbindlich kategorisierbar. Damit ist die Fassung im Gegensatz zur Redaktion letztlich eine abstrakte Größe, der eine inhaltliche Unschärfe inhärent ist.
Auch wenn die aus den nicht kategorisierbaren Größen von semantischer Relevanz und Intentionalität resultierenden Aporien nicht vollständig aufgelöst werden können, ist die Frage nach der Unterteilung von divergenten Fassungen nicht obsolet. Es bedarf eines operationalisierbaren Begriffs, um anzuzeigen, ob sich verschiedene Redaktionen eines Textes unspezifisch im Wort- oder Versbestand unterscheiden, oder ob sich aus den textuellen Divergenzen deutungsrelevante Unterschiede ergeben. Der Fassungsbegriff ist ein heuristisches Mittel, um signifikante Änderungen in der Sinnkonstitution verschiedener Redaktionen zu markieren; statt von einer klaren dichotomischen Gegenüberstellung muss dabei aber von einem skalierbaren Feld mit einem Übergangsbereich ausgegangen werden.
Die Versnovellen stehen beispielhaft für einen divergenten klassifikatorischen und terminologischen Umgang mit der varianten Überlieferung. Bei zahlreichen Versnovellen schlägt sich das Nebeneinander signifikant divergierender Redaktionen in einer klaren Geschiedenheit unterschiedlicher Fassungen nieder, so werden zum Beispiel ‚Der Mönch als Liebesbote›Der Mönch als Liebesbote‹‘ oder ‚Der Schüler von Paris›Der Schüler von Paris‹‘ sowohl in der Forschungsdiskussion als auch in der editorischen Darstellung jeweils nach den Fassungen A, B und C unterschieden. Bei anderen Dichtungen wie zum Beispiel dem ‚HerzmaereKonrad von Würzburg›Das Herzmaere‹‘ und der ‚Frauentreue›Die Frauentreue‹‘ wurde dagegen trotz erheblicher und semantisch relevanter Unterschiede im Textbestand keine fassungsmäßige Unterscheidung definiert.