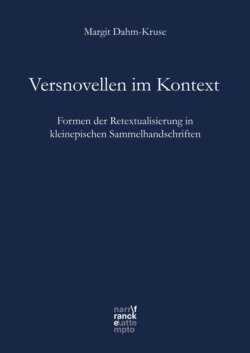Читать книгу Versnovellen im Kontext - Margit Dahm-Kruse - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.2 Exemplarizität und Variabilität von Geltung
ОглавлениеDen Versnovellen ist ein deutlich exemplarischer Impetus eigen, der sich wesentlich aus dem oben beschriebenen Traditionszusammenhang mit dem Typus des Exemplums als rhetorischem Überzeugungsmittel herleitet. Zumeist manifestiert sich der exemplarische Geltungsbezug versnovellistischer Erzählungen in der Rekurrenz auf soziale und religiöse Ordo-Muster. Inhaltlich kennzeichnend für die Versnovellen ist eine enge Verbindung mit sozialen Normierungsprozessen und konventionellen Ordnungsvorstellungen, indem intensiv Geschlechter- und Sozialbeziehungen behandelt werden.1 Dabei referieren die Versnovellen nicht auf realhistorische Sachverhalte wie tatsächliche soziale Strukturen und Konflikte, aber sie reflektieren Vorstellungen von sozialen Ordnungen.2
Am Beispiel der StrickerschenStricker Kurzerzählung führt Hagby aus, dass nicht nur Motive, sondern auch Aufbauprinzipien des mittellateinischen Exemplum übernommen werden, die in den unterschiedlich gestalteten Auslegungen fassbar sind, welche Sinn und Nutzen des Erzählten explizieren.3 In den Versnovellen wird die exempelhafte Textstruktur damit vor allem durch die häufigen Lehrreden in den Pro- und Epimythien geprägt.4
Indem die Versnovellen ein kompositorisches Grundelement der Rhetorik fortführen, am positiven oder noch häufiger negativen Beispiel zu demonstrieren, was richtig ist, erzeugen sie auch die Erwartung einer stimmigen Lehrhaftigkeit. Die Exemplarizität wird in der Forschung verschiedentlich als zentrale Funktion der Gattung Versnovelle wahrgenommen, der exemplarische Gestus der Texte wird sogar gleichgesetzt mit tatsächlicher Lehrhaftigkeit und der Gestaltung einer konkreten didaktischen Funktion mit normativer Verbindlichkeit, was sich etwa an der Rezeption des ‚Herzmaere‘ beispielhaft nachvollziehen lässt.5 Insbesondere den Texten des Strickers wird oft eine besondere Lehr- und Beispielhaftigkeit zugeschrieben und das Erzählen im Kontext eindeutiger moralischer Belehrung gelesen. So führt Hagby in ihren Beispielanalysen die Dichtungen des Strickers immer auf das Moment des Lehrhaften zurück. Dabei konstatiert sie, dass der Stricker, anders als die lateinischen Exempla, vor allem den Typus des ‚parabolischen‘ Exemplum prägt, das als „mehrspuriges Erzählen“ narrative Überschüsse generiert. Die ausgespielte narrative Freiheit und die inhaltlichen Widersprüche würden aber nicht den exemplarischen Charakter, die grundsätzliche Verbindlichkeit einer Erzählabsicht, die auf Belehrung ausgerichtet ist, nivellieren.6 Hagby unterscheidet dabei ausdrücklich nicht zwischen Bîspel und Versnovelle, sondern untersucht den Bereich der Strickerschen Kurzerzählung insgesamt, der geschlossen auf das gemeinsame Prinzip exemplarischer Lehrhaftigkeit verweise.7 Aber eben diese narrativen Überschüsse und Freiheiten, die häufig Inkohärenzen im Schema lehrhaften Erzählens bedingen, sind ein Merkmal, das die Texte des versnovellistischen Korpus in besonderem Maße auszeichnet. Sie stellen damit ein wesentliches Moment für die generische Unterscheidung von anderen kleinepischen Textsorten wie den Exempla, Fabeln und Bîspeln dar.8
Ragotzky stellt in ihrer Untersuchung das Motiv der gefüegiu kündikeit als zentrales Moment im Erzählen des Strickers heraus, die hier trotz ihrer semantischen Korrelation mit list und triegen aber nicht als negative Kategorie erscheine, sondern positiv umsemantisiert würde zu einer ‚Handlungsethik‘ der Verstandesleistung.9 Die gefüegiu kündikeit als praxisbezogene Fähigkeit bedinge eine „situationsgemäße Realisierung von wîsheit“ und ermögliche es den Protagonisten der stets auf exemplarische Rollenbeziehungen und Rechtsvorstellungen bezogenen Texten, entweder die verletzte Ordnung zu restituieren oder die zur kündikeit unfähige Person zu zerstören.10 In beiden Fällen ziele die gefüegiu kündikeit letztlich auf die Verwirklichung gottgewollter Ordo ab:
kündikeit ist […] das Thema der Mären. gefüegiu kündikeit wirkt sozial konstruktiv, sie zielt ab auf die Wahrung oder Wiederherstellung von Recht, sie sichert und initiiert das ordogemäße Zusammenspiel der Rollen und ist in diesem Sinne Bedingung für die Verwirklichung des von Gott gesetzten Ordnungsentwurfs der Welt.11
Grubmüller spitzt die Deutung der Stricker-Texte als ordokonforme Erzählungen weiter zu, indem er diese als Exempel für die Notwendigkeit der Beachtung der gottgewollten Lebensordnung liest. Er spricht den Dichtungen des Strickers als typenbildender Form der Versnovellen weitgehend kohärente Sinnsetzungen zu: Zumeist erfolge eine Störung der Ordnung und deren Restitution durch Einsicht oder List; die Erzählmechanik basiere wesentlich auf dem Schema von Ordnungsverstoß und Replik.12 Im historischen Gattungsverlauf würden diese traditionellen Ordnungsmodelle allmählich einer relationaleren Geltung von Normen weichen, die bis hin zur Narrativierung von Kontingenzerfahrung und Absurdität reiche, wie sie vor allem in den Texten Heinrich KaufringersKaufringer, Heinrich fassbar werde. Das versnovellistische Erzählen würde aber weiterhin auf das konstituierende Schema des Ordnungsdiskurses als „lehrhafte Gattungserwartung“ referieren.13
Die Lesart der Ordo-Bestätigung ist bei dem ersten von Ragotzky ausgeführten Beispiel ‚Der kluge KnechtStricker›Der kluge Knecht‹‘ plausibel: Indem der Protagonist raffiniert die Untreue der Ehefrau seines Herren enttarnt, kann tatsächlich Ordnung wiederhergestellt werden, denn der Ehemann wird ins Bild gesetzt, die untreue Frau bestraft und der loyale Knecht belohnt. Bei anderen von Ragotzky angeführten Beispielen erweist sich die Lesart einer Bestätigung von Ordnung aber als nur begrenzt funktionierend, indem verschiedene Störmomente eingespielt werden:
So wird Strickers ‚Der begrabene EhemannStricker›Der begrabene Ehemann‹‘ als weiteres Beispiel angeführt.14 Die Versnovelle beginnt ohne Promythion unvermittelt mit dem emphatischen Minnebekenntnis eines Mannes an seine Frau, die daraufhin einen Beweis für seine große Liebe fordert. Weil sie es als die größtmögliche Kränkung darstellt, wenn ein Mann seiner Frau nicht glaubt, leistet er einen Eid, ihr künftig in allem, was sie sagt, Glauben zu schenken. Als Probe aufs Exempel erklärt sie ihrem Mann zur Mittagszeit, es sei bereits Abend und Zeit zum Schlafen. Auf seinen Widerspruch reagiert sie mit tiefer Kränkung, weil er ihr zu Liebe nicht bereit war, diesen einfachen Beweis seiner Zuneigung zu erbringen. Die nächste Probe, eine Wanne eiskalten Wassers als warmes Bad zu akzeptieren, lässt er daher klaglos über sich ergehen und wird für lange Zeit mit liebevoller Behandlung belohnt.
Als die Frau eine Buhlschaft mit einem Pfaffen eingeht, wird ihr der eigene Mann lästig, und so folgt eine dritte und finale ‚Liebesprobe‘: Sie erklärt ihrem Mann, dass er todkrank wäre und der Sterbesakramente bedürfe. Der Mann, der an eine erneute Probe glaubt, die ihm weiterhin sein glückliches Eheleben sichern wird, legt sich bereitwillig auf das ‚Sterbebett‘, empfängt von seinem Nebenbuhler die Sakramente und lässt sich zur Kirche und zu Grabe tragen. Erst als er erkennt, dass er tatsächlich begraben wird, schreit er aus seinem Grab um Hilfe, die ihm aber versagt bleibt: Der Pfaffe erklärt den anwesenden Gemeindemitgliedern das Schreien des lebendig Begrabenen als Wüten des Teufels, der von dem Verstorbenen Besitz ergriffen habe.
Ragotzky attestiert dem Ehemann eine Normverletzung, die in seinem übermäßigen Minnebekenntnis bestehe. Sein Eid, mit dem er sich bedingungslos der Deutungshoheit seiner Frau unterstellt, leite nicht nur einen Prozess der Selbstaufgabe ein, er stelle auch einen Verstoß gegen die patriarchale Hierarchie dar. Sein grausames Schicksal sei damit nicht nur Strafe für seine Ehe- und Rechtsunfähigkeit, die Eliminierung seiner Person stelle auch eine Restitution der Ordnung dar.15 Diese Lesart ist aber keineswegs so kohärent in der Erzählung angelegt. Zweifellos wird die fehlende Dominanz des Mannes thematisiert und in dem knappen Epimythion auch als Grund für seinen Schaden benannt. Aber ob das emphatische Liebesbekenntnis, das den Auftakt der Handlung bildet, tatsächlich mit Ragotzky als Verstoß gegen „eine ausbalancierte Minne- und Ehebeziehung“ gedeutet werden muss,16 ist fraglich, gehören solche formelhaften Liebesbeteuerungen doch zum konsensualen Inventar höfischer Minnerhetorik. Zwar zeigt sich die Frau in ihrer auf argumentativer Fähigkeit basierenden kündikeit als ihrem Mann überlegen, aber der Ehemann ist keineswegs von vornherein ein Minnetor, dessen Unfähigkeit eine Sanktionierung rechtfertigt. Mit seinem Liebesbekenntnis und dem Wunsch, den Willen der Frau zu erfüllen, wird das normative Moment des Minnediskurses eingespielt und rhetorisch erfüllt. Erst das Insistieren der Frau auf dem Beweis seiner Liebe weist ihm die Rolle des Toren zu, wobei der Mann aber die Absurdität ihrer Behauptungen sehr wohl erkennt; er glaubt weder an die falsche Tageszeit noch an das warme Badewasser, schon gar nicht an seine tödliche Erkrankung, aber die geforderten Liebesbeweise scheinen ihm ein akzeptabler Preis für ein angenehmes Eheleben. Das Verhalten des Mannes transportiert einerseits eine Verletzung patriarchalischer Normen, andererseits resultiert es aus einem durchaus ordokonformen Verhaltenskonzept, das in seiner destruktiven Konkretisierung vorgeführt wird.
Auch wenn man die Demonstration von kündikeit und die Sanktionierung fehlender Dominanz als konstituierenden Inhalt der Erzählung akzeptiert, bleibt die Deutung der Tötung des Ehemannes als Verwirklichung von Ordo problematisch, denn der Normbruch der ehebrechenden Frau und des buhlenden Pfaffen als moralisch deutlich defizienteren Figuren bleibt ohne Sanktionierung und wird aus der belehrenden Auslegung des Epimythions ausgeblendet. Auch wird mit dem Handeln der Frau, das in seiner Kaltblütigkeit und seinem taktischen Kalkül herausgestellt wird,17 deutlich vorgeführt, dass die Fähigkeit zur kündikeit mindestens ebenso Normverletzungen bedingt wie die Absenz dieser Kompetenz.18
Ähnlich sperrig gegenüber einer plausiblen normativen Sinnkonzeption verhält sich Strickers ‚Das heiße EisenStricker›Das heiße Eisen‹‘, das die Institution des Gottesurteils aufgreift, die unter anderem durch Gottfrieds ‚TristanGottfried von Straßburg›Tristan‹‘ ein etabliertes literarisches Motiv darstellt.19 Der von seiner Frau zwecks Beweis seiner Treue zum Tragen eines glühenden Eisens aufgeforderte Ehemann besteht die Probe unbeschadet, indem er dieses heimlich mit einem schützenden Holzspan anhebt. Als er wenig überraschend eine Gegenprobe fordert, gerät die Frau in Verlegenheit und beichtet sukzessive mehrere Fehltritte, für die sie um Nachsicht bittet. Letztlich wird ihr die Prüfung aber nicht erspart, sie zieht sich schwere Verbrennungen zu. Als der Ehemann die verbrannte Hand verbinden will, weist die Frau ihn zurück, die Hand sei zu sehr verbrannt, um sie zu heilen. Der Ehemann reagiert mit Empörung: als er daz hôrte unde sach,/ ûz grôzem zorne er dô sprach:/ hie ist dîn triuwe worden schîn (V. 185ff.); voll Zorn kündigt er die eheliche Harmonie und Zuneigung auf.
Die Feuerprobe kennt zwei Arten des ‚Bestehens‘, indem der Geprüfte entweder unverletzt bleibt oder aber das schnelle Abheilen der Verbrennung als Unschuldsbeweis gilt;20 ob ‚Das heiße Eisen‘ auf beide oder nur die erste Variante rekurriert, kann nicht eindeutig entschieden werden. Der vom Ehemann bereitgehaltene Verband kann Bestandteil der Probe sein, was seinen Zorn nach der erklärten Irreversibilität der Verletzung plausibilisiert. Das Verbinden kann aber auch einen Versuch zur Wiederherstellung der ehelichen Gemeinschaft darstellen, indem er der Frau nach der erfolgten Sanktionierung ‚Heilung‘ anbietet, die diese aber verweigert und damit seinen Zorn auslöst.
Neben der Erzählung des Strickers sind auch exempelhafte Fassungen des Erzählstoffes tradiert. Hier wird eine eindeutige exemplarische Geltung entworfen, indem das Exempel sowohl die Wirkung der Buße als auch die Funktionalität des Gottesurteils demonstriert: Durch die vorherige Beichte des Ehebruchs bei einem Geistlichen kann die Frau die Prüfung am heißen Eisen unbeschadet bestehen.21
Dagegen verweigert sich ‚Das heiße Eisen‘ einer vergleichbaren exemplarischen Gültigkeit. Zwar lässt sich die Bloßstellung und Bestrafung der Ehefrau als normatives Moment fassen, denn das grundlose Einfordern des Treuebeweises als Aufbegehren gegen die eheliche Hierarchie wird sanktioniert. Aber zugleich wird exemplarische Eindeutigkeit und kohärente Sinnstiftung verweigert, indem die vordergründig verhandelte Normativität der ehelichen Treue unbeantwortet bleibt.
Formal folgt die Erzählung zwar dem Schema des Gottesurteils von ‚Prüfung – Beweis der Unschuld‘ im ersten sowie ‚Prüfung – Offenlegung der Schuld – Strafe‘ im zweiten Fall. Aber tatsächlich wird der Ehebruch der Frau nicht erst durch die Verbrennung der Hand offenkundig, sondern ist bereits gestanden worden. Ob der gestandene Ehebruch tatsächlich stattgefunden hat oder das Geständnis schlicht aus Angst vor der Feuerprobe erfolgte, an deren Bestehbarkeit die Frau gar nicht glaubt, wird sowenig beantwortet wie die Frage nach der Treue des Mannes, der das glühende Eisen durch List bewältigt hat. Der Text spielt mit der vermeintlichen Normativität des Gottesurteils, das sich als vollkommen irrelevant erweist, denn die Prüfung am heißen Eisen leistet keinerlei Beitrag zur Erkenntnis. Die Eisenprobe dient nicht der Wahrheitsfindung, sondern wird durch die Eheleute in einem Kampf um eheliche Macht instrumentalisiert. Zunächst glaubt die Frau zu triumphieren, weil sie ihrem Mann durch die willkürliche und nicht-legitimierte Anklage die Prüfung auferlegen kann. Der Mann wiederum nutzt das glühende Eisen in seiner Replik als Körperstrafe für das Aufbegehren, vielleicht auch für den gestandenen Ehebruch der Frau.22 Die eigentliche Funktion des Gottesurteils wird dabei ad absurdum geführt; mit der ausgestellten Irrelevanz und Hintergehbarkeit des Wahrheitsinstruments wird auch die Möglichkeit sicherer Erkenntnis und Eindeutigkeit negiert.
Es ist zweifellos zutreffend, dass der Ordobezug wesentlicher Gegenstand der diskursiven Verhandlung im versnovellistischen Erzählen ist, insbesondere in den Erzählungen des Strickers. Das vorgestellte Konzept der Bestätigung normativer Ordnungsvorstellungen trägt aber nur bei positiv konzipierten Texten wie ‚Der kluge KnechtStricker›Der kluge Knecht‹‘, in denen tatsächlich Gerechtigkeit und Ordnung hergestellt werden. In den ‚Negativbeispielen‘ wie ‚Der begrabene EhemannStricker›Der begrabene Ehemann‹‘ oder ‚Das heiße EisenStricker›Das heiße Eisen‹‘ lösen sich die Texte mit ihren narrativen Überschüssen und Störmomenten dagegen nicht vollständig in diesem Interpretationsschema auf.
Die wenigsten Versnovellen vermitteln eine kohärente Exemplarizität oder gar dezidierte Didaxe, auch die Strickertexte können nicht durchgehend als apodiktische Demonstration der Gültigkeit von Normen gelesen werden.23 Das genuine Thema der Versnovellen ist nicht das Aufzeigen von Ordnungsstrukturen und den Konsequenzen ihres Nicht-Befolgens, denn die Erwartung an kohärente und immer gültige Ordnungsmuster bleibt zumeist unerfüllt und wird durch kontingente Perspektiven unterlaufen.24 Gerade weil das Glück in den Versnovellen zumeist mit den Klugen ist, unabhängig von deren moralischer Integrität, tritt an die Stelle einer stringenten exemplarisch-normativen Logik, die auf dem Modell Ordnungsverstoß-Sanktionierung basiert, durch das Ausspielen der moralisch uneindeutigen Kategorien von list und kündikeit eine andere, poetische Erzähllogik, die nicht mehr der Bestätigung einer kohärenten Normativität verpflichtet ist.
Auch Ragotzky grenzt in einem späteren Beitrag das Konzept der kündikeit von dem vorgestellten exempel-ähnlichen Textverständnis und einer dezidiert lehrhaften Funktionalisierung ab. Indem sie die Stricker-Texte nicht mehr als schematisches Aufzeigen der Notwendigkeit von Ordo, sondern als Verhandlung der Frage beschreibt, wie angesichts unklarer Bedingungen klug gehandelt werden kann, interpretiert sie die kündikeit vor allem als Fähigkeit zu situationsgemäßem Handeln.25 Diese Modifizierung trägt zwar den uneindeutigen Normbezügen der Texte Rechnung, impliziert allerdings eine pragmatische Lesart der versnovellistischen Dichtung, die zum Anschauungsmaterial für das Handeln in einer durch Kontingenz geprägten Welt gemacht wird. Janota formuliert diese funktionale Zuschreibung noch prägnanter, indem die Versnovellen zum Ausdruck einer Suche nach Lebensorientierung erklärt werden. Durch lehrhafte Einzelbeispiele würden die Texte vorführen, wie man durch Rationalität im Leben bestehen kann. Gerade die schwankhaften Texte böten dabei durch die Demonstration von Klugheit Identifikationsangebote und konkrete Belehrung: „es ist offenkundig das Prinzip der Rationalität, von dem man sich Orientierung in einer komplexen Welt versprach.“26
Mit der Vermittlung von Handlungsklugheit und Kontingenzbewältigung kann die ausgestellte Ambiguität der Texte aber nicht sinnhaft gemacht werden, ebenso wenig erschöpft sich diese in der Narrativierung der Kontingenzerfahrung an sich.27 Waltenberger fasst den Geltungsbezug der Versnovellen als „kontextuelle Valenz“,28 mit der die Situationsgebundenheit von Normen als Erkenntnispotential vermittelt wird. Dem ist nicht nur ein negierendes oder auflösendes, sondern auch ein stabilisierendes Moment inhärent: Indem die Texte die Situationsgebundenheit oder Unentscheidbarkeit von Normen aufzeigen, fordern sie zur Reflexion der Verbindlichkeit von Geltungsmustern auf und festigen das Wissen über die Relationalität von Geltung.29 Das von Ragotzky formulierte Prinzip der kündikeit wird damit modifizierend aufgegriffen und stellt sich gerade dann als wesentliches Konstituens heraus, wenn sich die
Exemplarizität des Märe nicht auf eine situationsabstrakte Universalität substantieller Werte bezieht, sondern mit Ragotzky den variablen Situationsbezug selbst zur moralischen Kategorie erhebt, die im Märe exemplifiziert werden soll.30
Dabei werden nicht unbedingt die verhandelten Normen an sich in Frage gestellt, sondern die Universalität ihrer Gültigkeit: „die doppelte Logik der Kurzerzählungen […] suspendiert einen sozialen Sinn nicht einfach, wohl aber umspielt sie die Fragilität seiner Bedingungen.“31 Damit lösen sich die Versnovellen von der ursprünglichen Funktion exemplarischen Erzählens, denn sie gestalten das Erzählte gerade nicht als eindeutigen Beleg für eine konkrete Lehre, sondern inszenieren eine die „Allgemeingültigkeit sprengende Erfahrung des Konkreten“.32
Die Versnovellen können, analog zu den französischen Fabliaux, als Anti-Exempel verstanden werden, indem sie statt konkreter Didaktisierung Pluralität und ein variables Normverständnis transportieren und zu eigenständiger Lektüre aufrufen:
In terms of genre, the fabliaux do represent a kind of anti-exemplum because they insist on multiple readings and interpretations removed from a moral framework. […] the fabliaux are not exempla-in-malo, studies of how not to live and behave, but rather examples of how to read.33
Die Narrativierung von Kontingenz und die Absage an normative Gültigkeiten bedingen eine kulturelle und literarische (Selbst)Reflexion, deren Gegenstand auch das traditionsstiftende exemplarische Erzählprinzip selber ist.34 Die Texte sind oft nur noch strukturell exemplarisch, ohne auf ein tatsächliches normatives Moment abzuzielen: „Das Erzählen entfernt sich von einer funktionalen Lehre und referiert zunehmend auf sich selbst.“35
Eine fragwürdige Inszenierung des exemplarischen Erzählmoments gestaltet zum Beispiel die anonym überlieferte Versnovelle ‚Die Buhlschaft auf dem Baume›Die Buhlschaft auf dem Baume‹‘. Erzählt wird von einem blinden Mann und seiner schönen jungen Frau, die er eifersüchtig zu überwachen sucht, indem er sie nachts mit eisernen Fesseln an ihr Bett bindet.36 Die übergroße huote nützt ihm nichts, denn die Frau verabredet ein Stelldichein mit einem Studenten und erweist sich in ihrem Handeln als ganz dem Schema der listreichen Ehebrecherin entsprechend. Sie gibt vor, auf einen Baum klettern zu wollen, um sich Äpfel zu pflücken; den misstrauischen Ehemann fordert sie auf, den Stamm zu umfassen, damit er sicher sein kann, dass ihr niemand auf den Baum folgt. Tatsächlich wartet im Wipfel des vermeintlichen Apfelbaumes, der in Wahrheit eine Linde ist, bereits der Student mit einem Vorrat an Äpfeln, die er während des Liebesspiels hinunterwirft.37
Der ausgefeilte Betrug wird Gegenstand moraltheologischer Verhandlung von höchster Instanz, indem Christus und Petrus, wie gewöhnliche Figuren vorbeispazierend, Zeugen des Geschehens werden. Als der empörte Petrus verlangt, den Blinden sehend zu machen, gibt Christus zu bedenken, dass die Frau auch in diesem Fall eine passende Antwort finden würde. Er gestaltet das Geschehen zu einer exemplarischen Vorführung der Frauenlist für den unwissenden Petrus: so wil ich dich lassen sehen/ wie die fraue wirt jehen (V. 149f.). Er gibt dem Blinden sein Augenlicht wieder, der sofort die Ehebrecher töten will. Als die Frau aber den Beischlaf als planvolles Handeln darstellt, das allein auf diese Wunderheilung abzielte, lässt er nicht nur von seiner Rache ab, sondern belohnt den Studenten dankbar mit einem Geldgeschenk. Dass die Behauptung der Frau nicht einmal falsch ist, denn tatsächlich verhalf das himelisch kint (V. 168) zu der Heilung des Ehemannes, gehört zu den doppelbödigen Petitessen, die ‚Die Buhlschaft auf den Baume‘ zu einem eindrucksvollen Beispiel für die beiläufig eingespielten Ironisierungen des versnovellistischen Erzählens macht. Als Petrus hinzutritt, um dem ehemals Blinden persönlich die Wahrheit über das Geschehen darzulegen, beweist die Frau erneut ihre Schlagfertigkeit. Bevor der Heilige zu Wort kommen kann, behauptet die Frau, Petrus sei ihr heimlicher Liebhaber gewesen, der jetzt die Heilung des Blinden rückgängig machen wolle, um die Liebschaft fortzusetzen. Abschließend werden nicht etwa die Ehebrecher, sondern der mühsam vor der Attacke des Ehemannes geflüchtete und auf Rache sinnende Petrus belehrt: Christus erinnert an sein Selbstopfer für den sündigen Menschen und verweist auf seine unendliche Gnade für den reuigen Sünder.
‚Die Buhlschaft auf dem Baume‘ führt nicht nur ein vielschichtiges Spiel um Sehen und Erkennen vor, sondern verhandelt auch das Prinzip exemplarischer Geltung. Christus selber formuliert die Lehrrede und gibt der exemplarischen Geltungsbehauptung damit besonderes Gewicht. Seine Lehrrede führt einerseits einen allgemein gültigen Glaubenssatz vor, indem Christus an die Vergebung aller Sünden erinnert und die profane Ehebruchhandlung in einen heilsgeschichtlichen Zusammenhang einordnet. Gleichzeitig bedingt schon das ganz unmotivierte Auftreten der geistlichen Figuren, die wie gewöhnliche Schwankfiguren agieren, eine Einschränkung der Dignität des Geistlichen und damit der Gültigkeit der exemplarischen Belehrung. Auch ist die Gültigkeit durch den deutlichen Verweis auf Buße und Reue als Basis der Vergebung gebrochen – denn davon ist bei der Frau nichts zu spüren. Der distanziert kommentierende Christus gestaltet zwar eine dezidierte Belehrung, aber die Geschichte ist nicht wirklich Beispiel für die Vergebung, die der reuige Sünder erfährt, sondern vielmehr ein Schaustück für die Schlechtigkeit der Welt und die grenzenlose List der Frauen. Das himmlische Personal ist den weltlichen Figuren nicht überlegen, denn vor der listigen Klugheit der Frau muss Petrus kapitulieren und vielleicht sogar Christus selber resignieren.38 Indem selbst der exemplarischen Belehrung durch Christus die Möglichkeit einer plausiblen Auslegung und gültigen Handlungsmaxime fehlt, erzeugt das exemplarische Moment selber Kontingenz und wird zu einem leeren Gestus ohne inhaltliche Verbindlichkeit.