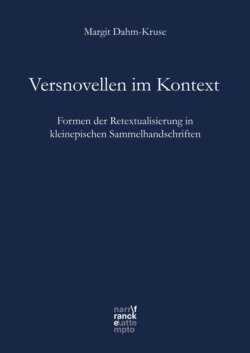Читать книгу Versnovellen im Kontext - Margit Dahm-Kruse - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6.2 Nürnberger Literaturbetrieb und ‚städtisches‘ Sammlungsinteresse
ОглавлениеDer Cgm 714 steht in seiner Textauswahl und -zusammenstellung in engem Zusammenhang mit dem städtischen Literaturbetrieb in Nürnberg. Während bei der literarischen und handschriftlichen Produktion des 13. und 14. Jahrhunderts noch nicht von einer klaren Geschiedenheit zwischen einer adlig-höfischen und einer städtischen Literaturproduktion ausgegangen werden kann, ist im 15. Jahrhundert vor allem in Nürnberg ein spezifisch städtischer Literaturbetrieb fassbar, der eigene literarische Formen und Institutionen hervorgebracht hat und der auch andere Paradigmen im Umgang mit literarischen Themen und Traditionen bedingt.
Die Vorstellung einer Dichotomie zwischen einer ritterlich-höfischen und einer genuin ‚bürgerlich‘-städtischen Dichtung gibt die tatsächlichen Gegebenheiten des mittelalterlichen Literaturbetriebes zunächst nicht adäquat wieder. So weist Peters die Annahme eines genuin ‚bürgerlichen‘ Selbstverständnisses, das sich in einer entsprechenden Literatur manifestiere, zurück. Die frühen städtischen Literaturzentren stellen keine Konkurrenz zum literarischen Leben an den Fürstenhöfen dar und weisen ähnliche Strukturen hinsichtlich Aufführungspraxis, Mäzenatentum und Auftragssituation auf. Den Parallelen zwischen den höfischen und städtischen Literatursystemen entsprechend ist eine große Konstanz in der Tradierung adlig-höfischer Literatur fassbar, die auch Gegenstand des literarischen Interesses der städtischen Oberschicht ist. Konrad von Würzburg steht prototypisch für diese Kontinuität adlig-höfischer Literatur im literarischen Leben der Stadt des 13. Jahrhunderts: Zwar lebte Konrad in der Stadt und produzierte für ein städtisches Publikum, aber seine Produktion kann nicht als eine spezifisch städtische oder gar bürgerliche beschrieben werden.xxx
Die Vorstellung von einem geschlossenen und ständisch definierten ‚Bürgertum‘ wird auch aus historischer Perspektive zurückgewiesen; der Bürger-Begriff findet primär als rechtsgeschichtlicher Terminus Anwendung, nicht aber als Ausdruck für eine zusammengehörige soziale Gruppe, in der die in ihrer Sozialstruktur äußerst heterogene Stadtbevölkerung als Ganzes subsumiert würde. Auch für den Nürnberger Literaturbetrieb des 15. Jahrhunderts wurde die Vorstellung eines homogenen Bürgertums zurückgewiesen. Reichel stellt fest, dass die Dichtung Rosenplüts trotz ihrer Verortung in einem genuin städtischen Kontext kein Bürgertum als geschlossenen sozialen Stand kennt, sondern dieses stets differenziert nach verschiedenen Gruppen und Berufen behandelt. Zwar ist Rosenplüts Texten gelegentlich eine deutliche Opposition gegen adlige Lebensformen eingeschrieben, ‚den Bürger‘ als integrierenden Sozialstatus kennt seine Dichtung aber ebenfalls nicht.xxx
Aber auch hinsichtlich der städtischen Führungsschichten wird eine strikte Dichotomie zum Adel in Frage gestellt. Den ‚Stadtadel‘ kennzeichnet eine ähnlich hierarchische Sozialstruktur wie den Adel, er teilt in vielem dessen Lebensformen und Wertvorstellungen. Adliges Leben war Teil der Stadtkultur, stadtadlige Familien erwarben herrschaftliche Güter, führten Wappen und veranstalteten Turniere. Vor allem betrieben die städtischen Eliten eine ähnliche, zum Teil geburtsrechtlich definierte soziale und politische Abgrenzung nach unten.xxx Trotz signifikanter Parallelen in Lebensführung und Selbstverständnis ist aber nicht von einer völligen Nivellierung der Geschiedenheit zwischen einem geburtsrechtlich definierten Adel und den städtischen Eliten auszugehen.xxx Das Verhältnis der städtischen Eliten zur adligen Lebenswelt erweist sich insgesamt als widersprüchlich, es bewegt sich zwischen den Polen von Kontinuität und Adaption auf der einen Seite und einem genuin eigenen Werte- und Selbstverständnis auf der anderen Seite. Vor diesem Hintergrund ist es plausibel, den Einfluss des Stadtadels auf den spätmittelalterlichen Literaturbetrieb ähnlich dialektisch zu betrachten, indem dieser einerseits an ritterlich-höfischen Literaturtraditionen partizipiert und diese fortführt, zugleich aber auch prägender Faktor für literarische Neuerungen ist. Neben dem Stadtadel treten zunehmend weitere Gruppierungen und Berufsgruppen wie Juristen oder Ärzte, die in der Regel nicht dem oberen Segment der städtischen Führungsschicht angehörten, als wichtige literarische Rezipienten- und Käufergruppen in Erscheinung. Die Stadt als soziokultureller Faktor und als Literaturbetrieb prägt, trotz der Kontinuitäten in der literarischen Tradition und den Interessenlagen, eigene, neue Impulse und Prozesse, die die literarische Entwicklung des Spätmittelalters maßgeblich beeinflussen.
Entsprechend entstehen in den literarischen Zentren der Städte allmählich spezifische Formen und Institutionen der Literaturproduktion und -rezeption. Dabei stellt das 14. Jahrhundert eine Übergangsperiode dar, in der sich allmählich literarische Vorlieben und Formen des Literaturbetriebs herausbilden, die im 15. Jahrhundert programmatisch für eine spezifisch städtische Literatur werden. Diese bedingen aber im 14. Jahrhundert noch keine entscheidende Umstrukturierung, sondern stellen „punktuelle Ansätze einer allmählichen Veränderung der sozialen Voraussetzungen der literarischen Produktion“ dar.xxx Erst im Verlauf des 15. Jahrhunderts tritt eine genuin städtische Literatur in Erscheinung, die eigene literarische Formen und Strukturen ausprägt; vor allem in Nürnberg entwickelt sich ein virulenter Literaturbetrieb mit spezifischen Institutionen und auch literarischen Gattungen.xxx Trotz erheblicher Divergenzen zwischen den unterschiedlichen Städten lassen sich gemeinsame Merkmale urbaner literarischer Kommunikation feststellen. Neben einem großen Interesse an einer schriftliterarischen Verhandlung des gesellschaftlichen und politischen Lebens ist eine intensive Tradierung kleiner Formen erkennbar; entsprechend stellen kleinepische Sammelhandschriften und andere Kompilationen mit Kurztexten einen wichtigen Bereich städtischer Literaturproduktion dar.
Der herausragenden politischen und wirtschaftlichen Stellung Nürnbergs entspricht auch ein besonders virulentes literarisches Leben, das in seiner literarischen Produktivität und Vielfalt andere spätmittelalterliche Städte weit übertrifft. Zwar kennzeichnet sich Nürnberg durch eine besonders strikt abgegrenzte und hierarchisch strukturierte städtische Oberschicht, die den Zugang zum Rat via Geburtsrecht definierte und nur einer klar festgelegten Anzahl von führenden Familien ermöglichte. Das Nürnberger Tanzstatut von 1521, in dem die Gruppe der ratsfähigen Familien endgültig festgeschrieben wurde, demonstriert, dass die soziale und politische Abgrenzung des Patriziats von anderen städtischen Gruppen im historischen Verlauf keine Nivellierung erfuhr, sondern sich sogar festigte. Der Rat übte eine weitreichende Reglementierung aus, die die Partizipation anderer Gruppen an stadtpolitischen Entscheidungsprozessen einschränkte. So konnten die Zünfte in Nürnberg im Gegensatz zu anderen oberdeutschen Reichsstädten weder eine Teilhabe am Stadtregiment erlangen, noch, da der Rat das Meisterrecht vergab, über die Ausführung der Gewerbe bestimmen.1 Trotz der geringen politischen Einbindung hatte die umfangreiche Mittelschicht entscheidenden Anteil am literarischen Leben der Stadt.
Geradezu Alleinstellungsmerkmal hat die umfassende Beteiligung der illiteraten Handwerkerschaft an der literarischen Produktion, deren Institutionen der Literaturpraxis wie Spielvereinigungen und Singschulen einen wichtigen Impulsgeber für die literarische Aktivität darstellt.2 Poetisch manifestiert sich das literarische Schaffen der Handwerkerschaft vor allem im Fastnachtspiel und im Meistersang sowie in der Literarisierung verschiedener Kleinformen wie Priameln und Klopfan-Sprüchen, aber auch etablierte literarische Traditionen wie Versnovellen und Reden wurden durch diese Trägerschaft adaptiert und fortgeführt.3 Daneben ist die literarische Landschaft Nürnbergs auch durch eine reiche Produktion geistiger Literatur geprägt, es findet sich viel religiöses Schrifttum, das geistliche Belehrung und soziale Normierung, vor allem hinsichtlich der Sexualmoral, transportiert.4 Die in Nürnberg literarisch besonders profiliert agierende Handwerkerschaft ist dabei nicht als eine dichotomisch abgegrenzte Gruppe zu verstehen, vielmehr deutet die Überlieferung auf ein Ineinandergreifen der unterschiedlichen literarischen Traditionen und Trägerschaften hin. Dies bestätigt auch die Betrachtung der Erstkäufer und Besitzer der Fastnachtspiel-Handschriften, die auf eine typische soziale Struktur spätmittelalterlicher Handschriftenbesitzer wie Ärzte, Kaufleute, Juristen und Kleriker hinweist; entsprechend dürfte die Rezipientenschicht der Spiele nicht auf die Handwerkerschaft begrenzt gewesen sein.5
Die spannungsvolle Relation von Tradition und Innovation, die wesentlich die Ausprägung der Textsorte Versnovelle prägt, kennzeichnet die literarische Produktion im spätmittelalterlichen Nürnberg insgesamt, in der sich eine ausgeprägte „Emanzipation der Laien von den Vorgaben der literaten Tradition“ zeigt.6 Befördert durch die immense Ausweitung der Literaturproduktion, die auch in Nürnberg ab den 1430er Jahren und damit deutlich vor dem Medienwechsel fassbar ist, laufen im Nürnberger Literaturbetrieb die Adaption und Veränderung literarischer Traditionen, die Überführung etablierter Gattungen in neue Kontexte und die Gestaltung von neuen Inhalten und literarischen Formtypen neben- und ineinander:7
Selbstverständlich ist der kreative Umgang mit literarischen Vorlagen und Textsorten keine Erfindung der Nürnberger und die ‚Literaturexplosion‘ nicht auf diese Stadt beschränkt. Aber durch die außergewöhnliche Dichte an Autoren, Themen und literarischen Typen lässt sich für Nürnberg eine literarische Diskussion nachzeichnen, in der die Begriffsbildung vom städtischen Gemeinwesen als kulturkritischer Prozess des Entwerfens, Verwerfens und Etablierens von Themen, literarischen Techniken und Textsorten beschrieben werden kann.8
Der Cgm 714 ist mustergültig für diese den Nürnberger Literaturbetrieb konstituierende Verbindung aus neuem sowie älterem, etabliertem Material. Das tradierte Textgut wird dabei auf eine Art und Weise bearbeitet und in neue Kontexte gestellt, die auf ein weitreichendes Verständnis schreiberischer Autonomie und eine große Freiheit im Umgang mit der Tradition schließen lassen.9 Die Sammlung ist aber auch in besonderem Maße repräsentativ für den Literaturstandort Nürnberg, weil sie eine der Haupthandschriften für die frühe, durch Hans RosenplütRosenplüt, Hans›Fastnachtspiele‹ geprägte Fastnachtspieltradition darstellt.
RosenplütRosenplüt, Hans seinerseits prägt und repräsentiert in besonderem Maße die Paradigmen des Nürnberger Literaturbetriebs seiner Zeit.10 Als Handwerksmeister und Angehöriger der stadtbürgerlichen Mittelschicht ist er der erste bekannte ‚Handwerkerdichter‘ der deutschen Literatur und einer der ersten deutschsprachigen Autoren überhaupt, die nachweislich dauerhaft in einer Stadt ansässig waren und in einem „kontinuierlichen Lebenszusammenhang mit der Stadt und ihren Bürgern“ standen und die ihr dichterisches Werk explizit auf dieses städtische Publikum bezogen haben.11 Rosenplüt hat die ihm zugeschriebenen Fastnachtspiele vermutlich nicht originär geschaffen, aber er hat die Gattung entscheidend geprägt, indem die Spiele durch ihn „literarisch geworden“ sind.12 Auch die Literarisierung von Kleinstformen wie Priameln und Klopfan-Sprüchen gilt als genuine Leistung Rosenplüts, der „Brauchtümliches aus der nur-oralen Vermittlung“ führt und zu neuen Ausdrucksformen der literarisierten Schriftlichkeit macht.13 Zu Rosenplüts Œuvre gehören weiterhin zahlreiche Formen der kleinen Reimpaardichtung, die eine große Vertrautheit mit den entsprechenden volkssprachigen Texttraditionen nahelegen, sowie eine Reihe dezidiert geistlicher Texte.14 Rosenplüt zeigt dabei beispielhaft, dass sich die Produktion von schwankhaftem Erzählgut mit einer unverhohlenen Thematisierung des Sexuellen und von Texten zur religiösen Unterweisung keinesfalls ausschließen müssen und dass diese divergenten literarischen Bereiche problemlos nebeneinander stehen können. Auch im Cgm 714 werden diese gegensätzlichen Pole von Rosenplüts literarischem Schaffen zusammengeführt, indem im ersten Teil des Codex sowohl eine schwankhafte Versnovelle als auch zwei geistliche Reimpaarreden Hans Rosenplüts inseriert sind.