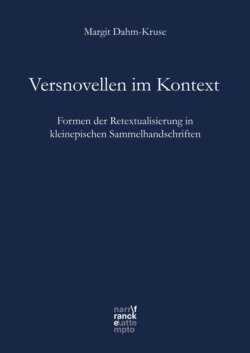Читать книгу Versnovellen im Kontext - Margit Dahm-Kruse - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.4 Retextualisierung – der Text zwischen Offenheit und Festigkeit
ОглавлениеTextuelle Varianz wurde häufig auf eine durch mündliche Überlieferung bedingte Auflösung zurückgeführt, indem aus einer quasi mnemotechnischen Adaption der Texte keine Wort-für-Wort, sondern eine sinngemäße Reproduktion resultiere.1 Das Argument wurde verschiedentlich auch für die Divergenzen im Textbestand kleinepischer Dichtungen bemüht, der Kommentar von Edward Schröder zur Edition des ‚HerzmaereKonrad von Würzburg›Das Herzmaere‹‘ steht prototypisch für diese Perspektive: „In fast allen fällen, wo man von einer ‚kürzenden bearbeitung‘ redet, liegt in wirklichkeit nichts als eine niederschrift aus dem gedächtnis vor.“2
Eine Argumentation mit der semioralen Kultur trägt allerdings nur begrenzt zum Verständnis des Phänomens textueller Varianz bei, denn zum einen hat Mündlichkeit keineswegs zwingend Varianz und Unfestigkeit zur Folge,3 zum anderen wird die Erklärung textueller Phänomene damit in den Bereich der Oralität mit den ihr eigenen empirischen Unwägbarkeiten verschoben.4 Abgesehen davon, dass ein Zusammenhang von mündlicher Weitergabe und Textveränderung in der handschriftlichen Überlieferung keineswegs als gesicherter Befund gelten kann,5 wird das Phänomen der textuellen Varianz auf eine pragmatische Dimension reduziert und nicht als genuiner Bestandteil mittelalterlicher Literarizität wahrgenommen.
Zielführender ist ein poetologisches Verständnis der variablen Gestaltung von Texten im Kontext mittelalterlicher Dichtungspraxis. Mittelalterliche Texte sind auf verschiedenen Ebenen Bearbeitungen von Vorgängigem,6 die Verfasser beanspruchten keine Urheberschaft für die von ihnen erzählten Geschichten, sondern bearbeiteten bekannte Stoffe und konkrete Vorlagen, deren Adaption ausdrücklich als genuiner Bestandteil des literarischen Schaffensprozesses herausgestellt wurde. Vor allem im Bereich der großepischen Dichtungen zeigt sich dies in einer dezidierten Betonung der Überliefertheit des Erzählten, wie sie etwa in Quellenverweisen, Beglaubigungsformeln und der expliziten Anknüpfung an die Vorlagen und deren Autoren fassbar ist.7 Obwohl diesen Erzählstrategien häufig Brüche und Ironisierungen inhärent sind, verweist ihre topische Anwendung auf ein literarisches Selbstverständnis, das wesentlich auf einer Orientierung an Autoritäten und einer Verbindlichkeit der Tradition basiert.
In der mittelalterlichen Literarizität wird unterschieden zwischen dem Stoff, der materia, die eine eigene, von dem jeweiligen Verfasser und seinem Text unabhängige Autorität und Gültigkeit besitzt, und dem,
was der Dichter damit macht, dem dichterischen Schaffensprozess und dem dichterischen Werk. Die materia ist grundsätzlich vorgegeben; sie wird dem Dichter vermittelt oder von ihm aufgesucht.8
Entsprechend manifestiert sich die genuine Leistung des Dichters in der konkreten poetischen Gestaltung, der Formgebung seiner materia.9 Worstbrock entwirft ein – ausdrücklich auf den Bereich großepischer Dichtungen bezogenes – Modell des ‚Wiedererzählens‘, dessen Bezugsgröße nicht die besondere Textualität oder Form der Vorlage, sondern der dort verhandelte Stoff ist und verweist beispielhaft auf Galfrieds von VinsaufGalfried von Vinsauf Poetiken, der die Kunst des Dichtens als Arbeit an einer gegebenen materia beschreibt. Hier ist die Stofffindung kein Gegenstand der Reflexion, sondern ausschließlich die als artificium bezeichnete Formgebung des Textes, die allein als „schöpferischer, eigenkünstlerischer Bereich“ des Dichters zu gelten habe.10 Aus dem Verständnis des Dichtens als Formgebung einer festen materia leitet Worstbrock auch eine Inkommensurabilität mit dem Autorbegriff ab, da keine Urheberschaft für den gesamten Text besteht und auch nicht beansprucht wird.11
Lieb problematisiert diese Konzeption des Wiedererzählens zum einen wegen der Unschärfe des materia-Begriffs, zum anderen wegen der dichotomischen Abgrenzung von materia und artificium. In Worstbrocks Verständnis wird das Wiedererzählen zu einer Variationskunst, die sich in der kunstvollen Veränderung einer festen materia erschöpft. Der Stoff und dessen künstlerische Bearbeitung können aber insbesondere in umfangreichen Dichtungen nicht trennscharf auseinanderdividiert werden, so lassen sich z.B. die erheblichen Differenzen zwischen Hartmanns ‚Erec‘Hartmann von Aue›Erec‹ und Chrétiens ‚Erec et Enide‘Chrétien de Troyes›Erec et Enide‹ nicht auf rhetorische Techniken reduzieren.12 Lieb geht vielmehr von einer „wechselseitige[n] Bedingtheit von Materia und Artificium“ aus und fasst das Prinzip des Wiedererzählens als Aktualisierung und Wiederschöpfung der materia, die als eine zu verwirklichende, aber nicht unveränderliche ‚Potenz‘ gedacht werden muss.13 Die divergierenden Positionen zeigen beispielhaft, dass die Bearbeitung bekannter Stoffe und die ausgeprägte Interaktion mit möglichen Prätexten zum einen als konstitutiver Bestandteil der volkssprachigen Literatur berücksichtigt werden müssen,14 dass aber das genaue Verhältnis von Tradition und Innovation, von Autorität und Originalität und von Vorlage und eigener Bearbeitung schwer zu bestimmen ist:
Die Grenzen zwischen Tradition und Innovation verschwimmen oft. Der Schritt vom Nachschreiben einer Vorlage zur Gestaltung von etwas ganz Neuem, der Schritt von der ‚imitatio‘ zur Originalität erweist sich in der Praxis, nicht in der Poetik, als fließender Übergang.15
Die bearbeitende Adaption von Vorgängigem ist in der mittelalterlichen Literarizität aber nicht nur für die Dichtungspraxis bedeutsam. Die durch das Wiedererzählen einer bekannten materia bzw. die Adaption von Vorlagen entstandenen Texte werden auch auf einer zweiten Ebene der Tradierung und Weiterbearbeitung retextualisiert, indem sie durch die Schreiber der Handschriften als reproduzierende Instanzen verändert und variant tradiert werden. Die Manuskriptkultur ermöglichte keine verbindliche Kontrolle über den Text, der in der Überlieferung gekürzt, erweitert, korrigiert oder anderweitig verändert werden konnte. Gegen die Vorstellung einer Regellosigkeit und völligen Absenz von Textfestigkeit in der mittelalterlichen Reproduktionspraxis wurde in verschiedenen Arbeiten aber nachgewiesen, dass auch für mittelalterliche Texte durchaus Autorität beansprucht und Schutz vor Veränderung gefordert wurde.16 Besonders in der lateinischen Schriftlichkeit begegnen immer wieder Autorpersönlichkeiten, die sich intensiv um den Bestand ihrer Texte bemühten.17 Aber auch in der volkssprachigen Überlieferung gibt es zahlreiche Beispiele für Verfasser, die eine Wahrung der von ihnen geschaffenen Texte und den Schutz vor unsachgemäßen und willkürlichen Veränderungen fordern und die sich dabei keineswegs (nur) auf die Inhalte, die materia, sondern auch und gerade auf die Textform beziehen.18 In vielen Texten finden sich Äußerungen, die entweder die Modalitäten von Textveränderungen zu bestimmen suchen oder diese sogar grundsätzlich untersagen. Offenbar standen die Verfasser der Weitergabe ihrer Texte nicht grundsätzlich gleichgültig gegenüber, sondern suchten die „Lizenzen, die den Rezipienten im Umgang mit der konkreten Textgestalt eingeräumt werden“, genauer zu bestimmen.19 Solche Äußerungen zur Textsicherung sind Indizien für ein Bewusstsein und eine kritische Reflexion der Veränderbarkeit von Texten bei den Verfassern, die zum Teil Autorität für die Einheit aus Inhalt und idealer Textgestalt beanspruchten und versuchten, die reproduzierende Textbearbeitung zu ‚kontrollieren‘. Dabei sind Forderungen nach Bewahrung der festen Textgestalt oft in der Normativität der vermittelten Inhalte verankert, denn zumeist sind es geistliche Texte, für die in ihrem Konnex mit der Autorität der Heilserfahrung eine besondere Sorgfalt im Umgang mit der festgelegten Textform verlangt wurde.20 Bei der Gestaltung profaner Texte galt ein anderer Ermächtigungsspielraum für die Bearbeitung und Veränderung, und so stehen den durch die Dignität der geistlichen Inhalte besonders gesicherten Texten Gattungsfelder mit einer größeren Variabilität gegenüber; zu diesen wird neben Lyrik, Chronistik und verschiedenen Bereichen pragmatischer Textualität auch die Kleinepik gezählt.21
Dass der Zugriff auf die Texte offenbar nicht beliebig ist, dass die Veränderungen in Wortbestand und Textstruktur in der reproduzierenden Rezeption oftmals begrenzt bleiben, mag in einer Anerkennung für die Autorität des ‚Werkes‘ bedingt sein. In jedem Fall schließen sich Textsicherung und die Anpassung des Textes an eine spezifische situative Verwendung nicht aus, Varianz bedeutet keine „permanente Bedeutungstransformation“, sondern eine „spezifische und selektive Aktualisierung der Sinnschichten eines Werkes“.22 In der Dialektik von Varianz und Textfestigkeit zeigt sich, dass trotz der prinzipiellen Möglichkeit zur textverändernden Adaption die Vorstellung eines ‚Originaltextes‘ oder ‚Werkes‘ mit festen Sinnstiftungen nicht obsolet ist:
Der mittelalterliche Text ist paradoxerweise immer zugleich Kondensat des einen zugrunde liegenden Werkes – das sich dann auch in allen Fassungen wieder erkennen lässt – und ein in der handschriftlichen Ausgestaltung existentes Unikat, das auf je eigene Sinnbezüge hin geöffnet ist.23