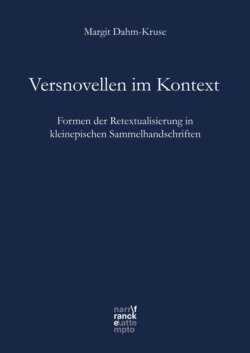Читать книгу Versnovellen im Kontext - Margit Dahm-Kruse - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5.3 Untersuchung
ОглавлениеDie Untersuchung zielt auf eine Darstellung der Interaktion zwischen Mikro- und Makroebene im kleinepischen Sammelschrifttum ab. Am Beispiel des ‚Herzmaere‘ wird das Spektrum der Ausformungen des Einzeltextes in Relation zu den tradierenden Kompilationen analysiert. Die Überlieferungsträger werden zunächst nach fassbaren programmatischen und konzeptuellen Schwerpunkten befragt, die die Prinzipien der Textauswahl und -organisation erhellen und Rückschlüsse auf mögliche Sammlungsinteressen und inhaltliche Konzeptionen ermöglichen. Es wird zum einen gefragt, welcher Art das diskursive Profil der jeweiligen Sammlung ist, in die das ‚Herzmaere‘ integriert wird, welche Wirkung dieses auf die Rezeption der Dichtung hat und wie der Text in die Sammlung inkorporiert wird.1 Zum anderen steht die Frage nach den Korrelationen zwischen der Sammlung und der spezifischen Form des ‚Herzmaere‘ im Fokus, es wird geprüft, ob die Textgestalt durch die jeweilige tradierende Sammlung geprägt sein kann. Die Untersuchung orientiert sich dabei an folgenden Parametern:2
Die Auswahl der enthaltenen Texte: Lassen sich thematische oder motivliche Schwerpunkte fassen, die dem Profil der Sammlung eine bestimmte inhaltliche Prägung geben? Gibt es dominierende Gattungen und Textsorten, die durch die Konzentration auf deren gattungsästhetische Prinzipien Hinweise auf einen bestimmten intendierten Rezeptionsmodus geben? Welchen Umfang und Stellenwert haben insbesondere versnovellistische Dichtungen in den einzelnen Sammlungen?
Die Zusammenstellung der Texte: Gibt es Textfolgen, in denen Einzeltexte miteinander korrespondieren, sich opponierend gegenüberstehen oder anderweitig miteinander in Beziehung treten? Ergeben sich aus solchen sinnstiftenden Textabfolgen diskursive Formationen, die eine thematische Programmatik oder eine dialektische Diskussion von bestimmten Sinnsetzungen gestalten? Gibt es Gruppenbildungen mit thematischen oder texttypologischen Schwerpunkten im Korpus der Sammlung? Wie sind insbesondere die Interferenzen der Versnovellen mit der Sammlungsumgebung zu fassen, welche Funktion kommt diesen innerhalb der einzelnen Textformationen und im gesamten Korpus zu?
Die Textgestalt einzelner Dichtungen: Gibt es Divergenzen im Textbestand einzelner Dichtungen, die signifikant von der Parallelüberlieferung abweichen? Lassen sich aus der spezifischen Textform der Dichtungen besondere semantische Akzentuierungen ableiten und wie fügen diese sich in das Sammlungsprofil ein? Sind bestimmte Muster erkennbar, nach denen einzelne Texte, insbesondere versnovellistische Dichtungen geformt werden?3
Die Textpräsentation: Lässt die äußere Form, das mise en page im Codex, auf spezifische Gestaltungsmerkmale schließen, die Einfluss auf die Texterschließung und damit sinnstiftende Funktionen haben? Ergeben sich aus kodikologischen Faktoren wie der Gestaltung von Textübergängen Hinweise auf Sinneinheiten innerhalb der Sammlung?
Schwerpunkt der Analyse ist der Textbestand und die Einbindung des ‚Herzmaere‘. Der Text wird in den einzelnen Überlieferungsträgern untersucht und hinsichtlich seiner spezifischen Ausgestaltung beschrieben. Ziel der ‚Herzmaere‘-Analyse ist dabei nicht – schon aus Gründen des Umfangs – eine vollumfängliche synoptische Abbildung aller Textbestände, sondern eine Darstellung semantisch belastbarer Varianten mit dem Ziel, spezifische Implikationen und mögliche Intentionen bei der individuellen Ausformung des Textes zu erfassen und auf mögliche Relationen zu den jeweiligen Sammlungen zu befragen. Kleinteilige Varianten etwa in der Lexik oder Metrik werden nur erfasst, wenn sie auffällige Änderungen in der Sinnsetzung nahelegen und/oder dezidierte Rekurrenzen zu der unmittelbaren Textumgebung oder dem Kontext der Sammlung bilden.4 Der philologische Abgleich wird damit immer unmittelbar rückgebunden an eine hermeneutische Betrachtung, die die variante Textgestaltung mit dem Überlieferungsumfeld kontextualisiert.
Es wird weiterhin untersucht, durch welche inhaltlichen Momente und auch visuellen Mittel das ‚Herzmaere‘ in den jeweiligen handschriftlichen Kontext eingefügt wird; dabei steht besonders die unmittelbare Textumgebung im Fokus. Die Textzusammenstellungen werden dahingehend untersucht, ob das ‚Herzmaere‘ Bestandteil bestimmter diskursiver Formationen ist, ob Bezugnahmen und Interferenzen zu den Co-Texten, aber auch zum Sammlungsprofil in seiner Gesamtheit fassbar sind. Zu fragen ist zum einen, wie sich das jeweilige diskursive Profil der Sammlung auf die Semantisierung des ‚Herzmaere‘ auswirkt, wie durch die Textumgebung die textimmanenten Diskurse und Motive jeweils spezifisch akzentuiert und konnotiert werden, zum anderen aber auch, welche Stellung und Bedeutung das ‚Herzmaere‘ in den einzelnen Sammlungen hat, wie es für deren jeweiliges Profil funktionalisiert wird.
Im ersten Teil der Untersuchung wird eine ausführliche Darstellung der Münchner Handschrift Cgm 714München, Bayerische Staatsbibliothek›Cgm 714‹ [m] vorgenommen. Der Sammlung aus dem späten 15. Jahrhundert ist eine prägnante Gestaltung sowohl bei der Form einzelner Texte als auch bei der Zusammenstellung von Texten eigen. Die Handschrift ist auf der Makroebene gekennzeichnet durch eine besondere konzeptionelle Gemachtheit, indem von gezielten Verfahren der Textorganisation und -präsentation Gebrauch gemacht wird, die sich in der Gestaltung verschiedener diskursiver Formationen von Texten manifestieren. Auf der Mikroebene ist eine spezifische Textgestalt vieler Dichtungen augenscheinlich, die signifikant von ihrer Parallelüberlieferung abweichen. Auch das ‚Herzmaere‘ ist im Cgm 714 divergent zu seinen übrigen Überlieferungsträgern gestaltet, wobei die Textform mit der der unmittelbaren Co-Texte korrespondiert, die gemeinsam eine markante und zentrale Textgruppe im Cgm 714 bilden.
Im zweiten Teil erfolgt eine Untersuchung der weiteren Überlieferungsträger des ‚Herzmaere‘ in der Reihenfolge ihrer Entstehungszeit. Die Handschriften zeigen ein breites Spektrum von Sammlungsprofilen und von Textgestaltungen sowie verschiedene Möglichkeiten der Interferenz zwischen den beiden Faktoren auf. Das untersuchte Korpus umfasst die Heidelberger Handschrift Cpg 341 (H),Heidelberg, Universitätsbibliothek›Cpg 341‹ [H]5 den Straßburger Codex A 94Straßburg, ehem. Stadtbibliothek›Cod. A 94‹ [S] (S), den Wiener Codex 2885 (w)Wien, Österreichische Nationalbibliothek›Cod. 2885‹ [w] sowie die mit w nah verwandte Innsbrucker Handschrift FB 32001 (i)Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum›FB 32001‹ [i], die ‚Liedersaalhandschrift‘ Donaueschingen 104 (l)Karlsruhe, Badische Landesbibliothek›Cod. Donaueschingen 104‹ [l] (‚Liedersaalhandschrift‘) und das sogenannte Liederbuch der Clara Hätzlerin/Prag X A 12Prag, Nationalmuseum›Cod. X A 12‹ [p1] (‚Liederbuch der Clara Hätzlerin‘) (p1) mit seinen beiden Parallelüberlieferungen.6 Ergänzend erfolgt auch eine Darstellung der Handschrift Archiv Schloss Schönstein Nr. 7693 (Ko)Schönstein (Wissen), Archiv Schloss Schönstein (Fürsten und Grafen von Hatzfeldt-Wildenburg)›Akte Nr. 7693‹ [Ko] als ältestem Überlieferungsträger des ‚Herzmaere‘, der den Text im Verbund mit Wolframs ‚Willehalm‘ überliefert, sowie eine Skizze der Fragmente des ‚Herzmaere‘ (Nürnberg Hs. 42575 [S1]Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum›Hs. 42575‹; Wien Codex ser. nova 2593Wien, Österreichische Nationalbibliothek›Cod. ser. nova 2593‹ [-]). Zwar erlauben die Fragmente keine Rückschlüsse auf Korrespondenzen mit einer möglichen Überlieferungsgemeinschaft; da die Arbeit aber Vollständigkeit in der Darstellung der Überlieferung des Referenztextes anstrebt, werden auch diese Handschriften in die Betrachtung einbezogen.
Für den Abgleich der Textbestände wird kein ‚normaler‘ Text als festes Vergleichsraster herangezogen. Keiner der vorhandenen Überlieferungsträger kann durchgängig als Leithandschrift fungieren, da alle Handschriften eigene Spezifika aufweisen. Auch wenn Überlegungen zu Textveränderungen und spezifischen Textformen immer eine Zeitlichkeit und Genese von Überlieferungsträgern implizieren, werden die verschiedenen Redaktionen des ‚Herzmaere‘ ausdrücklich nicht in einer bestimmten Historie gedacht, sondern in einem synchronen Nebeneinander betrachtet. Noch weniger sinnvoll ist ein Abgleich mit dem edierten Textbestand, der eine idealisierte Rekonstruktion aus verschiedenen Handschriften darstellt. Die Merkmale der einzelnen Redaktionen müssen letztlich immer in Bezug zur Gesamtheit der Überlieferungsträger gesetzt werden; nur so lässt sich ermitteln, ob bestimmte Varianten unikal sind und ob diese aus einer spezifischen Gestaltungsintention resultieren können. Sofern bei der Darstellung bestimmter Varianten eines Textträgers die kontrastierende Gegenüberstellung mit dem Textbestand der übrigen Überlieferung erfolgt, wird – wenn möglich – die Heidelberger Handschrift (H) für die vergleichende Zitation verwendet, auf die übrigen Handschriften wird ergänzend hingewiesen. Zwar stellt Ko einen wohl älteren Textzeugen dar, überliefert aber die kürzeste Redaktion des ‚Herzmaere‘, in der unter anderem der Prolog nicht aufgeführt wird. Des Weiteren unterscheidet sich Ko durch die mittelrheinische Schreibsprache im Sprachstand signifikant von den übrigen, überwiegend bairischen und alemannischen Überlieferungsträgern und ist deshalb für einen Textabgleich weniger geeignet. Wo H nicht als Vergleichshandschrift verwendet werden kann, wird S als nächstälteste Überlieferung herangezogen.
Im Anschluss an jedes Sammlungskapitel wird ein Verzeichnis der inserierten Texte mit den gängigen neuhochdeutschen und den in den jeweiligen Handschriften aufgeführten mittelhochdeutschen Titulaturen aufgeführt, in dem auch die diskutierten Gliederungsabschnitte oder Textgruppen innerhalb der Sammlungen gekennzeichnet sind.