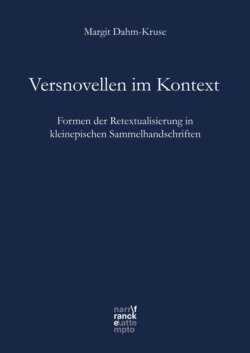Читать книгу Versnovellen im Kontext - Margit Dahm-Kruse - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.2 Lektüre im Kontext
ОглавлениеUnabhängig von der Frage nach intentionalen Textarrangements – die kleinepischen Sammlungen als „historisch bezeugte Textensembles“ stellen die konkrete Form dar, in der die Texte tatsächlich zugänglich waren.1 Der Zugriff auf die kleine Reimpaardichtung erfolgte in der Regel nicht nach autor- oder gattungsspezifischen Gesichtspunkten, die die modernen Editionen kennzeichnen, sondern war durch die disparaten Kompilationen geprägt.2 Dabei muss die Lektüre in den zumeist registerlosen Kompilationen keinesfalls nur in einer gezielten Auswahl einzelner Texte stattgefunden haben; es ist naheliegend, dass diese auch sukzessive und in größeren Einheiten erfolgte, durch die das sinnstiftende Potential der Textarrangements in die Rezeption einbezogen wurde:
My approach assumes that poems were read or recited in series, since only in that way could the constellations, types, dyads, and other codicological features be perceived by the user of the manuscript.3
Die Rezeption im Sammlungszusammenhang bedingt eine Doppellektüre, indem die Objekte sowohl in ihrer Einzelpräsenz als auch im Zusammenhang der Kompilation erscheinen.4 Die Sammelhandschrift stellt textontologisch zunächst die gemeinsame Verschriftlichung der enthaltenen Texte dar, rezeptionsästhetisch geht sie aber über eine additive Aufreihung von Einzeltexten hinaus, indem sie den unmittelbaren – und im Gegensatz zu empirisch schwer konkretisierbaren Sachverhalten wie der performativen Inszenierung von Texten auch konkret greifbaren – Kontext für die Rezeption des einzelnen Textes, für die jeweilige Aktualisierung seiner Sinnpotentiale darstellt.5
Jede Sammlung gestaltet durch die Auswahl und das Arrangement der Texte ein spezifisches diskursives Profil, das Einfluss auf die Lektüre der enthaltenen Texte hat. Das Profil einer Sammlung wird zunächst bestimmt durch die thematischen und diskursiven Schwerpunkte, die durch die Auswahl der Texte gesetzt werden, und durch die Art und Weise, in der die enthaltenen Texte auf die verhandelten Diskurse rekurrieren.6 Bereits eine Schwerpunktsetzung hinsichtlich der Texttypik bedingt eine Profilbildung, die den Rezeptionsmodus des einzelnen Textes spezifisch pointiert; so liest sich der gleiche Erzähltext in einer überwiegend schwankhaften Kompilation anders als in einer Zusammenstellung von geistlichen oder moralisierenden Texten. Weiterhin ist das Arrangement der Texte, die Kombination und Abfolge der durch sie eingebrachten Sinnsetzungen bestimmend für das Sammlungsprofil. Um die Konzeptionen, die spezifischen Profile der kleinepischen Kompilationen zu erschließen, müssen diese nach möglichen Prinzipien der Auswahl und Anordnung der Texte und den daraus resultierenden Sinnstiftungen befragt werden.7 Dabei kann eine Textzusammenstellung in ihren Sinnangeboten tendenziell gleichgerichtet sein und möglicherweise ein übergeordnetes Anliegen verfolgen, das die Auswahl der Texte bestimmt.8 Ebenso können die Texte ein thematisches Feld aus unterschiedlichen Perspektiven abschreiten, wodurch bestimmte epistemologische Postulate einzelner Texte durch andere Perspektiven konterkariert bzw. die Texte in ihren widersprüchlichen Normaussagen kasuistisch organisiert werden.
Die Analyse der Überlieferungssymbiosen ermöglicht auch Rückschlüsse auf das Verständnis der einzelnen Texte, indem sie aufzeigt, zu welchen Wissensbereichen und literarischen Diskursen diese in Bezug gesetzt wurden:
In jeder der jeweils neu zusammengestellten spätmittelalterlichen Textsammlungen entstehen neue Bedeutungen des Einzeltexts, was es erst eigentlich ermöglicht, das kulturelle Selbstverständnis des Kompilators oder Auftraggebers einer Handschrift […] zu verstehen.9
Die Textzusammenstellungen der Sammelhandschriften stellen damit Sinnbildungspraktiken dar, die individuelle Erzählzusammenhänge schaffen und den Einzeltext spezifisch akzentuieren. Ausgehend von der hermeneutischen Prämisse, dass der Rezipient bei einer Zusammenstellung verschiedener Texte, ob bewusst oder unbewusst, Relationen zwischen den einzelnen Texten herstellt, indem er nach semantischen Verknüpfungen, nach gemeinsamen Mustern, Subtexten oder nach übergeordneten Konzeptionen sucht, ist die Sammlungsumgebung von Bedeutung für den Sinnhorizont des Einzeltextes, weil sie vielfältige Formen intertextueller Bezugnahmen prägt. Auf der Ebene des Einzeltextes wird Intertextualität zumeist verstanden als
Oberbegriff für jene Verfahren eines mehr oder weniger bewußten und im Text selbst auch in irgendeiner Weise konkret greifbaren Bezugs auf einzelne Prätexte, Gruppen von Prätexten oder diesen zugrundeliegende Codes und Sinnsysteme.10
Für die Sinnkonstitution in der Sammlung ist Intertextualität aber nicht nur als Element der poetischen Gestaltung des einzelnen Textes bedeutsam, der auf einen Prätext Bezug nimmt; auch die Korrespondenz von Texten innerhalb der Sammlung ist eine Form der Intertextualität: Zwischen unterschiedlichen Texten können intertextuelle Relationen bestehen, indem diese sich mit gemeinsamen Gegenständen und Themen befassen. Schon die Korrespondenz von Texten, die gleiche Motive aufführen, wie sie in dem prägenden Kompilationsprinzip der Gestaltung korrespondierender Textpaare in Erscheinung tritt, stellt eine Form der intertextuellen Relation dar, ohne dass diese in besonderem Maße sinnstiftend sein muss. Durch das Textarrangement können aber auch Relationen von semantischer Relevanz gestaltet werden, indem die Sammlung Texte zusammenführt, die die gleichen Diskurse und literarischen Traditionen aufgreifen. Die Relationen zwischen den Texten können dabei durch unterschiedliche semantische Korrelationen geprägt sein, indem die Texte sowohl durch gleichgerichtete als auch durch konträre Bezugnahmen auf die gleichen Aspekte interagieren.
Häufig sind in den Sammlungen unterschiedlich umfangreiche Einheiten aufeinander folgender Texte fassbar, die in ihren wechselseitigen Bezugnahmen besonders eng verknüpft sind. In der Sukzession dieser Texte entsteht ein gemeinsamer Aussagezusammenhang, ein gemeinsames Sinnpotential, das sich wesentlich aus dem Zusammenspiel der Texte konstituiert. Solche Einheiten können als ‚diskursive Formationen‘ innerhalb des Gesamtgefüges der Sammlungen verstanden werden.11 Diese sind nicht unabhängig oder strikt abgegrenzt vom übrigen Korpus, markieren aber in sich geschlossene Gruppen mit deutlich aufeinander bezogenen inhaltlichen Relationen.
Indem die Sammlung nicht nur als additive Reihung von Texten betrachtet wird, sondern als Gefüge, in dem die Beziehungen der einzelnen Texte zueinander und zur Sammlung in ihrer Gesamtheit betrachtet werden, wird auf grundlegende Prämissen einer strukturalistischen Textbetrachtung rekurriert. Der Strukturalismus teilt mit dem Formalismus die Betonung des Systemcharakters von Texten, indem zum einen die Frage nach der Funktion der einzelnen Elemente des Textes im Vordergrund steht,12 zum anderen das einzelne Element hinsichtlich seiner Relationen zu den anderen Elementen und zum Gesamtsystem analysiert wird.13 Das strukturale Modell als Operationsverfahren ist nicht auf eine semiotische Analyse beschränkt, sondern erlaubt es, auch „von anderen Klassen von Phänomenen als Zeichensystemen zu sprechen.“14 Der Struktur- und Systembegriff kann auf Textsammlungen appliziert werden, um die wechselseitigen Korrelationen von Einzeltexten und der Sammlung in ihrer Gesamtheit zu beschreiben. So wird die Sammlung als Ganzes durch die Auswahl und das Arrangement der Einzeltexte mit ihren individuellen Sinnstiftungen geprägt:
Die Individualität der Gesamtstruktur basiert jedenfalls auf der spezifischen Selektion aus der Gesamtmenge der möglichen Elemente und Relationen und deren spezifischen Kombinationen im ‚Text‘.15
Gleichzeitig stellt die Sammlung einen übergeordneten Kontext dar, der den Einzeltext dynamisiert und dessen sinnstiftende Potentiale unterschiedlich ausspielen kann. Analog zum einzelnen Lexem, das für sich keine vollständig festgelegte Bedeutung besitzt, sondern diese erst durch seine Stellung und Funktion im jeweiligen lexikalischen Kontext erhält, in dem es verwendet wird,16 erschließt sich die Bedeutung des Einzeltextes auch aus dem kommunikativen Zusammenhang der Sammlung.
Entgegen den strukturalistischen Prämissen einer grundsätzlichen Systemabhängigkeit des einzelnen Elementes sowie einer prinzipiellen Interdependenz der Elemente untereinander kann allerdings kein grundsätzlicher logischer Vorrang der Sammlung gegenüber dem einzelnen Text postuliert werden.17 Die Sammlung überschreibt nicht die prinzipielle Eigenständigkeit und hermeneutische Erschließbarkeit der einzelnen inkorporierten Texte. Dennoch ist die Relation des Textes zu den übrigen Bestandteilen des diskursiven Gefüges der Sammlung, die Position und Funktion, die er in einem Netz von intertextuellen Beziehungen einnimmt, von Bedeutung für die Rezeption.
Für die Versnovellistik hat die Frage der Auswahl und Anordnung von Dichtungen schon aufgrund der Kürze der Texte Relevanz, indem kurze Texte in ihren Sinnpotentialen ungleich stärker durch den Sammlungskontext bestimmbar und pointierbar sind als großepische Dichtungen. Zum Vergleich sei erneut auf die Tradition der Exempla verwiesen: Das Exemplum in seiner ursprünglichen Funktionalisierung für eine ‚übergeordnete‘ Argumentation, etwa die der Predigt, ist eine kontextabhängige Textform, die der Sinnsetzung durch den funktionalen Kontext bedarf:
[Das Exemplum] wird nicht wegen irgendeines in ihm selbst liegenden, denotativ unzweideutigen Inhalts und schon gar nicht um der historischen Information willen aufgeführt, sondern stets funktional und situativ, als ein nur aus seinen Konnotationen verständliches Beweismittel.18
In den auf moraltheologische Belehrung ausgerichteten Exempelsammlungen sind die Texte in ihrer narrativen Funktionalisierung klarer fassbar; im Unterschied zu den versnovellistischen Kompilationen werden diese auch homogener zusammengestellt und programmatisch geordnet.19 Offenbar eignen sich diejenigen Typen der kleinen Reimpaardichtung, die vorrangig lehrhaften Prinzipien verpflichtet sind, besser für eine generisch kohärente Überlieferung, in der sich ihre didaktischen Implikationen summieren können. Die Exempelsammlungen erscheinen zumeist als Kataloge von Lastern und Tugenden, teilweise sind sie nach übergeordneten Konzeptionen geordnet, z.B. dem Dekalog (‚Der große Seelentrost‘›Der große Seelentrost‹)‘, der Heilsgeschichte (‚Der Seelenwurzgarten›Der Seelenwurzgarten‹‘) oder Leitthemen wie Buße oder Nächstenliebe (‚Gesta Romanorum‘›Gesta Romanorum‹). Aber auch in diesen vergleichsweise stringenten Sammlungstypen gehen nicht alle Texte homogen in der übergeordneten Konzeptionen auf.20 Häufig sind Spannungen zwischen dem Eigengewicht des Einzelexempels und der Sammlung fassbar, indem sich die Lehre der Sammlung und die Aussagen der einzelnen Texte widersprechen können. Die Sammlung in ihrer Gesamtheit kann die im Einzeltext formulierte Geltungsaussage damit relativieren.21
Damit sind bereits in den einer dezidierten Lehrhaftigkeit verpflichteten Exempelsammlungen Prinzipien fassbar, die sich als prägendes Moment in den untersuchten Kompilationen mit versnovellistischen Texten erweisen: Die Sammlung beeinflusst die Sinnstiftung der einzelnen Dichtungen, dabei steht die Gesamtaussage der Sammlung in divergenten Wechselwirkungen mit den Einzeltexten, die auch Spannungen und Widersprüche bedingen können. Während die einheitlichere Konzeption und das dominante lehrhafte Moment der Exempelsammlungen mögliche Widersprüche auf der Ebene des Einzeltextes oft relativieren,22 treten diese in den heterogenen kleinepischen Sammlungsverbünden zumeist ohne eine homogenisierende Vermittlung in Erscheinung. Im Kontext der Sammlung kann die Pluralität durch die „Öffnung der Sinnstiftung auf einen Kontext hin“ ausgeglichen werden,23 genauso kann sie aber in ihrer Pluralität und Widersprüchlichkeit akzentuiert werden.
Die Versnovellen können nicht wie die Exempla als Persuasionsmittel für ein übergeordnetes Anliegen gefasst werden, dennoch ist auch ihnen eine besondere Korrelation mit externen Sinnsetzungen implizit. Die Texte sind durch ihre ambigen Sinnpotentiale in besonderem Maße offen für eine Semantisierung durch andere Texte und für deutungsrelevante intertextuelle Relationen. Die Adaption etablierter Diskurse bei gleichzeitig offenen Sinnstiftungen macht die Versnovellen zu einer Textsorte mit besonderen „Möglichkeiten der literarischen Anschlusskommunikation“.24 Dabei sind die Versnovellen nicht nur anschlussfähig für die Kombination mit Texten aus dem gleichen narrativen Umfeld, ihre intertextuelle Anschlussfähigkeit erstreckt sich auch auf andere Textsorten und deren jeweilige Diskursstrukturen.
Darin mag ein Grund für das Fehlen homogener versnovellistischer Sammlungen liegen. Die versnovellistischen Dichtungen mit ihrer Poetik der Transgression sind zwar auf die Kombination mit anderen Texten, aber nicht zwingend auf eine Anordnung in geschlossenen thematischen oder generischen Strukturen ausgerichtet. Die Zusammenstellung vieler Sammlungen legt den Schluss nahe, dass versnovellistische Texte, einzeln oder in kleinen Gruppen, in andere Textstrukturen eingespeist werden, um deren Perspektiven zu konterkarieren oder zu ergänzen. Mit ihrem ausgeprägten Potential für eine subversive und relativierende Bezugnahme auf etablierte Sinnsetzungen können sie genutzt werden, um die Variabilität von Geltung auf ihre Textumgebung zu übertragen.25 Die Bedeutungsmuster von Texten, die zum Beispiel moralisch-exemplarische oder religiöse Sinnsetzungen vorstellen, können durch die Kombination mit versnovellistischen Erzählungen unterlaufen und in eine kontingente Perspektive überführt werden.
Die Sammlung als diskursives Gefüge von Texten bedingt eine Dynamik der Rezeption, indem ihre enthaltenen Elemente auf unterschiedliche Weise in Beziehung zueinander gesetzt werden können. Es gibt divergente Möglichkeiten der Rezeption, die auch durch die Art der Lektüre beeinflusst wird, die sukzessive, in variablen Gruppen oder in der Einzellektüre von Texten erfolgen kann. Dass sich die unterschiedlichen Bestandteile der Sammlung nicht ohne weiteres in einer kohärenten übergeordneten Thematik zusammenfassen und hierarchisch ordnen lassen, stellt gerade das genuine diskursive Profil der meisten kleinepischen Sammlungen dar, bei denen es eben nicht darum geht, die Einzelelemente „zu einer ‚Gesamtaussage‘ des Sammlungs-Textes zu synthetisieren, sondern spezifische Muster der Konfrontation und Interaktion diskursiver Positionen im kotextuellen Gefüge zu beschreiben“.26 Kleinepische Sammelhandschriften sind weniger als lineare Textreihen mit kohärenter Sinnstruktur konzipiert, sondern als diskursive Zusammenstellungen, die die inkorporierten Texte in einem Netz komplexer, auch sprunghafter und widersprüchlicher Bezugnahmen zusammenführen und in denen Sinnbezüge auf unterschiedlichen Ebenen gestaltet werden können.
Mit den kleinepischen Kompilationen bildet sich ein Sammlungstyp heraus, der literarische Traditionen und kulturelles Wissen bearbeitet. Durch die Kombination von Texten mit divergenten Sinnansprüchen können sie zunächst eine Relativierung von etablierten Geltungskonzepten und tradierten Wissensbeständen erzeugen. Gleichzeitig werden Wissen, Traditionen und Sinnsetzungen aber auch in neue Zusammenhänge überführt, es werden Beziehungen zwischen unterschiedlichen und widerstreitenden Normen hergestellt, so dass die Sammlung auch neue Wissensformen gestaltet. Die Sammlungen konstituieren damit eine Poetik, die auf der Perspektivierung des Divergenten basiert und die erst in dem Zusammenspiel der enthaltenen Texte zum Tragen kommt. In jedem Fall erweist sich die über die Sammlung entwickelte Lektüre als weitaus vielschichtiger, indem der Verbund von Texten auf Konzeptionen verweist, die der Einzeltext nicht zeigt. Die Sammlungen sind „intelligent, komplex, variabel und bisweilen sogar gegen die Ursprungsintention von Einzeltexten durchkonstruierte Werkkomplexe eigenen Typs“, bei denen „nicht selten völlig neue Werkeinheiten mit neuen Autor-, Auftraggeber-, Rezeptions-, Wirk- und Nutzungsszenarien“ entstehen.27