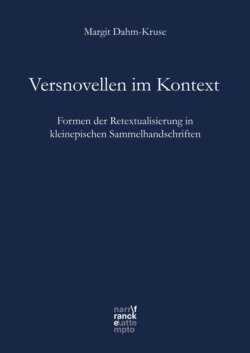Читать книгу Versnovellen im Kontext - Margit Dahm-Kruse - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 Das ‚Herzmaere‘: Text und Untersuchung 5.1 Konrads von Würzburg ‚HerzmaereKonrad von Würzburg›Das Herzmaere‹‘: Text und Rezeption
ОглавлениеDas Motiv des gegessenen Herzens, das Konrad von Würzburg im 13. Jahrhundert zum Inhalt seiner Versnovelle macht, ist in einer umfangreichen und lang anhaltenden europäischen Erzähltradition verortet. Das früheste, allerdings indirekte literarische Zeugnis findet sich im ‚Tristan‘ des Thomas von BretagneThomas von Bretagne›Tristan‹, der Iseut ein Lied verfassen lässt, aus dem sich auf einen altfranzösischen Lai schließen lässt, der bereits die Grundstruktur des Stoffes wiedergibt: Im Zentrum steht immer die Liebe eines Mannes zu einer verheirateten Frau, die durch den Tod des Liebenden beendet wird. Es folgt die Herzentnahme aus dem Körper des Geliebten, welches der Ehemann in einem Akt der Rache seiner Ehefrau als Speise vorsetzt. Die Frau verzehrt unwissend das Herz, wird über das Gericht aufgeklärt und stirbt daraufhin ebenfalls.1
Dieses Modell liegt allen Literarisierungen der Geschichte vom gegessenen Herzen zugrunde, wobei das Motiv dabei zumeist im Kontext von Rache für begangenen Ehebruch steht. So auch in den ersten direkten Zeugnissen des Stoffes in der höfischen Literatur, die fassbar sind mit den vidas des katalanischen Sängers Guillem de CabestanhGuillem de Cabestanh als einem der bekanntesten Trobadors, dessen Lebensbeschreibung mit dem Stoff des gegessenen Herzens verbunden wird. Sieben um 1240 entstandene vidas erzählen von der Liebe Guillems zur Ehefrau Raimons de Castell-Roussilon, welcher den Nebenbuhler tötet.2 Zur Steigerung seiner Rache lässt Raimon seine Frau das Herz des Geliebten essen und klärt sie anschließend über das Gericht auf. Diese verkündet, nach dieser Speise nie mehr etwas anderes essen zu wollen und tötet sich selbst durch einen Sturz von einem Balkon. Für den anthropophagischen Akt und das unmäßige Rachehandeln erfolgt in den vidas zumeist eine Bestrafung des Ehemannes durch die Gesellschaft und/oder die Familie der Frau, ebenso ist häufig die ehrenvolle Beisetzung und eine Sakralisierung der Liebenden Teil der Geschichte.3
Aus diesem Stoff gestaltet Boccaccio eine Novelle des ‚DecameronBoccaccio, Giovanni›Das Decameron‹‘, die als berühmtester Vertreter der Geschichte vom gegessenen Herzen gelten kann.4 Der Ritter Guiglielmo Guardastagno liebt die Frau seines Freundes Guiglielmo Rossiglione und wird von diesem in einen Hinterhalt gelockt und mit einer Lanze erstochen. Auch hier sucht die Frau, nachdem sie unwissentlich das Herz des Geliebten gegessen hat, den Freitod.5 In einer weiteren Erzählung des ‚Decameron‘ wird das Motiv in anderer Personenkonstellation gestaltet, indem Tancredi, Fürst von Salerno, den Liebhaber seiner Tochter Ghismonda tötet und ihr dessen Herz in einem Pokal überreicht, worauf sie das Herz mit Gift übergießt und dieses trinkt.6 Das Herz ist in diesen Ausformungen des Stoffes stets das Objekt von Rache und Hohn, mit der Degradierung zur Speise soll die vollkommene Vernichtung des Rivalen erfolgen, wobei dem Verzehr des Herzens aber auch das Moment einer unio der Liebenden inhärent ist:
Mit der Reduktion des Liebhabers zur Speise und seiner vollkommenen, auch symbolischen Vernichtung bekräftigt der Gatte zwar zum einen die Auslöschung seines Rivalen […]. Aber auf der anderen Seite führt der Ehemann mit dieser Bestrafung zugleich eine Verbindung der beiden außerehelich Liebenden herbei, wie sie vollkommener und absoluter nicht sein könnte und die nicht zuletzt durch die Assoziation mit christlichen Inkorporationsmotiven eine transzendente Dimension erhält.7
Das ‚Herzmaere‘ Konrads von Würzburg bildet zusammen mit dem im späten 13. Jahrhundert entstandenen ‚Roman du castelain de Couci‘ des nordfranzösischen Dichters JakemésJakemés de Sakesap›Roman du castelain de Couci‹ einen eigenen Stoffstrang.8 Hier findet der Geliebte nicht durch die Hand des Ehemannes, sondern auf einer Jerusalemfahrt den Tod und lässt der Geliebten sein Herz als Zeichen ewiger Liebe und Treue übersenden. In dieser Tradition ist nicht das Rachehandeln zentrales Motiv der Erzählung, sondern die Liebesgeschichte selbst steht im Fokus der Darstellung. Das Herz ist nicht mehr allein Objekt der Rache des betrogenen Ehemannes, sondern wird durch den Geliebten selber zum Liebeszeichen bestimmt. Konrads wohl früher entstandenes ‚Herzmaere‘ betont das Moment der exzeptionellen Liebe noch stärker,9 indem ganz auf die Ausführung expliziter Gewalt verzichtet wird. Denn während der Geliebte bei Jakemés an einer im Kreuzzug empfangenen Verwundung stirbt, lässt Konrad die Protagonisten einen emphatisch ausgestalteten wechselseitigen Liebestod sterben. So reist der Ritter im ‚Herzmaere‘ auf den Wunsch der Dame nach Jerusalem, um durch die zeitweilige Trennung den Argwohn des eifersüchtigen Ehemannes zu zerstreuen und findet dort einen märtyrergleich gestalteten Tod, der allein durch den übergroßen Sehnsuchtschmerz bewirkt wird. Im Sterben begriffen, befiehlt er seinem Knappen, ihm posthum das Herz zu entnehmen und dieses, zusammen mit einem Ring, der Geliebten zu überbringen. Das Vorhaben wird allerdings unterlaufen, denn der Ehemann fängt den Knappen ab und nimmt das mitgeführte Herz an sich, in dem er sofort das Liebeszeichen erkannt und daraus auch auf den Liebestod des Ritters schließt. Er befiehlt seinem Koch, aus dem Herz ein köstliches Gericht zu bereiten, das er seiner Ehefrau vorsetzt. Als diese das Herz des Geliebten gegessen hat, setzt er sie über seine perfide Handlung in Kenntnis. Die Dame findet daraufhin den Tod nicht durch Suizid, sondern die Wahrheit über die gegessene Speise und das Wissen um den Tod des Geliebten lassen sie in einem passionsgleich anmutenden Nachvollzug des männlichen Selbstopfers sterben: Als der Ehemann ihr eröffnet, was sie verzehrt hat, vergegenwärtigt sie sich die absolute Liebe des Ritters und gedenkt der Leiden, die er um ihretwillen auf sich genommen hat. Sie beschließt, nicht mehr leben zu können, woraufhin ihr im wahrsten Sinne des Wortes das Herz im Leibe bricht. Die Rache bleibt im ‚Herzmaere‘ zwar als „grausame Pointe“ der Geschichte erhalten,10 denn auch hier ermöglicht erst die Handlung des Ehemannes eine posthume Einheit der Liebenden durch das Moment des wechselseitigen Liebestodes, aber das Rachehandeln tritt durch die herausgestellte wechselseitige Treue und Liebesverbundenheit der Protagonisten in den Hintergrund.
Entsprechend ist die Rezeption des ‚Herzmaere‘ wesentlich durch die Semantiken absoluter Liebe und höfischer Minnekasuistik bestimmt, die das ‚Herzmaere‘ und weitere Vertreter der „höfisch stilisierten Kurzerzählungen über Bedingungen und Erscheinungsformen unbedingter Liebe“ in den literarischen Diskurs einbringen.11 Die exzeptionelle Darstellung passionierter Liebe und die Auseinandersetzung mit ihrem Geltungsanspruch im ‚Herzmaere‘ wird dabei kaum ohne den Kontext von Gottfrieds ‚TristanGottfried von Straßburg›Tristan‹‘ gelesen als „dem ersten Text des Mittelalters, ja vielleicht des Abendlandes, der die Idee einer tragischen, romantischen Liebe bis in seine interne Semantik hinein voll ergreift.“12 Die Gottfried-Referenz im ‚Herzmaere‘ wird zum einen explizit durch die Ovation an dessen Meisterschaft im Prolog aufgerufen; in fast allen handschriftlichen Überlieferungen findet sich ein Verweis auf Gottfrieds Dichtung: des bringet uns gewisheit/ von Strâzburg meister Gotfrid (V. 9f.).13 Die Einschreibung in die Tradition Gottfrieds hat damit in der Überlieferung des ‚Herzmaere‘ größeres Gewicht für die Beglaubigung des Textes als die Verfasserschaft Konrads, auf den überhaupt nur in drei der erhaltenen Überlieferungsträger verwiesen wird.14 Zum anderen referiert das ‚Herzmaere‘ aber auch implizit durch die Thematisierung einer absoluten, aber nicht legitimen Liebe auf die Dreieckskonstellation im ‚Tristan‘.
Die Interferenzen zwischen ‚Herzmaere‘ und ‚Tristan‘ bestehen dabei nicht nur in einer allgemeinen thematischen Inspiration,15 sondern sind auch in konkreten inhaltlichen Bezugnahmen fassbar. Zentrale Elemente der Liebesdarstellung wie die exzeptionelle triuwe, die Auserwähltheit der edelen herzen und die prononciert herausgestellte Liebe-Leid Dichotomie finden sich im ‚Herzmaere‘ ebenso wie das handlungsmotivierende Moment der huote, die die Liebenden an der Erfüllung ihrer Wünsche hindert. Das ‚Herzmaere‘ gestaltet weiterhin, neben lexematischen Kongruenzen wie der lûterlichen minne (V. 2+587) und den edelen herzen (V. 588), einige Passagen parallel zum ‚Tristan‘, etwa die Abschiedsszene der Liebenden mit der Übergabe des Ringes (HM: V. 181–189; T: V. 18307–18319).16
Eine deutliche Analogie stellt aber vor allem die mit der Instanz Gottfrieds verbundene Berufung auf die exemplarische Funktion und didaktische Fähigkeit der Literatur dar. Das ‚Herzmaere‘ will nicht nur von echter Liebe ein bilde schouwen (V. 4ff.), sondern das literarische Vorbild soll auch die Fähigkeit zur Minne erhöhen:
diu rede ist âne lougen:
er minnet iemer deste baz
swer von minne etewaz
hoeret singen oder lesen (V. 18–21).
Der Text greift damit unmittelbar die aus dem ‚Tristan‘ vertraute Programmatik der Besserung in der Liebe durch literarische Beispiele auf (T:V. 167–186). Das ‚Herzmaere‘ verarbeitet prototypische Elemente der lateinischen Prolog-Tradition, indem eine sentenzartige Entrüstung über den gegenwärtigen Zustand der Welt mit einem Appell an die Zuhörer verbunden wird.17 Die erzählte Geschichte wird als produktives Beispiel und Beitrag zur Besserung angekündigt, die nicht über den konkreten Nachvollzug, sondern durch die Betrachtung der musterhaften Liebe als bilde erzeugt werden soll.
Diese Funktion der Erzählung wird im Epilog des ‚Herzmaere‘ erneut aufgerufen, der das drastische Geschehen zu einem exemplarischen Minnekasus stilisiert. Im Epilog wird die Lauterkeit und Vorbildlichkeit der dargestellten Minne herausgestellt und, im topischen Modus der laudatio temporis acti, mit einer Klage über die Geringschätzung der Liebe in der gegenwärtigen Zeit verbunden, in der Liebende keinen Schmerz oder gar den Tod füreinander leiden würden und in der die Liebe wohlfeil, für jedermann käuflich geworden sei (V. 534–588). Im ‚Herzmaere‘ wird das Leid als Gradmesser der Liebe verabsolutiert und die Bereitschaft zum Liebestod zum Inbegriff der wahren, lûterlichiu minne stilisiert. Das Leid der Liebenden bestätigt die Intensität ihrer Liebe und behauptet deren Eigenrechtlichkeit gegen die Rechtsordnung der Ehe.18 Nicht nur in der akzentuierten Liebe-Leid-Programmatik besteht eine erneute Anknüpfung an die Gottfriedschen Liebessemantiken, mit dem abschließenden Appell an die edelen herzen (V. 588) knüpft der Epilog auch an den transzendenten Ausblick des ‚Tristan‘ an, der ein Weiterleben der Liebenden in der literarischen Vergegenwärtigung durch die aufgerufene ideale Publikumsgemeinschaft der edelen herzen verheißt.19
Prolog und Epilog konstituieren wesentlich den exemplarischen Gestus, der dem ‚Herzmaere‘ inhärent ist, erst durch die Behauptung der Vorbildlichkeit in Pro- und Epilog erhält die erzählte Geschichte ausdrücklich diesen Sinngehalt. Die Rezeption des ‚Herzmaere‘, insbesondere hinsichtlich seiner exemplarischen Deutung, basiert in der germanistischen Forschung wesentlich auf dem plausiblen Zusammenspiel von Pro- und Epilog:
Der Schlußabschnitt in der Schröder-Wolffschen Ausgabe unterstreicht nachträglich noch einmal die Aussagen der Einleitung, indem am Anfang vorgetragene Gedanken, wie die Vorbildlichkeit der Liebenden und die Klage über die schwindende Bedeutung der Minne, die sich wiederum – wenn auch nicht expressis verbis – an Gottfried von Strassburg anlehnt, wiederkehren. […] wenn man die einleitend geäußerte Absicht des Autors nicht als bloße Floskel abtut, scheint es wichtig, dass nach der erzählten Geschichte, die von Deutung und Paränese nicht durchsetzt ist, noch einmal der exemplarische Charakter des Ganzen in Erinnerung gebracht wird.20
Das normative Moment ist integraler Bestandteil der Rezeption des ‚Herzmaere‘,21 das gelegentlich sogar im Kontext einer autoritative Wertvermittlung gelesen wird, die die „absolute allumfassende Geltung der Norm“ beweisen und zur „Erbauung“ der Gesellschaft führen22 bzw. dem adligen Publikum eine neue Qualität höfischer Ideale vermitteln soll.23
Eine so einsinnig didaktisierende Intention oder Funktion kann man dem ‚Herzmaere‘ nicht zusprechen, das sich hinsichtlich normativer Geltungsaussagen eindeutiger Sinnstiftung entzieht. Das ‚Herzmaere‘ vermittelt keine kohärente Rezeption, die Forschung verweist bereits in der Einzelrezeption auf das ambige Potential des Textes, der weniger eine konsistente Deutung als vielmehr Mehrdeutigkeit der Diskurse vermittelt.24 Im ‚Herzmaere‘ manifestiert sich die die Versnovellistik kennzeichnende Poetik des Einspielens und Zusammenfügens verschiedener Erzählmuster und Diskurse mit je eigenen Traditionen und Logiken, deren Sinnsetzungen und normative Ansprüche miteinander konfligieren können.25 Dem Skandalon der außerehelichen Liebe, die nur aufgrund der sorgsamen huote des Ehemannes nicht verwirklicht wird, steht die herausragende triuwe der Liebenden als das zentrale ethische Moment jedweder Liebeskonzeption gegenüber; die Liebesdarstellung changiert zwischen der ausgestellten Idealität der Liebe und ihrer Ausweglosigkeit. Der Text spielt die Semantiken des Minnedienstes ein, indem der Ritter in seiner Dienstbereitschaft und Unterwerfung unter den Willen der Dame und durch sein ausgestelltes Minneleid konform ist mit dem durch die Tradition des Minnesangs etablierten normativen „Verhaltensprogramm in der weltlichen Liebe.“26 Aber die der ehebrecherischen Liebeskonstellation inhärente Problematik kann darüber nicht vollständig aufgelöst werden, zumal die Liebenden nicht nach legitimer Verbindung, sondern nach Vollzug des Ehebruchs streben.
Dem eingespielten Schema des Minnedienstes ist ein Anspruch auf Belohnung und Erfüllung implizit, der durch die Motivik des Liebestodes in engem Konnex mit der Ökonomie der Liebesgabe steht. Auch im Kontext der Liebesdarstellung gilt das Prinzip der Reziprozität als Grundschema der Gabe, die in die Eigenlogik höfischer Interaktion und Ökonomie eingebunden ist: Eine Gabe erzeugt immer ein Ungleichgewicht, das des Ausgleichs bedarf.27 Die Liebesgabe hat nicht nur repräsentativen, sondern auch initiativen Charakter, indem das Erzählschema der Reziprozität die einseitige Liebesgabe zum Movens weiterer (Liebes)Handlungen macht.28 Der Liebestod als ultimative Liebesgabe bedingt einerseits ein Defizit und eine Schuld bei der Dame, die zu kompensieren ist, gleichzeitig führt er dieses ökonomische Prinzip ins Paradox, denn „das Opfer des eigenen Lebens etabliert einen Überschuss, der jenseits der Gabenökonomie steht und alle Hoffnung auf Äquivalenz zunichte macht.“29
Prägend für die narrative Gestaltung des ‚Herzmaere‘ ist aber vor allem eine weitreichende Übertragung christlicher Metaphorik auf die Minne-Handlung, durch die sich ein ganzes Beziehungsgeflecht von uneindeutigen und zum Teil widersprüchlichen Deutungsmustern eröffnet. Das ‚Herzmaere‘ steht damit prototypisch für die enge Interferenz von geistlichen und weltlichen Sinnsetzungen, die prägend für die volkssprachige Literatur des 13. Jahrhunderts ist.30 Konrad nutzt, wie auch Gottfried von StraßburgGottfried von Straßburg, eine religiös konnotierte Sprache und geistliche Semantiken, um die Protagonistenliebe im Kontext christlicher Werte zu auratisieren. Dabei stellt die religiöse Bildsprache sowohl Gottfrieds als auch Konrads nicht bloß eine „Nobilitierung[en] der literarischen Rede“,31 eine Entlehnung aus dem geistlichen Bereich dar, die dem Gesagten in referentieller Funktionalisierung größere Verbindlichkeit vermitteln soll,32 sondern die weltliche Liebeshandlung erfährt eine Analogisierung mit dem Religiösen, durch die das christliche Paradigma beständig eingespielt und zugleich überschritten wird.33
So bedingt schon die Situierung des männlichen Liebestodes im Heiligen Land deutliche religiöse Implikationen, die auf die Liebeshandlung übertragen werden. Das Verlegen der Liebeshandlung nach Jerusalem führt dazu, dass bei dem folgenden Geschehen die Semantiken von Frauen- und Gottesdienst zueinander in Beziehung gesetzt werden, Leiden und Sterben des Ritters erfahren eine Analogisierung mit den Mustern christlich motivierter Pilger- oder Kreuzzugsfahrten. Der Ritter wird in seinem Liebesleid sogar als marteraere (V. 260) bezeichnet, was unweigerlich die Assoziationen mit einem christlichen Selbstopfer aufruft. Es scheint, dass „der heilige Ort sein Sterben zum Minne-Martyrium erhebe und seine sterblichen Überreste, zumal sein einbalsamiertes Herz, als Reliquie erscheinen lasse.“34
Dabei gestaltet Konrad die Jerusalemfahrt des Ritters aber eindeutig als Minnedienst, der die christlichen Bezüge einer Reise ins Heilige Land ganz in den Hintergrund treten lässt.35 Anders als im ‚Castelain de CouciJakemés de Sakesap›Roman du castelain de Couci‹‘, wo der Geliebte tatsächlich als idealer Kreuzritter stirbt und auch der Ehemann sich nach der ehrenvollen Bestattung der Frau auf einen Kreuzzug begibt, wird die Jerusalemfahrt im ‚Herzmaere‘ aus ihrem eigentlichen Kontext gelöst. Die Reise resultiert aus einer umständlichen Motivierung aus List und Gegenlist, bei der die Figuren jeweils pragmatische Zwecke verfolgen. Der Ehemann, der die geheime Minne beobachtet hat, will die Liebenden durch eine gemeinsame Wallfahrt mit seiner Frau trennen; er baut auf eine unvollkommene Liebe, die in Abwesenheit des Geliebten verblasst. Der Ritter will der Frau nach Jerusalem folgen, um diese Trennung – und vielleicht auch das Vergessen – zu verhindern. Die Frau ersinnt die Jerusalem-Reise des Ritters als Gegenlist, um die eigene unbequeme Fahrt zu verhindern und gleichzeitig den Argwohn von Ehemann und Gesellschaft zu zerstreuen, um später ungestört die sexuell bislang unerfüllte Liebe verwirklichen zu können.36 Bei keinem Handlungsträger steht die Gottesliebe im Fokus, sondern diese wird in der wechselseitigen listreichen Interaktion für weltliche Liebesambitionen instrumentalisiert.37 Auch das in anachoretenhafter Weltabkehr gestaltete Martyrium des Ritters geschieht nicht um Gottes, sondern um der Dame willen, so wie auch deren das Leiden nachvollziehender Tod zwar die Bildsprache der Passionsfrömmigkeit zitiert, aber dennoch ein Geschehen weltlicher Liebe bleibt.
Die eindrücklichste und durch starke christliche Assoziationen aufgeladene Metaphorisierung stellt das gegessene Herz in seiner Analogie zur Eucharistie dar. Konrad verwendet das Motiv des Herzens in einer Gleichzeitigkeit eigentlich gegensätzlicher Kategorien, indem dieses sowohl Körperorgan als auch Zeichen der Liebe ist.38 Der Text spielt zahlreiche konventionelle Formeln ein, die das Herz als Liebeszeichen semantisieren, gleichzeitig bleibt es stets in seiner Körperhaftigkeit präsent. Das zentrale Motiv repräsentiert das Ineinandergreifen sinnlich-präsentischer und epistemischer Bedeutungsproduktion im ‚Herzmaere‘, dessen Ästhetik sich „im Wechselspiel von materialisierender und spiritualisierender Dimension“ manifestiert.39 Mit der Verwendung des tatsächlichen körperlichen Herzens als Liebeszeichen erfährt das literarische Motiv des Herzenstausches eine materielle Konkretisierung. Aber das gegessene Herz stellt bei Konrad nicht nur eine hyperbolische Schilderung des außergewöhnlichen Liebesgeschehens dar, sondern wird in einer Engführung mit geistlichen Bildern und Semantiken narrativiert, die eine Bezugnahme auf heilsgeschichtliche Vorgänge implizieren. Das Körperorgan als Liebeszeichen, das das Opfer des eigenen Lebens bezeugt, ist per se stark durch eine christliche Opferparadigmatik aufgeladen.40 Konrad führt die christliche Symbolik aber noch fort, indem er das Herz des Ritters als Symbol seiner Liebe und des um der Geliebten willen erlittenen Martyriums durch die Einbalsamierung und Aufbewahrung in dem kostbaren Kästchen gleich einer Reliquie inszeniert.41 Wenn der Ritter hierbei die Anweisung gibt, seinen toten Leib aufzuschneiden und das Herz zu balsamieren, damit es nicht verwest, wird deutlich herausgestellt, dass hier ein Körperorgan und nicht ein abstraktes Zeichen zugegen ist – wie es auch genuines Merkmal der Reliquie ist, durch körperliche Präsenz Anteil am Heiligen zu vermitteln:
sô heiz mir snîden ûf den lîp
und nim dar ûz mîn herze gar,
bluotic unde riuwevar;
daz soltu denne salben
mit balsam alltenhalben,
durch daz ez lange frisch bestê (V. 298–303).
Die sorgfältige Zubereitung durch den Koch, der mit edlen Gewürzen und hôhem flîze aus dem Herzen ein besonders köstliches Gericht macht, akzentuieren den folgenden Verzehr des Herzens als einen körperlichen respektive anthropophagischen Akt und damit als ein Moment absoluter Drastik.
Gleichzeitig wohnen dem Moment des Einverleibens des Herzens – gerade wegen der ausgestellten Körperlichkeit des Vorgangs – Implikationen einer Vereinigung mit dem Geliebten inne. Dieses Vereinigungsmoment wird deutlich herausgestellt, indem das Essen des Herzens mit einer besonderen sinnlichen Wahrnehmung geschildert wird. So erkennt die Frau, als sie unwissend das sorgfältig zubereitete Herz verzehrt, sofort die Besonderheit dieses Gerichts, das eine bemerkenswerte Wirkung auf sie hat:
daz jâmerlîche trehtelîn
sô süeze dûhte ir werden munt
daz si dâ vor ze keiner stunt
nie dekeiner spîse gaz
der smac ir ie geviele baz (V. 434–438).
Sie erklärt ihrem Ehemann nach dem Verzehr, dass es die beste, ein überhort aller Speisen sei, die sie je gegessen habe. Damit sind dem Verzehr des Herzens auch erotische Konnotationen inhärent, die Inkorporation des Geliebten und die überragende Wirksamkeit dieser Speise, ihre süeze, verweisen auch auf das Begehren der Liebenden, deren Verbindung wegen der großen Wachsamkeit des Ehemannes keine sexuelle Verwirklichung erfahren hat. Der sinnliche Ausdruck der süeze ist aber auch durch seinen ausgeprägten religiösen Sprachgebrauch geprägt und stellt ein Attribut dar, das mit starken christlichen Assoziationen belegt ist,42 womit der Verzehr des Herzens schon auf der Ebene der Physis eine besondere, religiös aufgeladene Wirkmächtigkeit erhält, die sich in die dem Inkorporationsmotiv inhärenten Implikationen einer unio mit Christus einfügen.
Gegen die These einer unmittelbaren eucharistischen Analogie führt Quast allerdings an, dass das Einverleiben des Herzens bei Konrad nicht mit der materiellen Realpräsenz der Eucharistie gleichgesetzt werden kann. Bei der Eucharistie bewirkt die Einverleibung der Hostie eine unmittelbare Partizipation am Heiligen, im ‚Herzmaere‘ dagegen bewirkt das Essen des Herzens für sich genommen noch keine unio. Die Analogie zum christlichen Selbstopfer kommt erst zum tragen, als der Ehemann seine Frau über die Beschaffenheit der Speise in Kenntnis setzt und damit deren symbolischen Gehalt offenbart:
Zwischen Verzehr und Partizipation am Verzehrten, am toten Liebhaber also, schiebt sich bei Konrad der Akt der Symbolisierung, die eucharistische Logik dagegen setzt auf die Gleichzeitigkeit von Symbolgestalt und Realpräsenz des Leibes. Konrads Physiologismus ist ohne die konstitutive Ordnung des Symbolischen gar nicht zu denken. Zugespitzt formuliert: Nicht das Herz als Organ, sondern das Herz als Zeichen bewirkt den Liebestod der Herrin.43
Auch die kirchliche Eucharistiefeier nutzt die Kraft des sprachlichen Zeichens, indem erst durch die Konsekrationsworte die Hostie zum Leib Christi erklärt und die unio ermöglicht wird; die Worte erzeugen aus dem Symbol die Realpräsenz des Leibes Christi. Das ‚Herzmaere‘ verfährt umgekehrt, denn hier erfolgt zuerst die tatsächliche physische Einverleibung des Herzens, das nachträglich durch die Worte des Ehemannes als Symbol der Liebe und des Liebesopfers erkannt wird und erst dann den Liebestod der Dame als Nachvollzug des männlichen Opfers bewirken kann.
Durch die umfangreiche Zitation christlicher Symbolik im ‚Herzmaere‘ werden zunächst Geltungsansprüche für die weltliche Minnehandlung erzeugt, die ehebrecherische Liebe scheint dadurch aufgewertet und ihr Gefährdungspotential durch das Verlegen in die Deutungssphäre christlicher Allegorese überspielt. Aber die zahlreichen religiösen Motive im ‚Herzmaere‘ bedingen keine unmissverständliche transzendente Überhöhung der Minne, zu deutlich sind die Brüche mit dem Religiösen, die der Text inszeniert.44 Die ausgeprägte sakrale Metaphorisierung der Liebeshandlung kann zwar als Ausdruck einer exemplarischen Geltungsbehauptung für das Geschehen gelesen werden, der aber Widersprüche und Fragwürdigkeiten eingeschrieben sind. So stellt die Inkorporation des Herzens vordergründig eine unio der Liebenden dar, aber eine tatsächliche Einheit im Minnetod als transzendenter Ausblick wird nicht gegeben. Anders als in den vidas um Guillem de CabestanhGuillem de Cabestanh oder bei JakemésJakemés de Sakesap›Roman du castelain de Couci‹, anders auch als im ‚TristanGottfried von Straßburg›Tristan‹‘ oder in der ‚Frauentreue›Die Frauentreue‹‘ als weiterer Erzählung über den wechselseitigen Liebestod,45 gibt es im ‚Herzmaere‘ keine gemeinsame ehrenvolle Bestattung der Liebenden, die eine christliche Legitimität der Liebe andeutet. Dem ‚Herzmaere‘ ist eine deutliche Verkehrung fest gefügter christlicher Wirkmuster eigen, indem Ritter und Dame zwar nach dem Modell des Märtyrers bzw. in Nachvollzug der Passion sterben, aber dabei keinen besonderen Gottbezug oder eine Hinwendung zum Heilsgeschehen zu erkennen geben. Das christliche Schema wird zwar zitiert, aber zu einem formalen Handlungsmuster umgewandelt, das seines eigentlichen Inhaltes entleert ist.46 Dabei formuliert das ‚Herzmaere‘ aber keine opponierende Haltung zu dem Geistlichen und seinen Wertansprüchen, denn die Dignität der transzendenten Implikationen wird durch das weltliche Geschehen nicht nivelliert. Vielmehr wird durch die parareligiöse Inszenierung der weltlichen Minne, die das geistliche Muster in weltliches Liebeshandeln überführt, ihr offensichtlicher Kontrast zur Gottesliebe akzentuiert.
Die Dignität der religiösen Bildlichkeit trägt einerseits zur Auratisierung und Autorisierung der weltlichen Liebeshandlung bei, führt aber andererseits den Kontrast zwischen geistlich-religiös erfüllter Gottesliebe und der Defizienz weltlicher Liebe vor Augen.47 Konrads Text spielt damit die Spannung zwischen den beiden Polen Gottesliebe und Frauenliebe aus, die dem höfisch-ritterlichen Minnebegriff von Anfang an implizit ist.48 Das ‚Herzmaere‘ schreibt sich in die Auseinandersetzung über den Geltungsanspruch passionierter Liebe und des höfischen Lebensentwurfs insgesamt ein, der Eigenanspruch der Minne „tritt in eine latente Konkurrenz zu einer christlichen Auffassung der Welt und sucht die Versöhnung mit ihr (›Gott und der Welt gefallen‹), muss sich aber in letzter Instanz ihr immer unterordnen.“49
In der widersprüchlichen Inszenierung der Geltungsansprüche weltlicher und geistlicher Liebe im ‚Herzmaere‘ wird die wechselseitige Durchdringung dieser Bedeutungsebenen, die „Durchlässigkeit geistlicher und weltlicher Semantiken“ augenscheinlich.50 Im ‚Herzmaere‘ wird die Liebesthematik, wie auch in Gottfrieds ‚TristanGottfried von Straßburg›Tristan‹‘, zu einer Kategorie der inhaltlichen und poetologischen Transgression, indem über ambige Zeichen als „strukturell unentscheidbare Metaphern“ ein beständiges Oszillieren zwischen dem Geistlichen und dem Weltlichen erzeugt wird.51 Im Bild des gegessenen Herzens kumulieren nicht nur die Überlagerungen von weltlichen und geistlichen Sinnsetzungen, als Figur des Einverleibens prägt es in seiner Verschränkung von Zeichen und Körperorgan auch eine dichte poetologische Lesbarkeit: Die Balsamierung und Verwahrung als ein kostbares Kleinod in dem geschmückten Kästchen sowie die sorgfältige Zubereitung durch den Koch als Verfahren kultureller Verfeinerung sind, analog zu Kunstpassagen als besonderen Kristallisationspunkten der Reflexion über literarische Fertigkeiten und artistische Meisterschaft in der volkssprachigen Literatur,52 auch als Dichtungsmetaphern lesbar. Sie lassen an die kunstvolle Formgebung der materia denken, die in der retextualisierenden Bearbeitung ihre artifizielle Ausgestaltung erfährt. Das ‚Herzmaere‘ will nicht nur, wie im Prolog angekündigt, ein Bild absoluter Liebe zeichnen, der Text ist auch selber ein Herz, das, aufgeladen mit der Dignität seiner religiösen Analogien, die memoria an die Liebenden und ihre herausragende Opferbereitschaft transportiert und dem Rezipienten zur Aufnahme anbietet.