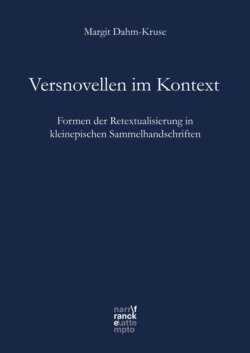Читать книгу Versnovellen im Kontext - Margit Dahm-Kruse - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.5 Der Schreiber als Akteur von Textform und Sammlung 3.5.1 Autor
ОглавлениеDie Diskussion um den mittelalterlichen Werkbegriff hängt unmittelbar mit der veränderten Perspektivierung von Autorschaft zusammen; mit der Überlieferung von Texten in verschiedenen, nicht hierarchisierbaren Redaktionen verliert auch die Vorstellung einer fassbaren und kohärenten Autorinstanz an Plausibilität.1 Die mittelalterliche Literatur hat, indem die Texte praktisch nie als Autographen vorliegen und häufig anonym überliefert sind, keine Basis für eine dezidiert Autor-Orientierte Literaturgeschichte und schließt vor allem ein Verständnis des Autors als biographisch fassbare Größe weitgehend aus.2 Einen weiteren Bruch erfährt die Autor-Werk Relation durch den Anachronismus der Manuskriptkultur, denn die erhaltenen Handschriften wurden häufig deutlich nach der angenommenen Entstehungszeit der tradierten Dichtungen erstellt.3 Dennoch werden die Texte zumeist implizit als zeitgenössische Dichtungen aus der Schaffensperiode der ‚ursprünglichen‘ Verfasser und nicht als ästhetische Artefakte der Entstehungszeit der Handschriften gelesen.4 Das ‚HerzmaereKonrad von Würzburg›Das Herzmaere‹‘ Konrads von Würzburg steht prototypisch für dieses Phänomen. Obwohl die Versnovelle überwiegend in Manuskripten des 14. und 15. Jahrhunderts vorliegt und längst nicht immer mit einer Verfassersignatur versehen ist, wird sie als Dichtung des 13. Jahrhunderts und in unmittelbarem Autorbezug wahrgenommen. In den Sammelhandschriften sind die unklaren Autorbezüge und die A-Historizität der Überlieferung noch gesteigert, indem Texte verschiedener Autoren und aus unterschiedlichen Zeiträumen nebeneinander gestellt und in die Kohärenz der Sammlung eingeordnet werden.5
Die Absenz definitiver Autortexte und die Nicht-Fassbarkeit historischer Autoren macht die Autorinstanz aber keineswegs obsolet, die Heterogenität der Texte negiert nicht die Annahme einer Autorintention.6 Der Autor ist nicht nur als Kategorie der mediävistischen Forschung und Editionspraxis relevant,7 Vorstellungen von Autorschaft und einer damit verbundenen Autorität sind auch in den mittelalterlichen Texten selber präsent. Die o.g. Mahnungen vor der (unsachgemäßen) Änderung von Texten als Strategien der Autorisation und Authentifizierung zeugen nicht nur von einem ‚Werk‘-, sondern auch von einem Autorenbewusstsein.8 So weist Quast in Konrads von Heimesfurt ‚Diu urstendeKonrad von Heimesfurt›Diu urstende‹‘ ein zeitgenössisches Verständnis von werc als einmaliges, an seine Materialität gebundenes und handwerklich erstelltes Artefakt nach, das schon aus einer produktionspraktischen Logik heraus untrennbar mit dem Autor verknüpft ist: „Vom Konzept einer Autonomie des Textes, eines Textes, der als vom Autor ein für allemal entbunden vorgestellt wird, fehlt bei Konrad jede Spur.“9 Konrad mag in seiner spezifischen Konturierung der Autor-werc-Relation ein Sonderfall sein, indes bezeugt die Praxis, Selbstnennungen von Autoren in Pro- und Epiloge von Dichtungen einzubinden und sekundäre Verknüpfungen von Texten mit Autorennamen herzustellen, wie sie etwa in den Dichterkatalogen Rudolfs von EmsRudolf von Ems zu Tage treten, eine Relevanz der Vorstellung von Autorschaft an sich sowie von volkssprachiger Autorschaft im Besonderen.10 Auch die kleine Reimpaardichtung, die im 13. Jahrhundert noch häufig anonym überliefert ist, tritt ab dem 14. Jahrhundert zunehmend mit Autornennungen und in autorzentrierten Kompilationen in Erscheinung. Auch wenn diese Angaben keine verbindlichen biographischen Informationen darstellen, sind sie dennoch nicht irrelevant. Ebenso wenig können die Autornennungen (nur) als fiktionale Instanzen verstehbar gemacht werden, die eine Erzählerrolle entfalten und damit das Erzählte als Fiktion markieren.11 Weiterhin zeigen die Ovationen an die Meisterschaft bestimmter Autoren, etwa das Lob von Gottfrieds Dichtkunst im ‚HerzmaereKonrad von Würzburg›Das Herzmaere‹‘, oder auch die Dichterschelte, für die Gottfrieds ‚TristanGottfried von Straßburg›Tristan‹‘ ein prominentes Beispiel liefert, dass Autorschaft als konkrete Kategorie der Textproduktion gedacht wurde, an die bestimmte Vorstellungen von Meisterschaft und Fähigkeiten gebunden sind.12 Dass die Autorität, die bestimmten Autoren zugeschrieben wurde, auch als verfügbares Mittel betrachtet werden konnte, um Texten Geltung zu verleihen, zeigen die zahlreichen Texte, deren Autorsignaturen in ihrer Echtheit in Frage gestellt werden.13
In der Summe zeigt sich, dass der Text in der vormodernen Literatur kaum als subjektlose Kategorie gedacht wurde. Auch ohne die klare Relation von biographisch fassbarem Autor und seinem ‚Werk‘ bzw. ‚Originaltext‘ ist in den literarischen Texten des Mittelalters eine Vorstellung von Autorschaft präsent, die Autorität und Authentizität für die vom Autor gesetzten spezifischen Sinnsetzungen impliziert:14 Trotz varianter Überlieferung bleibt dem Text damit „jener Sinn als Spur eingeschrieben, die auf die Intention des Autors zurückführen kann.“15